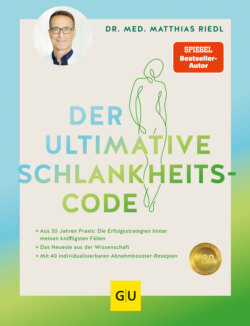Читать книгу Der ultimative Schlankheitscode - Dr. med. Matthias Riedl - Страница 45
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDER EIWEISS-STOFFWECHSEL
Die Verstoffwechselung von Proteinen beruht auf den Aminosäuren, die während der Verdauung im Darm entstanden sind: Sobald diese in die Blutbahn gelangen, helfen Transport-Enzyme, die Moleküle zu bewegen.
Zielort ist dabei zunächst die Leber: Diese bildet den Hauptumschlagplatz und bestimmt über die weitere Verwendung.
Verwendung 1: Die Leber selbst setzt die Moleküle wieder zu komplexen Eiweißverbindungen zusammen, die verschiedene Funktionen im Körper erfüllen. So liefern Proteine wichtiges Baumaterial: Unsere Muskeln etwa bestehen hauptsächlich aus Eiweißen, ebenso Haare, Haut und Herz.
Verwendung 2: Die Leber schickt die Aminosäuren zurück ins Blutsystem, damit sie in anderen Zellen beim Proteinaufbau eingesetzt werden können. Denn die Körpereiweiße erneuern sich permanent: In den Zellen von Leber, Bauchspeicheldrüse und Blut beispielsweise geschieht dies etwa alle zehn Tage, in denen der Haut alle drei Monate.
Verwendung 3: Die Leber nutzt die Moleküle zur Energiegewinnung. Da Eiweiße jedoch viele strukturelle Funktionen besitzen (siehe >), geschieht dies nur in Ausnahmefällen – etwa wenn wir fasten.
Dann baut der Körper beispielsweise die Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin b ab, wobei Acetoacetat entsteht: Dieser Stoff bildet die Vorstufe von Ketonkörpern, aus denen der Körper in Zeiten ohne Nahrungszufuhr Energie ziehen kann.
Am Ende des Eiweißstoffwechsels steht wieder die Niere. Denn beim Abbau von Aminosäuren bilden sich Abfallprodukte wie Ammoniak und Harnstoff.
Diese filtern die Nieren aus dem Blut – und sorgen dafür, dass sie über den Urin ausgeschieden werden.
DER FETT-STOFFWECHSEL
Diese Stoffwechselart ist die komplexeste von allen. Dabei unterscheiden Experten zwei Stoffwechselwege: Beim ersten nimmt der Körper die Fettstoffe aus der Nahrung auf, bei der zweiten stellt er sie selbst her – beispielsweise aus Zucker.
Besonders relevant im Hinblick auf unser Gewicht ist der zweite Weg!
Denn essen wir viele kohlenhydratreiche Produkte mit freiem Zucker oder raffiniertem Mehl und verbrennen die Kohlenhydrate nicht direkt, baut der Körper sie in die sogenannten Neutralfette um (»Triglyceride«). Diese stapelt er dann in den Fettzellen, als Energiereserve für schlechte Zeiten.
Eine entscheidende Rolle im Fettstoffwechsel spielen – wie im Zuckerstoffwechsel auch – Hormone.
Ist der Blutspiegel an Insulin über längere Zeit hinweg niedrig und/oder die Konzentration an Glucagon und Adrenalin hoch, baut unser Körper Fett ab, um daraus Energie zu gewinnen. Bei dieser sogenannten Lipolyse spalten spezielle Enzyme die Triglyzeride wieder in ihre Einzelbestandteile auf. Anschließend bringen Transportproteine die Fettsäuren in jene Zellen, die Energie benötigen. Dort werden sie in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, in Energie umgewandelt.
Ist der Insulinspiegel dagegen durch ständiges Snacken und eine entsprechend große Kohlenhydratzufuhr permanent erhöht, unterbindet das den Fettabbau sofort.
Für diesen Effekt genügen schon kleinste Mengen Kohlenhydrate: ein Kaffee mit Milch, ein kleines Stück Toast oder aber drei Weintrauben.
Unser Körper ist ein echter Großmeister, wenn es darum geht, Speicherfett abzusichern – schließlich war dieses über Jahrmillionen unsere Lebensversicherung, da es uns in den regelmäßig wiederkehrenden Phasen des Nahrungsmangels vor dem Verhungern schützte.
Nun, am Ende dieses Kapitels, wissen Sie nicht nur über die anthropologischen Grundlagen des Essens Bescheid, sondern auch über die körperlichen Abläufe, die einsetzen, sobald wir einen Bissen nehmen. Nun gilt es, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was wir uns da eigentlich konkret einverleiben. Denn jede Substanz, die in unserer Nahrung steckt, hat ganz spezifische Auswirkungen auf den Körper – und unser Gewicht. Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir anschließend souverän den persönlichen Speiseplan analysieren. Also schauen, von welchen Nährstoffen, die der Figur nicht guttun, wir zu viel konsumieren, von welchen günstigen Substanzen wir umgekehrt deutlich zu wenig essen – und damit, ohne dass es uns bewusst wäre, die eigenen Abnehmversuche sabotieren.
Essen ist
ein Bedürfnis,
geniessen
eine Kunst.
FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
WAS SIND KALORIEN?
Wann immer Menschen vom Abnehmen sprechen, fällt schnell der Begriff Kalorie. Das Wort ist eine Abkürzung für die Maßeinheit »Kilokalorie« (kurz: kcal): Eine Kilokalorie entspricht der Menge an Energie, die nötig ist, um einen Liter Wasser unter bestimmten Bedingungen um ein Grad zu erwärmen. Auf Lebensmittel bezogen bedeutet dies: In 100 Gramm Vollmilchschokolade, die 535 Kalorien enthalten, ist so viel Energie gespeichert, dass sich damit 535 Liter Wasser um ein Grad erhitzen ließen. Seit einigen Jahrzehnten benutzen Fachleute die etwas genauere Maßeinheit »Joule«. Eine Kilokalorie entspricht dabei 4,18 Kilojoule. Aus Gründen der Gewöhnung und Einfachheit bleibe ich in diesem Buch allerdings beim Begriff Kalorie.
Wichtig: Kalorie ist nicht gleich Kalorie! Essen wir beispielsweise etwas Eiweißreiches, muss der Körper einen guten Teil der damit gelieferten Energie aufwenden, um die Proteine zu verdauen. Das Gleiche gilt für Ballaststoffe. Isolierte Kohlenhydrate dagegen kann unser Organismus umstandslos verwerten: Jede Kalorie, die wir ihm etwa über freien Zucker in Form von Gummibärchen zuführen, landet daher, wenn wir sie nicht durch Bewegung verbrennen, beinahe ohne Verlust auf den Hüften! Deshalb sollten Sie bei Nährstoffangaben nicht allein auf die Gesamtzahl an Kalorien achten, sondern vor allem auf den Zuckergehalt. Dunkle Schokolade etwa hat mehr Kalorien, aber ein besseres Nährstoffverhältnis als die Vollmilchvariante.