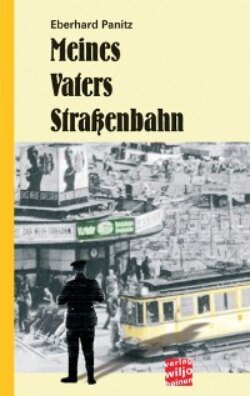Читать книгу Meines Vaters Straßenbahn - Eberhard Panitz - Страница 10
ОглавлениеWir fuhren und fuhren, ich dachte nicht ans Aussteigen, achtete nicht auf die Zeit, obwohl wir uns, Vater und ich, kaum etwas zu sagen hatten. Etwas Fremdes war zwischen uns, wir hatten uns fast aus den Augen verloren. Was zuletzt passiert war, daran wollte ich auf keinen Fall rühren. Niemand in der Familie, die sowieso in alle Winde zerstreut worden war, sprach davon. Aber das Gedächtnis glich einer Marter, scheinbar Nebensächliches machte mir bisweilen am meisten zu schaffen. »Bagatellen, Kleinkram, dumme Eifersucht«, sagte mein Vater, als hätte er meine Gedanken erraten. Er brachte es fertig, darüber zu lachen oder schmunzelnd zu schweigen, bis ihm etwas anderes einfiel. »Der Regen hört nicht auf und hört nicht auf«, erklärte er staunend und wischte mit der Hand über die undurchsichtige Scheibe. »Erkennst du, wo wir sind?« Er schloß die Augen und nickte mir zu. Natürlich wußte er genau, wo wir uns befanden, er hätte auch bei völliger Dunkelheit die Straßen und Stationen nennen können, sogar im Traum rief er sie früher manchmal aus. Einen Moment überlegte ich jedoch, ob er sich hier, in der fremden Stadt, genauso auskannte oder manchmal der Täuschung unterlag, am Wilden Mann oder Trachenberger Straßenbahndepot losgefahren und dann in den nächtlichen Nebel der gänzlich verwandelten Stadt an der Elbe geraten zu sein? »Hast du noch bißchen Zeit, oder mußt du nach Hause?« fragte er, dabei betonte er eigentümlich das Wort »nach Hause«, schluckte etwas hinunter und wischte wieder an der Scheibe herum. Dann sagte er wie aufgeschreckt: »Ich wünsch´s dir nicht, nein, keinem anderen wünsch ich, daß er so aus allem herausgerissen wird wie ich.«
Ich hatte mich nach Vaters letztem Kriegsurlaub allein gefühlt, im trüben Herbst, auf der alten Burg Frauenstein, in einem großen Saal mit vergitterten Fenstern, Bänken und Tischen aus rohem Holz, Soldatenspinden und einer Ecke mit Stroh für die Nacht. »Ein Junge muß so was mal mitmachen«, hatte Mutter gesagt und mich lange abgedrückt, ehe ich mit dem Tornister zum Bahnhof gelaufen war. Nur wer die sechzig Meter unter zehn Sekunden lief und einen Meter fünfzig hochsprang, durfte nach Frauenstein fahren und an dem Geländespiel teilnehmen, zu dem sogar der Bannführer erschien. An meinen Tornister waren mit Lederriemen ein Kochgeschirr, eine Feldflasche und eine Decke geschnallt. »Die Decke ist zu bunt«, tadelte mich der Bannführer. Doch andere waren noch bunter ausstaffiert, manche hatten statt des Tornisters ihren Schulranzen mitgebracht, karierte Wolldecken, bunte Emailletöpfe, Limonaden-und Thermosflaschen. Das alles flog in hohem Bogen über die Mauer die Felswand hinab. Im Dunkeln durften wir zusammensuchen, was nicht zersplittert oder verschwunden war. Meine Decke hing vorm Burggraben in einem Baum, und als ich hinaufkletterte, gab es auf Kommando einen Steinhagel vom Burgturm herab. Mich traf nichts, die Steine klatschten ins Wasser. Einer, der dort im Graben seinen Emailletopf suchte, weil er sonst nichts zu essen bekommen hätte, schrie nach seinem Vater und seiner Mutter und winselte. Er war am Kopf getroffen und so schwer verletzt worden, daß er ins Krankenhaus und danach nach Hause gebracht werden mußte. »Du bist wenigstens kein Jammerlappen«, sagte unser Fähnleinführer beim Abschlußappell zu mir und heftete mir den Hordenführerwinkel an den Braunhemdärmel. »Den inneren Schweinehund besiegen, darauf kommt´s an, Junge!«
Als ich nach Hause zurückkehrte, merkte ich, Mutter hatte Besuch gehabt. Es lag eine Zigarettenschachtel herum, außerdem roch es in allen Zimmern nach Rauch. Sonst rauchte niemand bei uns, nur Vater ganz selten Zigarren, wenn er sie geschenkt bekam. Ein paar leere Weinflaschen standen in der Küche, im Aufwaschbecken sah ich Gläser und Geschirr vom Weinlaub-Service, das nur an Feiertagen auf den Tisch kam, auch das gute Eßbesteck war benutzt worden. Sogar Vaters Hausschuhe standen an einem anderen Platz. »Mutter, wer war hier?« fragte ich und unterdrückte das Weinen, das mir im Hals würgte. Doch als ihr selbst die Tränen kamen, sagte ich mit fester, ruppiger Stimme: »Jetzt bin ich ja da und fahre nie wieder weg.«
Mit meinem Freund Wolfgang zog ich oft in den nahen Wald, zur Räuberhöhle oder Drachenschlucht, zum Verlorenen Wässerchen, einem armbreiten Bächlein, das in einer Felsenschlucht entsprang und im Heidekraut nahe dem Roten Teich und Wilden-Mann-Berg versickerte. Dort waren Kasernen gebaut worden, die Rekruten exerzierten auf dem Heller, einem sandigen Kahlschlag, der wie ein Schlachtfeld aussah, wenn Panzer und Motorräder hin- und herrasten, Soldaten ihre Platzpatronen verschossen und Handgranaten und Sprengsätze explodierten. Wir durften am Zaun nicht stehenbleiben, auch die Räuberhöhle am Roten Teich wurde vermauert und zugesperrt, bald war der Heller von lauter Munitionsbunkern und Wachposten umgeben. »Haut ab!« riefen die Soldaten. »Sonst knallt´s.« Immer weiter flüchteten wir deshalb in die Wälder, manchmal nahm ich meinen Bruder mit, obwohl mein Freund es nicht wollte. Auch Günter und Manfred aus dem Nebenhaus liefen uns hinterher, sogar Anita und Gabi, die uns mit ihrem Gerede von Liebe und Liebesbriefen langweilten. Auf einem Hügel, gar nicht weit von den Waldteichen, pflückten und aßen wir Heidelbeeren, lachten über unsere blauen Lippen und Zähne, verwandelten uns kurzentschlossen in Rothäute und bauten einen Wigwam aus herabgebrochenen Ästen und Reisig. Als Indianerhäuptlinge hockten Wolfgang und ich im Heidekraut, gruben das Kriegsbeil aus, verhandelten in Winnetou- und Old-Shatterhand-Sprache und rauchten schließlich die Friedenspfeife. Einmal, als schon die Dämmerung kam, fesselten wir Manfred und meinen kleinen Bruder an einen Baum, verkrochen uns im Zelt aus Kiefernästen und feierten Wolfgangs Häuptlingshochzeit mit Anita, seiner Squaw. »Endlich sind die Großen unter sich«, sagte die Indianerbraut und zog sich nackt aus. Wir Jungen knöpften die Hosen auf und zogen die Hemden hoch, so saßen wir eine Weile mit roten Köpfen wie im Fieber da und staunten uns an. Nur Gabi weigerte sich, ihr Kleid oder gar den Schlüpfer auszuziehen. Sie lief weg, irrte allein umher, kam erst spät abends nach Hause und erzählte ihren Eltern, was vorgefallen war. Auch meine Mutter erfuhr davon, sie schüttelte entsetzt den Kopf und sagte zu mir: »Und deinen Bruder bindest du an einen Baum, schämst du dich nicht?«
Mein Vater hatte einen Bruder, Onkel Walter, der ein paar Jahre jünger und Schustergeselle war. Von ihm bekam er Lederreste, Absätze, Nägel und Holztäkse, um unsere Schuhe zu besohlen. Auch ein paar Kniffe, wie man leimte und nähte, sah er sich von ihm ab. »Wenn mal keine Straßenbahn mehr fährt«, sagte Onkel Walter, als die ersten Bomben auf die Städte am Rhein fielen, »hast du wenigstens einen Beruf.« Er wollte auch mich anlernen und prophezeite mir, daß sowieso alles in Schutt und Asche versinken und der Mensch wie früher auf allen Vieren, wenn möglich mit zwei Paar gutbesohlter Schuhe, krauchen würde. »Autos, Zeppeline, Ballons, Flugzeuge, zum Teufel damit«, schimpfte er und tippte sich an den Kopf, weil er früher hoch hinaus gewollt habe. »Du auch, was? Wie dein Vater?« fragte er mich, während ich auf seine Hände starrte, die immer schwarz vom Pech waren, das er ringsum an die Sohlen und Absätze schmierte, damit die Schuhe nach der Reparatur wie neu aussahen. Als Onkel Walter heiratete und der Pfarrer in der Kirche den Ring an seinen Finger steckte, achtete ich nur darauf, ob da Pechflecke zu sehen waren. Ich vergaß die Blumen zu streuen, drehte mich auf dem Nachhauseweg immer nach ihm um und fiel mit dem Korb voller Rosen hin. »Das bringt Unglück«, sagte Großmutter und bekreuzigte sich. »Behalt´s für dich, es wird Phosphor und Schwefel regnen und viel, viel Pech!«
Das Haus, in dem wir wohnten, war zwei Jahre vor dem Krieg gebaut worden, unser Keller war der größte und in der Mitte durch eine Säule abgestützt und als Luftschutzkeller gekennzeichnet. »Also rechnen wir mit dem Schlimmsten«, sagte Vater und schichtete die Kohlen und das Holz in den hintersten Winkel. Er las kaum Zeitungen, doch beobachtete genau, was in der Stadt passierte, durch die er täglich mehrmals fuhr. »Man lädt Sandsäcke ab«, berichtete er eines Abends. »Mir wär´s lieber, wenn sie Kartoffelsäcke brächten.« Er machte noch seine Witzchen darüber und glaubte nicht, daß die vielen Militärtransporte, die er auf den Brücken und Bahndämmen sah, schon auf dem Weg in den Krieg waren. Für das schwarze Verdunklungspapier, das es plötzlich in den Papierläden zu kaufen gab, wollte er keinen Pfennig ausgeben. »Ich klebe doch nicht meine Fenster selber zu und bezahle noch dafür.« Aber als auch vor unserem Kellerfenster Sandsäcke gestapelt und in jedem Haus Feuerlöschgeräte verteilt wurden, verging ihm das Witzeln und Lästern. Kurz vor seiner Einberufung räumte er mit den Nachbarn das Gerümpel vom Dachboden, damit im Notfall ungehindert gelöscht werden konnte. Er besorgte schließlich auch Verdunklungsrollen und befestigte sie. Für mich und Mutter kaufte er Gasmasken, und als mein Bruder geboren wurde, meinte er, für den Kleinen genüge ein nasses Tuch vor dem Mund. »Und ich«, fügte er hinzu, als er seinen Koffer packte, »ich frage mich bloß, wer mir den Mund gestopft hat. Wer sagt denn noch was? Weißt du, warum der Krieg sein muß?«
Mein Bruder war fünf Jahre, als auf Dresden die ersten Bomben fielen. Er schlief und merkte nichts, es war ziemlich weit entfernt, in Freital, nahe der Bienertmühle, von der ich nur wußte, daß dorther unser Brot kam. Manche meiner Freunde fuhren am nächsten Morgen nach Coschütz, um sich vom Berg und Felsen herab die Ruinen anzusehen. Mich hielt Mutter zurück, als ich wegwollte, sie sagte: »Bald brauchst du kein Fahrgeld zu bezahlen, wenn du Ruinen sehen willst.« Am dreizehnten Februar fünfundvierzig, am Faschingsdienstag, heulten wie fast jeden Abend die Sirenen, nachdem ich meine Indianerverkleidung gerade ausgezogen hatte. Mein Bruder erwachte nicht einmal, als wir ihn in den Keller trugen und das Knallen der Bomben näher und näher kam. Ein Stück Putz fiel von der Stützsäule herab, die Wände, an die wir uns preßten, schienen zu wanken. Der alte Herr Pietzsch hatte noch vor der Haustür gestanden und die Leuchtbomben überm Ostragehege gesehen. »Jetzt sind wir dran«, flüsterte er, als er atemlos in den Keller kam. Seine Frau erlitt einen Herzanfall, stürzte vom Stuhl und rang röchelnd nach Luft. Ich mußte meinen Bruder in die Arme nehmen, Mutter lief in die Wohnung und holte die vergessene Luftschutzapotheke, während ringsum die Bomben krachten. »Die Scheibe von der Balkontür ist zersprungen«, sagte sie und hielt einen Löffel in der Hand, zählte genau die Tropfen ab, die Frau Pietzsch bekommen mußte, und flößte sie ihr ein. »Geht´s wieder besser?« fragte sie. Und als das Licht verlöschte, legte sie einen Arm um mich, den anderen um meinen Bruder und sagte: »Das bedeutet nichts, gar nichts, nur ein Kurzschluß oder eine Stromunterbrechung, ein Kabel ist kaputt. Hört ihr, jetzt ist´s fast still.«