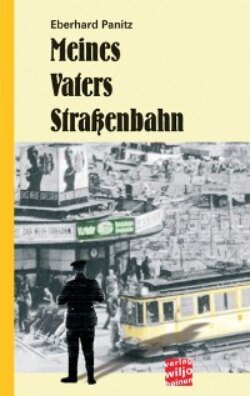Читать книгу Meines Vaters Straßenbahn - Eberhard Panitz - Страница 7
ОглавлениеEin paar Leute stiegen in die Straßenbahn ein, bald wieder aus, ich nahm es kaum wahr. Auch mein Vater kümmerte sich nicht darum und blieb bei mir, obwohl er sonst seine Pflichten sehr genau nahm. Mich bat er nochmals ums Fahrgeld, zwinkerte mir zu und sagte: »Du hast mir nie ernstlich Schwierigkeiten gemacht.« Immerhin hatte ich sein Fahrrad geölt, geputzt und später mit Decken verhängt, als er Jahr um Jahr weggeblieben war. Ich hatte es nicht benutzt, sooft Mutter auch sagte, ich könne es gut gebrauchen und getrost nehmen, sie würde damit ohne weiteres fahren, wenn es nicht ein Herrenrad und der Sattel zu sperrig für sie sei. Denn bald nach der Geburt meines Bruders, vier Jahre bis zum Bombenangriff, mußte sie jeden Tag zur Arbeit in die Stadt, in die vollen Straßenbahnen, die sie haßte, noch als Vater Schaffner war. »Das Geratter, Gedränge, die schlechte Luft, und überhaupt«, stöhnte sie abends, am Trachenberger Depot, wo ich sie mit meinem Bruder abholte, nachdem wir tagsüber bei der Großmutter gewesen waren. »Ich möchte bloß wissen, ob ich in meinem Leben noch einmal mit einem Auto oder Flugzeug in der Welt herumkomme.«
Einen Urlaub, eine Reise irgendwohin gab es nie. Nur Mutter fuhr einmal im dritten oder vierten Kriegsjahr nach Lemberg, um einen Feldwebel zu treffen, den sie im Kaufhaus Renner kennengelernt hatte. »Ich habe ihm die beste Seife gegeben, die versteckt in einer Ecke lag«, erzählte sie später, als die Nachricht kam, daß er noch im letzten Moment an der Oderfront gefallen war. »Er liebte feine, teure Sachen, er war ein gebildeter Mensch.« Tagelang weinte sie, wochenlang schrieb sie an Vater keine Zeile, von dem regelmäßig Feldpostbriefe kamen, die immer mit dem Satz endeten, daß es ihm den Umständen entsprechend gut ergehe, was er auch von uns hoffe nebst allen Verwandten und Bekannten, die wir freundlichst grüßen sollten. »Freundlichst«, ereiferte sich Mutter, wenn sie das las. »Was denn noch?«
Von Lemberg war sie wie verwandelt zurückgekommen, ernst, trotzdem übermütig und entschlossen. Die Fahrt war langwierig und gefährlich gewesen, mit einem Hotelzimmer hatte es nicht geklappt, doch dann war sie mit diesem Feldwebel am Stadtrand bei Bauern untergekommen. Nachts war etwas explodiert, es hatte eine Schießerei gegeben, zwei Tage war die Vorortbahn wegen der Partisanengefahr gesperrt. »Seitdem weiß ich, was los ist, niemand soll mir mit dummem Gerede kommen«, sagte sie und ging abends immer häufiger weg. Sie hatte sich vorgenommen, aus dem vertrackten Kriegsleben das Beste zu machen, rackerte sich nicht mehr bei der Arbeit ab, unterhielt sich mit Kunden, die bißchen mehr Geist hatten, wie sie sagte. »Sieh her, was mir jemand geschenkt hat«, sagte sie und zeigte mir ein Lederetui mit einem winzigen Füllfederhalter. »Wenn ich Zeit hätte, würde ich mich hinsetzen und damit einen Roman über mein Leben schreiben.« Oft war ihre Tasche voller Parfüm- und Kölnischwasserflaschen, Seife, Haarwäsche, die in den Lagerecken verstaubten, weil im letzten Kriegsjahr fast nur noch Einheitsseife und Scheuersand auf Marken verkauft wurden. Vieles von den Luxusdingen schickte sie dem Feldwebel nach Lemberg, manches tauschte sie gegen Zigaretten, Kaffee und Kognak ein, dafür wieder erwarb sie Kartoffeln, Mehl oder Zucker. »Es ist möglich, daß uns noch Bomben zerfetzen oder das Haus abbrennt, aber hungern werden wir nicht«, sagte sie und gab uns Jungen das Beste, aß selbst reichlich und brachte auch noch etwas der Großmutter und ihrer kränkelnden Schwester Lotte. »Ich kann Leidensmienen nicht ausstehen, man muß sich durchbeißen und seine Zähne zeigen, solange man welche hat.«