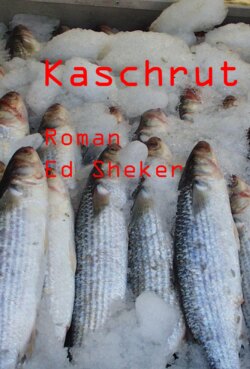Читать книгу Kaschrut - Ed Sheker - Страница 5
Maschgiach
ОглавлениеGuten Tag Herr Schimatzky. Ich darf mich vorstellen: Parnas, Oberkommissar bei der Mordkommission und das ist mein Kollege Kommissar Kleinschmidt.
Angenehm. Schimatzky. Ich bin der Pächter der Küche. Aber Mordkommission? Sie glauben an ein Tötungsdelikt bei dieser Vergiftungssache beim letzten Gemeindekiddusch?
Momentan ist es für Spekulationen noch viel zu früh. Das wird sich alles in den nächsten Tagen erst ergeben. Herr Schimatzky, zunächst mal eine Frage, die Ihnen vielleicht unpassend erscheinen mag. Aber sind Sie auch Mitglied in der Jüdischen Gemeinde?
Nein. Ich bin ja auch nicht jüdisch. Mein Name lässt vielleicht etwas anderes vermuten.
Und trotzdem sind sie Pächter der Küche?
Ja, warum denn nicht?
Wir haben die Vorstellung, sie mag irrig sein, dass die Jüdische Gemeinde nur oder wenigstens überwiegend jüdische Mitarbeiter hat.
Das ist nicht richtig. Nicht einmal in der Verwaltung ist das meines Wissens so. Aber die Küche wurde ganz normal ausgeschrieben und nach der Bundeskantinenrichtlinie fremd vergeben.
Nach der was?
Bundeskantinenrichtlinie. Eigentlich heißt es Richtlinien für Kantinen bei Dienststellen des Bundes. Nach deren Grundsätzen werden die Vergabe und der Betrieb geregelt. Immerhin ist die Gemeinde eine Körperschaft öffentlichen Rechts.
Aber Ihre Kantine muss doch koscher sein? Ich verstehe nicht viel von den jüdischen Speisegesetzen, aber doch immerhin genug, um in groben Zügen zu wissen was koscher ist.
Na und? Natürlich kochen wir koscher. Sogar glatt.
Klären Sie einen dummen Menschen auf. Was ist glatt?
Glatt heißt so viel wie super koscher. Mehr weiß ich auch nicht, da müssen Sie schon den Rabbiner fragen. Ich tu nur was man mir sagt, und meine Angestellten sowieso.
Wie viele Leute haben Sie denn?
Zwei Köche und eine Spülkraft. Ich mache den ganzen Bestell- und Verwaltungskram.
Und wer sagt Ihnen, was Sie zu tun haben?
Na, der Maschgiach!
Wer ist das denn?
Das frage ich mich auch manchmal. Also einfach gesagt, der Koscheraufseher. Der passt auf, dass hier alles richtig läuft.
Und der, was sagten Sie, Maschiach
Maschgiach...
der Maschgiach ist auch bei Ihnen angestellt?
Nein, der ist Angestellter der Gemeinde. Aber bezahlen muss ich den, über irgend so einen krummen Weg. Wir zahlen die Kohle, die bekommt dann der Rabbiner, weil formal ist der unser Aufseher in der Küche, und der führt das Geld an die Gemeinde ab. Aber am Ende bin ich der Goldesel, der alles bezahlen darf.
Aber der Maschgiach ist jüdisch?
Und wie! Super jüdisch!
Und wie sieht die Koscheraufsicht so aus?
Der Maschgiach kommt morgens um sieben, wenn wir Glück haben. Dann macht er die Herdplatten und Öfen an, kontrolliert den Wareneingang und passt auf, dass in den Laden nichts reinkommt, was nicht koscher ist. Dann sieht er beim Schnippeln des Salats zu und manchmal besieht er sich die Eier, die wir verwenden. Den Rest des Tages schleicht er herum, sieht in unsere Töpfe, sitzt auf seinem Stuhl und liest in dicken hebräischen Büchern. Den Job hätt' ich auch gern. Obwohl, soviel zu beaufsichtigen gibt es eigentlich nicht, weil meine Leute alle bestens Bescheid wissen und praktisch keine Fehler machen. Aber der Maschgiach muss trotzdem sein. Kommt gleich nach dem lieben Gott.
Der passt also auf, dass nichts Verbotenes in Ihre Küche kommt?
Nichts, was nach den Gesetzen der Juden verboten ist.
Gibt es da besondere Merkmale?
Herr Kommissar, wollen Sie jetzt ein Seminar über koschere Küche? Dann sitzen wir morgen noch zusammen. Also mal in aller Kürze: Gemüse ist fast immer OK, außer aus dem Ursprungsland ist Israel.
Israel geht nicht?
Nein.
Versteh ich nicht.
Ich auch nicht. Ist nun mal so. Muss ich auch nicht verstehen, dafür haben wir ja den Maschgiach. Alles was irgendwie in einer Fabrik hergestellt worden ist, hat irgendwo eine kleine Markierung auf der Verpackung, so ein Logo oder einen Schriftzug. Das hat jedes Produkt aus industrieller oder gewerblicher Fertigung. Fleisch aber auch.
Und der Schriftzug oder das Logo sagt Ihnen koscher oder nicht-koscher?
Also das ist sehr vereinfacht ausgedrückt. Wollen wir aber zunächst mal so stehen lassen. Aber nicht alle Logos und Siegel sind in Ordnung.
Wieso nicht?
Weiß ich auch nicht. Ist nun mal so. Öko ist ja auch nicht öko. Da gibt es sehr unterschiedliche Standards. Der Maschgiach erkennt nur bestimmte Logos an. Bei einigen guckt er maulig aus der Wäsche und wir dürfen das Produkt nicht verwenden. Kommt aber selten vor, weil wir ja wissen, was wir kaufen dürfen und was nicht.
Sie wollen mir erzählen koscher ist nicht gleich koscher?
So ungefähr. Wie ich schon sagte: öko ist nicht gleich öko.
Klingt kompliziert.
Ist nicht so schlimm. Geht ja alles über den Maschgiach. Der machten den Daumen rauf oder runter. So gesehen ist das nicht so problematisch.
Und der hat irgendein Buch wo, das alles drin steht und jeder kann nachschlagen?
Weiß ich nicht. Und wenn, dann in Hebräisch. Scheint eine Geheimwissenschaft zu sein. Manchmal telefoniert er stundenlang mit dem Rabbiner wegen irgendwelcher gemahlenen Mandeln und der Rabbiner telefoniert den halben Tag mit Gott und der Welt und kommt schließlich damit heraus, dass wir die Mandeln benutzen dürfen. Hätt' ich ihm auch vorher sagen können. Ich meine, was soll an gemahlenen Mandeln schon falsch sein?
Wo kann ich den Maschgiach denn antreffen?
Kommen Sie morgen so ab sieben. Ich hoffe, dass wir dann wieder für die Schule kochen dürfen. Ab sieben sollte er da sein.
Und der spricht deutsch?
Wie kommen Sie denn auf die Idee? Der spricht hebräisch und irgendein Gemurmel, das manchmal wie deutsch klingt. Soll angeblich jiddisch sein. Ich hab keine Ahnung.
Und wie geschieht die Verständigung?
Ach, das klappt schon irgendwie. Daumen rauf oder Daumen runter ist ja auch nicht so schwer zu verstehen.
Yissachar Jaacov Bar Lev, der Maschgiach, stammt aus einer frommen jüdischen Familie, die seit dem achtzehnten Jahrhundert in Fürth ansässig war. Sein Urgroßvater Jakob Herz unterhielt ein kleines Hutgeschäft und fühlte sich schon1933 nicht mehr recht wohl in Deutschland. Daher war er bald nach der Machtergreifung Hitlers nach Palästina ausgewandert. Die Auswanderung ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina schien ihm verlockender als die sich eintrübenden Perspektiven in Deutschland. Noch in Deutschland hatte er sich einer religiös-zionistischen Bewegung angeschlossen und als er in der neuen Heimat Fuß gefasst hatte, änderte seinen Namen in Bar Lev. Zunächst versuchte er es in einem religiösen Kibbuz, später zog er nach Bne Brak, einer Stadt mit religiöser Ausprägung in der Nähe von Tel Aviv. Er hat zwei Söhne und vier Enkel, die verschiedenen Berufen nachgehen. In Bne Brak begann Bar Lev wieder mit einem Huthandel und sein Geschäft bescherte ihm einen gewissen, wenn auch bescheidenen Wohlstand. Das Hutgeschäft Bar Lev entwickelte sich zu einer etablierten Adresse unter seinen religiösen Kunden und befindet sich übrigens noch immer in der Rechov Rabbi Akiva in Bne Brak. Man findet es, wenn man zwischen der Bank Ha Poalim und dem Buchladen von Dov Leibowitz durch einen kleinen Gang geht. Der Laden mit dem winzigen Schaufenster liegt versteckt auf der rechten Seite, was in dieser Gegend jedoch keinen Standortnachteil darstellt. Inzwischen sind drei weitere Generationen Bar Levs herangewachsen, deren Söhne fast überwiegend im religiösen Umfeld blieben. Allerdings hatten sich bereits die Söhne des alten Jaacov bar Lev von der zionistischen Attitüde ihres Vaters entfernt und sich der Chassidut Charkov angenähert. Bar Levs Enkel und Urenkel gehörten alle dieser chassidischen Gruppe an und einige von ihnen hatten es in diesem religiösen Mikrokosmos zu Ansehen gebracht. Unnötig zu betonen, dass die männlichen Familienmitglieder mit wenigen Ausnahmen eine Smicha, also eine rabbinische Ordination erworben hatten. Einer der insgesamt sechsundzwanzig Urenkel von Jaacov Bar Lev hieß Yissachar Jaakov Bar Lev (Yissachar nach dem Vornamen des Charkover Rebben, Jaakov nach seinem Urgroßvater). Yissachar Jaacov Bar Lev war 1966 geboren, hatte eine religiöse Schule und später eine Jeschiwa besucht, war ausgebildeter Soifer und Mohel. Die Ehe mit seiner Frau Malka war, wenn man es glaubt, durch den Charkover Rebben persönlich gestiftet worden und mit vier Jungen gesegnet (baruch Haschem!), die alle eine der zahlreichen Jeschiwoth in Israel besuchten. Als Soifer und Mohel hatte Yissachar Jaacov einige Jahre in Israel, Süd-Afrika und Amerika gearbeitet, bis sich ihm die Gelegenheit bot, als Maschgiach in dieser Gemeinde in Deutschland anzufangen. Inzwischen hat sich sein Haupthaar gelichtet. Er hat eine Halbglatze, die ein besonders originelles Aussehen hat, weil er seine dünnen uns strähnigen Schläfenlocken hinter dem Kopf zu einem kleinen Knoten zusammengebunden trägt. Auch hat er einen sehr langen Bart, der eigentlich bis tief auf die Brust reicht. Die Barthaare hat er sich jedoch zu einem dünnen Zopf geflochten und diesen unter dem Kinn aufgerollt so dass der Eindruck entsteht, er habe einen gestutzten Vollbart. Das Gehalt ist sehr gut, vor allem, wenn man es mit dem israelischen Lohnniveau vergleicht und er kann einen großen Teil davon nach Hause schicken. Außerdem bewohnt er eine fast kostenlose kleine Gemeindewohnung, und sein Arbeitgeber zahlt ihm sogar viermal jährlich einen Flug nach Israel. So kann er einerseits seinen Lebensunterhalt bestreiten und andererseits ein halbwegs zumutbares Familienleben haben. In der Gemeindeküche genießt er seine unbestrittene Autorität und mit dem Rabbiner der Gemeinde hat er ein leidlich gutes Verhältnis.