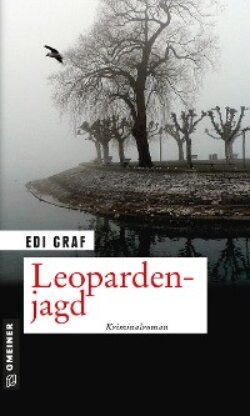Читать книгу Leopardenjagd - Edi Graf - Страница 12
4
ОглавлениеDer kühle Wind trieb die grauen Wolkentürme von Westen her über die Berge und ließ die glühende Hitze des Tages allmählich verglimmen. Die Leopardin lag, dicht an den breiten Ast geschmiegt, regungslos in der Krone der Akazie, gut getarnt durch das schützende Blattwerk, dessen spärliche Lücken die letzten Sonnenkringel auf den Rosetten ihres Fells tanzen ließen. Das hechelnde Maul geöffnet, blitzten die Reißzähne der Katze weiß zwischen den schwarzen Lefzen, nur ein seltenes Blinzeln der Augen und das leichte Zucken des Schwanzes verrieten Leben in der sonst regungslos Lauernden. Die Jägerin war mit all ihren Sinnen hellwach, die gelben Augen erfassten jedes Detail ihrer Umgebung, die großen, behaarten Ohrmuscheln fingen, einem Radar gleich, jedes noch so leise Geräusch ein, ihre Nase hatte die Witterung der Grasfresser aufgenommen, die ihr der Abendwind aus der weiten Savanne zutrug. Nicht ahnend, welche Gefahr sich im dichten Blattwerk der Akazienkrone verbarg, näherten sich die Antilopen arglos der kleinen Baumgruppe, um sich in ihrem Schutz zur Nachtruhe zu versammeln. Die Sonne verlor in diesen Minuten den Kampf gegen die Wolken über dem Höhenzug, ein Zittern ging durch den Körper der Leopardin. Die Zeit der Jagd war gekommen.
Die Jungen in ihrem Bauch rumorten, und sie spürte, dass es ihre letzte Jagd sein würde, ehe die Kleinen zur Welt kamen. Der Hunger nagte in ihr, das letzte Opfer war nur ein Frankolin gewesen, mehr Federn und Knochen als Fleisch, ihre große Beute, ein Grantgazellenbock, war ihr nach zähem Kampf von einem Löwenrudel abspenstig gemacht worden, noch ehe sie ihr Baumversteck erreicht hatte.
Langsam löste sich der Schatten aus der Baumsilhouette und glitt geräuschlos zu Boden. Die Schwarzfersenantilopen hatten sich wieder in Bewegung gesetzt, nachdem der Bock witternd stehen geblieben war, um mit einem Flehmen seiner Oberlippe all die Gerüche aufzunehmen, die der dichte Busch um das Rudel herum barg. Doch außer den Pavianen, die unter einem Feigenbaum nach Früchten suchten, nahm er keine Lebewesen wahr. Der Westwind kam günstig für die gefleckte Jägerin, Meter um Meter schlich sie näher, verharrte schließlich geduckt im Gras, lauernd, jede Muskelfaser angespannt, die Schulterblätter als höchste Erhebung des geschmeidigen Körpers, den Kopf nach vorn gestreckt, bereit zum tödlichen Sprung auf jenes Impala, das am Rand der kleinen Herde stand und durch ein leichtes Hinken eines Vorderlaufs ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Ihre gelben Augen fixierten ihr Opfer, keine andere Bewegung im Busch vermochte sie jetzt noch davon abzulenken.
Ein gellendes Aufkreischen machte alles zunichte. Der Warnruf aus der Pavianhorde ließ das Impalarudel in wilder Panik davonstieben, selbst das verletzte Böckchen schaffte es, mit den anderen Schritt zu halten. Die Leopardin fuhr herum und sah sich einem ausgewachsenen Pavianmännchen gegenüber, einem der wenigen Tiere außer Löwen und Hyänen, vor denen sie sich in Acht nehmen musste. Zumindest war der Pavian tagsüber als Gegner nicht zu unterschätzen, mit seinen dolchartigen Eckzähnen konnte er der Leopardin gefährliche Bisswunden beibringen, sie waren eindrucksvolle Waffen, und die Katze wusste, dass mit einem erregten Pavian nicht zu spaßen war. Aufgerichtet stand der Patriarch auf seinen Hinterbeinen, ließ sich geifernd nach vorn fallen und drang auf den Leoparden ein. Mit einer Kakofonie durchdringender Schreie liefen die anderen Paviane in alle Richtungen auseinander, Mütter retteten sich mit ihren Kindern auf die nahen Akazien, die älteren Männchen blieben aufmerksam zurück, um ihrem Patriarchen zur Hilfe zu eilen, falls er es nicht allein mit dem gefleckten Feind aufnehmen konnte. Doch die Leopardin hatte wenig Lust, sich dem Pavian zu stellen, dessen Kreischen inzwischen in ein grelles Bellen übergegangen war. Die hundeähnliche Schnauze gekräuselt, fixierte der wehrhafte Affe seinen Todfeind mit seinen eng stehenden gelben Augen, aus denen Wut und Angst zugleich sprachen. Wieder raste er, einem Mini-Kingkong gleich, Sand aufwirbelnd auf den gefleckten Jäger zu, den Kopf unmutig schüttelnd und Laute von sich gebend, die der Leopardin unmissverständlich klarmachten, dass sie hier nicht willkommen war.
Die Katze drehte ab und verschwand im dichten Buschwerk. Die Jagd auf die Impalas konnte sie ohnehin vergessen, und ein Kampf mit einem Pavian, dem seine Herde Rückhalt und zur Not Beistand gewährte, war ihr mit den Jungen im Bauch zu riskant. Schon einmal hatte sie in einem solchen Fall den Kürzeren gezogen und Bekanntschaft mit den Reißwaffen eines Pavians gemacht. Die klaffende Wunde zog sich heute noch als schwarze Narbe durch die Rosetten ihres linken Hinterlaufs.
Die Leopardin suchte ihren Schlafbaum auf, eine knorrige Akazie mit dichter Krone, von einer Würgefeige fast erdrückt, in der sie nicht zu sehen war, wenn sie dort oben lag und die versteckte Beute verzehrte. Schon seit Tagen hatte sie keine Antilope, keinen Hasen mehr in die Astgabel gezerrt, um sie in aller Ruhe auszuweiden und zu verspeisen, ungestört von Löwen oder Hyänen, die ihr nicht in ihre luftige Vorratskammer folgen konnten.
Ein seltsamer Geruch hielt sie davon ab, in gewohntem Schwung die Akazie zu erklettern und sich auf dem breiten Hauptast zur verdienten Siesta niederzulassen. Sie roch das Blut, roch, dass es noch frisch war, und sie witterte das fremde Fleisch, anderes Fleisch als jenes, das sie sonst in der Krone lagerte, weder Antilope noch Gazelle, kein Klippschliefer, kein Warzenschwein. Misstrauisch schlich sie näher. Ein Affe vielleicht? Welches Tier im Busch versprühte diese Ausdünstung?
Sollte ein anderer Leopard ihren Baum als Jagdversteck genutzt haben? Oder war ein fremdes Tier in die Astgabel geklettert und dort verendet? Doch woher kam dann dieser Blutgeruch? Warm und frisch, sie fühlte es, ihre feine Nase hatte die Witterung aufgenommen.
Ihre Augen starrten zum Wipfel des schirmartigen Baums, das Blätterdach ließ kaum Licht durch, und sie harrte auf eine Bewegung. Sollte er sich doch zeigen, der Feind, sie würde ihn schon ordentlich begrüßen, doch nichts geschah. Kein Geräusch, kein knackender Ast, kein Rascheln im Laub, nur dieser fremde Geruch nach warmem Blut und frisch geschlagenem Fleisch. Ihre Krallen zerrissen die Rinde der Akazie, laut war das Schaben zu hören, doch nichts rührte sich dort oben. Jetzt hielt sie die Neugier nicht mehr länger zurück. Mit einem gewaltigen Satz war sie oben, lauschte auf dem untersten, waagerecht ausladenden Ast, ob sich nicht doch etwas rührte in den oberen Stockwerken. Doch es blieb ruhig. Mit Hilfe ihrer Tasthaare umkreiste sie den von der Würgefeige umschlungenen Stamm und schraubte ihren schweren Körper langsam nach oben. Dann sah sie ihn.
Der Kadaver hing wie ein aufgeblasener Sack in der Astgabel. Die Jägerin verharrte argwöhnisch und erst als sich auch nach Minuten nichts an dem gekrümmten Körper rührte, als sich ihre Nase an den Geruch gewöhnt hatte, wagte sie sich näher heran. Ihre Schnurrhaare ertasteten zwei Beine, zwei Arme und die verkrampften Finger der Leiche, und der Blutgeruch in ihrer Nase vermischte sich mit jenen Düften, die sie den seltsamen Wesen zuordnete, die immer wieder mit ihren stinkenden und lärmenden Ungetümen in ihr Revier eindrangen. Instinktiv hatte sie gelernt, dass Menschen etwas Fremdes, aber nichts Bedrohliches waren. Sie kannte die Geräusche, die sie von sich gaben, wusste, dass viele andere Tiere vor ihnen flohen, obwohl keine Gefahr von ihnen auszugehen schien. Noch nie war sie auf die Idee gekommen, einen von ihnen anzugreifen oder gar zu reißen. Ihre Beute roch anders, bewegte sich anders, sah anders aus.
Doch jetzt, tot und regungslos auf dem Ast liegend, duftete das Blut plötzlich ähnlich verlockend wie das eines Pavians. Das Feindbild flackerte vor ihrem inneren Auge auf, die Paviane, die ihr gerade die Impalas abspenstig gemacht hatten, kamen ihr in den Sinn, und sie gab unfreiwillig ein grimmiges Knurren von sich. Ohne diese verfluchten Affen würde sie jetzt mit einem frisch geschlagenen Impala in der Baumkrone sitzen und sich nicht um diesen Menschenkadaver kümmern müssen.
Der Hunger begann erneut in ihr zu nagen, die Jungen in ihr zehrten an ihren Kräften. Wenn das Blut nun doch angenehm roch, warum sollte dann das Fleisch nicht genießbar sein? Es kam auf einen Versuch an. Noch einmal sah sie sich vorsichtig um, witterte nach allen Richtungen. Sie konnte keine Falle entdecken, keinen Feind, der sich im Schutz des dichten Blätterdachs versteckte. Ihre Zunge fuhr heraus und leckte dem Toten über das Gesicht. Sie schmeckte das Blut, das aus dem Schnitt in der Kehle über seine Backenknochen rann. Das Fleisch roch frisch und ihre Zähne begannen, die Nackenwirbel freizulegen. Noch verriet ihre Haltung Anspannung und ihr Blick drückte Argwohn aus, doch je mehr ihr Gaumen mit dem Geschmack der fremden Beute vertraut wurde, desto freier wurden ihre Bewegungen. Schließlich ließ sie sich entspannt neben dem Kadaver nieder, riss mit ihren dolchartigen Eckzähnen das khakifarbene Hemd in Fetzen und begann zu fressen.