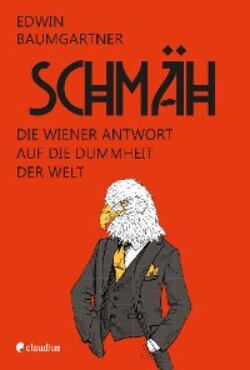Читать книгу Schmäh - Edwin Baumgartner - Страница 8
ОглавлениеWAS DER SCHMÄH IST
Das muss ich Ihnen jetzt erzählen:
Jetzt wollen Sie von mir wissen, was der Schmäh ist? So quasi als Definition? Ich sag’ Ihnen gleich: Das ist aussichtslos. Das kann ich Ihnen nicht in fünf Worten sagen, und in einem schon gar nicht. Das kann ich Ihnen nur erzählen. Erzählen ist sowieso der halbe Schmäh. Um einen ganzen daraus zu machen, braucht es nichts als Schmäh. Warten Sie einen Moment (nua net hudln), Sie werden gleich verstehen, was ich meine. Die Sache ist die: Es gibt keine Definition für Schmäh, zumindest keine zutreffende, keine, die sozusagen allschmähumfassend wäre, die alles beinhaltet, was der Wiener unter Schmäh versteht. Die meisten, die sich an einer Definition versuchen, gehen über den Umweg zu erklären, was der Schmäh nicht ist. Da liest man dann in der Regel, der Schmäh sei kein Witz.
Jo, eh.
Weil der Schmäh ab und zu schon ein Witz auch sein kann. Aber eben nur „auch“ und eigentlich fast nie. Dem Witz geht es um die Pointe, dem Schmäh ums G’schichterl. Nicht um eine Geschichte, eine Geschichte ist für den Schmäh viel zu groß und viel zu schwer. Und weil der Schmäh die Leichtigkeit des G’schichterls betont, schert er sich nicht drum, ob da jetzt jedes Wort wahr ist, das G’schichterl verweht ja sowieso, Hauptsach’, es macht grad im Moment des Erzählens allen eine Freud’, den Zuhörern genauso wie dem Erzähler selbst.
Drum, glaube ich, haut sogar der Wehle daneben, wenn er den Schmäh definieren will.
Wer der Wehle ist? Das gehört zum Schmäh dazu – der Wehle sowieso, aber auch der bestimmte Artikel minus Vorname plus Nachname. Ich muss da jetzt auf das Kapitel mit der Titelvergabe bei der Anrede vorgreifen, dafür wird das dann ein bisserl kürzer. „Bisserl“ heißt übrigens „ein wenig“. – Aber Vorsicht, wenn Sie bei einem Fleischhauer zehn Deka6 Wurst verlangen. Wenn die Bedienung Sie dann nämlich fragt: „Deaf s a bisserl mea sein?“, und sie sagen „ja“, verlassen Sie womöglich mit der doppelten Menge Wurst den Laden.
„Deaf s a bisserl mea sein?“ ist somit ein typischer Fall von Schmäh, und das führt uns zurück zu dem Wehle, dessen Artikel ich aber zuerst noch erklären muss. Seit 1918 sind in Österreich die Adelstitel abgeschafft. Man wollte mit der Habsburger-Monarchie nichts mehr zu tun haben. Zumindest offiziell nicht. Inoffiziell gesteht man vor allem in Kaffeehäusern bisweilen Leuten Adelsprädikate zu, die sie nicht einmal in der Habsburger-Monarchie hatten. Dazu kommen wir noch. Dass ein Krieg, den das Haus Habsburg führt, verloren geht, das hätte man eigentlich gewohnt sein müssen. Aber das war nun doch etwas zuviel an verlorenem Krieg.
An die Stelle der durch und durch adeligen Adelsprädikate trat das Volksadelsprädikat. Um ehrlich zu sein: Es gab es auch schon zu monarchischen Zeiten. Das Volksadelsprädikat verleiht keiner offiziell. Einer fängt damit an, dann geht es von Mund zu Mund. Und gibt es jetzt kein „von“ mehr, so gibt es eine „die“ und einen „der“. Quasi Artikel statt Titel. Ist eine Österreicherin oder ein Österreicher also durch besondere Taten hervorgetreten, dann adelt ihn der Wiener in der Umgangssprache mit dem bestimmten Artikel. Aus der Schauspielerin Paula Wessely wurde „die Wessely“ und aus dem auch heute noch legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde „der Kreisky“.
Das ist freilich auch eine Sache der Intonation. Auf dem Artikel muss, wenn er das Volksadelsprädikat ist, ein bisserl ein hochdeutscher Nachdruck liegen. Einen Namen mit dem geschlechtsspezifischen direkten Artikel zu versehen, pflegen nämlich alle österreichischen Dialekte. Da sagt man dann: „Gestan how i mi mi n Ferdl troffen“; wobei das „n“ die umgangssprachliche Verschleifung des „dem“ ist, das isolierte „n“ müsste eigentlich ein „m“ sein. Offenbar fällt das „n“ der Zunge leichter als sein alphabetischer Nachbarslaut. Der besagte Ferdl braucht in diesem Zusammenhang keineswegs eine herausragende Stellung in der österreichischen Gesellschaft einzunehmen.
Sagt man aber: „Gestern how i mi mit der Tobisch getroffen“, wäre das schon ein anderes Kaliber. Ein Treffen mit Lotte Tobisch, Schauspielerin, ehemalige Organisatorin des Wiener Opernballs und vielleicht letzte große Salondame Wiens, würde in der Sprache sofort abfärben: Im Umfeld von „der Tobisch“ herrscht Hochdeutsch. Niemand würde beim Schmähführen sagen: „Gestan how i mi mit da Tobisch troffen.“ Und wenn es einer doch so sagt, dann können Sie sicher sein, dass er schmähführt und die Tobisch vielleicht von Ferne gesehen hat, denn wenn er so spricht, dann gehört er gewiss nicht zu den Menschen, mit denen sich die Tobisch trifft.
Eigentlich wollte ich aber zu dem Wehle etwas sagen. Peter Wehle, nicht zu verwechseln mit seinem 1967 geborenen Sohn gleichen Namens, der sich als Krimi-Autor einen Namen macht, vorerst aber noch kein „der Wehle“ ist, der Wehle also, der Vater, war einer der brillantesten Kabarettisten Österreichs. Zu vielen seiner Texte komponierte er selbst die Musik, und einige erheben den Anspruch, Literatur zu sein. In einer Sammlung heiterer Lyrik würden sich seine grotesken bis absurden Verse so übel nicht ausnehmen. Zum Beispiel dieses Lied über die Schwierigkeiten eines Schüchternen in Liebesdingen, in dem es heißt: „Doch werf ich den Blick auf ein Mädchen / Und denk mir: ,Vielleicht wird die schwach!‘ / Dann wirft meinen Blick / Sie nur achtlos zurück / Und sehr oft was Kompaktes noch nach.“
Wehle brachte 1981 „Sprechen Sie Wienerisch?“, sein Lexikon des Wienerischen, in der überarbeiteten und definitiven Version heraus. In diesem Buch findet sich natürlich auch der Schmäh, und den definiert Wehle, obwohl er der Wehle ist, meiner Meinung nach falsch: „Schmäh: Gag, Pointe, Aufschneiderei, Unterhaltung.“
„Gag, Pointe“ – das würde auch zum Witz passen. Aber, wir erinnern uns, der Schmäh ist kein Witz. Eher besitzt der Schmäh Witz, nämlich den Witz im Sinn von „gewitzt“, und ich bin versucht, am Wort „bauernschlau“ entlang, das sich bei Wienern verbietet, bei denen Bauer höchstens noch ein Name ist, aber keine Berufsbezeichnung mehr (es sei denn, es ist der Weinbauer, wie wir sehen werden), das Wort „städterschlau“ zu konstruieren. Dann könnte man Schmäh und Witz, besser Schmäh und Gewitztheit, einander annähern. Annähern, sage ich; und nicht, dann wäre das Eine dem Anderen gleich.
Gerade fällt mir meine erste Begegnung mit dem Schmäh ein, zumindest die erste, an die ich mich erinnern kann. Bevor ich in die Volksschule kam, kümmerten sich tagsüber meine Großeltern um mich. Zu jener Zeit, ich rede von der ersten Hälfte der 1960er-Jahre, gab es bestimmte Statussymbole. Kindergärten zum Beispiel waren etwas für die ärmeren Leut’, für Familien, die es sich nicht leisten konnten, dass die Frau zu Hause blieb. Meine Eltern hätten es sich zwar finanziell mühelos leisten können. Meine Mutter jedoch arbeitete gern. Sie hatte gleich nach dem Krieg Landwirtschaft studiert, zu einer Zeit, als solch ein Studium für Frauen als völlig verrückt galt. Dementsprechend war sie die erste Frau Diplom-Ingenieur Österreichs in dieser Sparte. Sie dachte nicht daran, sich auf „Hausfrau und Mutter“ zu beschränken. Obendrein waren meine Großeltern selig, den Buben mit aller Zuwendung versorgen zu können, derer eine Großmutter und ein Großvater fähig sind, und das ist eine Menge, das können Sie mir glauben. So war alles gemäß der damaligen gesellschaftlichen Zeichensetzung in bester Ordnung.
Meine Großmutter liebte es, auf den nahen Brigittamarkt einkaufen zu gehen. Das bedeutete natürlich auch einen Austausch der Neuigkeiten aus dem Grätzl. Auf dem Brigittamarkt gab es eine Fleischhauerin namens Barischitz, ihr Vorname war, glaube ich, Helga, ganz sicher bin ich mir dessen nicht, wie gesagt: Ich war vier, fünf Jahre alt. Was ich indessen ganz sicher weiß, ist, dass bei Frau Barischitz Name, Beruf und Aussehen auf wunderbare Art übereinstimmten, zumindest in meiner Vorstellungswelt. Aber vielleicht ist die ja auch geprägt von der realen Frau Barischitz. Wer kann das wissen? Frau Barischitz war mittelgroß, lachende Augen hinter der dünnrandigen Brille, die Haarfarbe habe ich nie gesehen, denn Frau Barischitz trug stets ein weißes Häubchen, und um den rundlichen Leib gebunden hatte sie eine weiße Schürze. Dem eigentlichen Schmäh vorausschicken muss ich außerdem, dass in jenen Tagen viele Haushalte noch mit Holz, Koks oder Kohle im Ofen heizten.
Jetzt kommt meine erste Begegnung mit dem Schmäh. Es war ein später Wintereinbruch, wohl im März oder gar im April, jedenfalls lag Schnee, daran erinnere ich mich noch genau, weil mir meine Großmutter nach dem Marktbesuch erlaubte, vor der Brigittakirche ein paar Schneebälle zu werfen – vor der Kirche, sage ich, nicht auf die Kirche, wiewohl ich ungezogener Fratz das eine für das andere nahm, ohne mir Mamas Groll zuzuziehen. Ja, wirklich, bei uns war die Großmutter „Mama“, und meine Mutter war „Mutti“.
Doch zurück zu meiner Großmutter und der Frau Barischitz. Die beiden kamen auf winterliche Kälte zu sprechen. Jede überbot (oder sagt man da „unterbot“?) die Minusgrade der anderen. Roald Amundsen, der Entdecker des Südpols, hätte nicht mithalten können. Zuletzt triumphierte die Frau Barischitz: „Vor drei Jahren …“ Nein, das muss ich im Dialekt wiedergeben.
Frau Barischitz also sagte: „Vua drei Joa, do woa s en Winta so koed, dass ma des Feia in Ofn eigfruan is.“ Worauf meine Großmutter fragte: „Schmähohne?“ Und Frau Barischitz erwiderte: „Schmähohne“. Dazu nickte sie bekräftigend mit dem Kopf.
Das war Schmäh mit Schmäh. Natürlich wusste Frau Barischitz ganz genau, dass meine Großmutter niemals glauben würde, das Feuer im Ofen sei eingefroren. Umgekehrt wusste meine Großmutter, dass Frau Barischitz niemals einen Anspruch auf die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte erheben würde. Die Frage meiner Großmutter „schmähohne?“ war lediglich eine Verlängerung des Schmähs, und die Antwort „schmähohne“ war dann, gerade wegen der Behauptung, es sei kein Schmäh, der abschließende Schmäh. Beide Frauen hatten sich auf den Schmäh eingelassen.
Wir lernen daraus nebenbei, dass „schmähohne“ nur theoretisch bedeutet, die Geschichte sei wahr. Ich meine, das kann „schmähohne“ auch bedeuten, aber eben nur auch. Ebenso gut kann „schmähohne“ die Bestätigung für den Schmäh sein.
Wie man da durchblickt? Im Zweifelsfall ist es Schmäh, was nach Schmäh klingt.
Meine Großmutter hatte danach Mühe, mir zu erklären, dass weder Flammen einfrieren können, noch dass Frau Barischitz gelogen hat. Weil halt der Schmäh nicht wirklich ein Lügeng’schichterl ist, das ist er so wenig, wie er ein Witz ist. Wobei er schon beides sein kann, ein bisserl wenigstens, aber die Lüge ist nicht das tiefere Wesen des Schmähs, und der Scherz ist es auch nicht.
Fallweise kann er freilich das eine wie das andere sein. Dementsprechend definiert Peter Ahorner in seinem „Wiener Wörterbuch“ den Schmäh mit „Witz“, aber ebenso mit „Aufschneiderei, Unwahrheit“. Auch Wehle, also der Wehle, führt übrigens „Aufschneiderei“ als Unterbedeutung an.
Und nun? Was ist jetzt der Schmäh? Gag und Pointe lasse ich weg, dieser Definition traue ich nicht, obwohl sie von dem Wehle kommt. Eine leichte, amüsante Erzählweise gehört zum Schmäh dazu, aber der Schmäh legt es nicht auf die Pointe an. Er sitzt nicht da im Café mit grellbuntem Gewand, damit jeder weiß: Gleich gibt’s was zu lachen. Der Schmäh kommt unauffällig. Er kommt leise. Der Schmäh kann eine mit Charme erzählte ganz und gar wahre Geschichte sein und eine faustdicke Lügengeschichte – die aber, bitte, auch mit Charme erzählt. Ohne Charme kein Schmäh, der Charme ist eine Grundbedingung. Was Charme ist? – Keine Definitionen verlangen: Charme ist, was man als Charme empfindet. Beim Schmäh ist es ähnlich.
Ein bisserl näher möchte ich ihm dennoch kommen, dem Schmäh. Er ist eine mit Charme erzählte Geschichte wahren oder erfundenen oder übertriebenen Inhalts, eine Plauderei, ein treffender Ausspruch. Der Schmäh entsteht aus der Situation. „Beim Reden kummen d’ Leit zsamm“, sagt man in Wien, und beim Reden rennt auch der Schmäh. Wenn der Schmäh rennt, dann bedeutet das eine angeregte Unterhaltung.
Vielleicht kann ich das am besten exemplifizieren, wenn ich einen Witz in einen Schmäh übersetze. Das geht nicht mit jedem Witz. Ich fange mit einem der unübersetzbaren an, und da es beim Witzeerzählen weit Berufenere gibt als mich, klaue ich ihn Wort für Wort aus Hellmuth Karaseks Buch „Soll das ein Witz sein?“ Nun denn: „Im Schauspielhaus: Ein Zuschauer sagt zu seinem Nachbarn: ,Heute ist die Akustik nicht gut.‘ Der andere, nach einer Weile: ,Jetzt höre ich’s auch!‘“ Diesen Witz kann zumindest ich nicht in einen Schmäh übersetzen, ohne ihn völlig zu ruinieren.
Der nächste Versuch macht mit dem Grafen Bobby bekannt. Die Figur ist älter, als man denkt. Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist sie aufgetaucht. Sie sagt viel darüber aus, wie die Österreicher über den Habsburgerstaat-Adel dachten. Man hielt seine Angehörigen offenbar nicht gerade für Geistesriesen. Leicht vertrottelt und schwer dekadent (oder andersherum), das trifft es eher. In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre waren die Graf-Bobby-Witze plötzlich wieder da. Als dann 1961 der erste Graf-Bobby-Film mit dem österreichischen Schlagerstar, Schauspieler und vor allem Publikumsliebling Peter Alexander in die Kinos kam, erlebten sie eine wahre Blüte. Wer sich „Die Abenteuer des Grafen Bobby“ in der Regie Géza von Cziffras heute anschaut, kann sich gar nicht vorstellen, dass ursprünglich Heinz Rühmann für die Titelrolle vorgesehen war. 1967 brachte Bensdorp sogar den Graf-Bobby-Schokoriegel auf dem Markt. Auf dem Pappschuber war stets ein Graf-Bobby-Witz abgedruckt. Das nur nebenbei. (Schmäh bedeutet schließlich auch Plaudern, ohne das Thema ganz genau im Auge zu behalten.)
Hier nun der Graf-Bobby-Witz, den ich versuchen werde, in einen Schmäh zu übersetzen. Zuerst aber in der Gestalt des Witzes: Graf Bobby sitzt in seiner Küche, vor ihm türmt sich ein riesiger Berg in Scheiben geschnittener Semmeln. Kommt Graf Bobbys Freund, Baron Mucki, herein, sieht den Haufen Semmelschnitten und fragt: „Ja, Bobby, was machst du denn da?“ Antwortet Graf Bobby: „Weißt, mein lieber Mucki, ich wollt’ mir einen Scheiterhaufen machen, und im Kochbuch steht: Man schneide drei Tage alte Semmeln in Scheiben. No, zwei Tage schneid’ ich schon.“
Jetzt das Ganze als Schmäh – da brauche ich eine zweite Person und eine Situation. Nicht unbedingt, aber der Schmäh hat dann mehr Schmäh. Wir sind noch immer im Café, haben zwischen den zurückschwingenden Schwingtüren einen Weg gefunden, wie weiland Odysseus zwischen Scylla und Charybdis hindurchgesteuert hat (was zweifellos etwas einfacher war), haben den Herrn Witz ignoriert, den Ober gefragt, wo Herr Schmäh sitzt, worauf der Ober geantwortet hat, der Herr Kommerzialrat (zu den Titeln komme ich noch, versprochen, alles auf einmal geht wirklich nicht, und schon gar nicht beim Schmäh) würde am Tisch beim Fenster rechts neben dem Klavier sitzen, wir haben uns dorthin begeben, uns dem Herrn Kommerzialrat Schmäh vorgestellt und ihn gefragt, ob wir uns einen Moment zu ihm setzen können. „Bitt’schön, Herr Doktor“, hat der Herr Kommerzialrat Schmäh geantwortet. Der Ober tritt herzu, wir bestellen uns einen kleinen Braunen, wie der Mokka mit Kaffeeobers hier heißt, und einen Scheiterhaufen. Der Herr Kommerzialrat Schmäh zieht die Augenbrauen hoch. „Scheiterhaufen?“, fragt er. Wir sind einen Moment irritiert: „Wieso? Ist der hier nicht empfehlenswert?“ „Doch, doch“, sagt der Herr Kommerzialrat Schmäh, „aber wenn ich ,Scheiterhaufen‘ hör’, denke ich gleich an meinen Freund, den Bobby. Grafen gibt’s bei uns ja keine mehr in Österreich, seit dem Achtzehnerjahr, aber vor dem Achtzehnerjahr war der Bobby ein Graf, wenn Sie verstehen. Dem ist da etwas passiert, das glauben Sie nicht.“ „Erzählen Sie, bitte“, antworten wir. Der Herr Kommerzialrat Schmäh nimmt einen Schluck Kaffee aus seiner Tasse, winkt dem Ober, „noch einen Franziskaner, bitte“, sagt er, was soviel bedeutet wie einen verlängerten Mokka mit Schlagobers. „Wo waren wir? Ah, ja“, sagt der Herr Kommerzialrat Schmäh, „bei meinem Freund, dem Grafen Bobby. No, Sie wissen ja, dass Kochbücher mitunter zweideutige Formulierungen enthalten. Ich lese ja keine Kochbücher, aber ich habe mir das sagen lassen. Also, mein Freund Bobby, der hat im Casino in Baden ein bisserl was verspielt. Sie wissen ja: Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Der Bobby muss daher sein Personal ein bisserl reduzieren. Glück in der Liebe hat der Bobby grad gefunden. Denkt er sich, er kann die Köchin entlassen, so gut ist sie sowieso nicht, und seine neue Angebetete wird schon wissen, was in der Küche zu tun ist, und wenn sie nur Anweisungen gibt. Aber grad da hat er sich getäuscht, der Bobby, denn sie hat vom Kochen so viel Ahnung wie eine Katze von der Landwirtschaft. Was weiß ich nicht, wieso mir gerade dieser Vergleich einfällt. Also, der Bobby kriegt einen Appetit auf Scheiterhaufen. Denkt er sich, das kann doch nicht so schwer sein, das werd’ ich selber zusammenbringen. Er geht in die Küche, sucht das Kochbuch heraus, schaut im Stichwortverzeichnis nach – da steht er, der Scheiterhaufen. Der Bobby schlägt das Rezept auf und liest: ,Schneiden Sie drei Tage alte Semmeln in Scheiben.‘ Denkt sich der Bobby: ,Das schaff’ ich.‘ Und wissen Sie, was der Bobby gemacht hat? Zum Bäcker ist er gegangen und hat Unmengen Semmeln gekauft. Am nächsten Tag ist er um acht Uhr früh in die Küche und hat zu schneiden begonnen. Den ganzen Tag hat er Semmeln geschnitten, und am nächsten Tag auch bis knapp nach Mittag, da bin ich ihn besuchen gekommen. Weil ich ihn nicht im Café Central getroffen hab’ wie sonst am Mittwoch, hab’ ich mir gedacht, ich schau lieber einmal nach. Und da find’ ich den Bobby in einem Berg von Semmelscheiben. Ich frag’ ihn: ,Ja, was machst Du denn da?‘ Sagt er: ,Ich will mir einen Scheiterhaufen machen, und im Rezept steht, man muss drei Tage alte Semmeln schneiden.‘ Verstehen Sie? Er hat geglaubt, er muss drei Tage lang alte Semmeln schneiden. Jetzt will er vom Scheiterhaufen nichts mehr wissen, der Bobby, dabei war es vorher sein Leibgericht. Ah, da kommt ja schon Ihr Scheiterhaufen. Schaut sehr schön aus. Guten Appetit.“
Der Unterschied ist, meine ich, deutlich: Der Witz ist kurz und knapp. Er steuert geradewegs auf die Pointe zu. Dem Witz ist es völlig gleichgültig, wieso ein Graf in höchsteigener Person in der Küche Semmeln schneidet, statt einfach der Köchin zu sagen: „Resi, ich hätt gern einen Scheiterhaufen.“ Der Witz fackelt nicht lange: Ausgangssituation (Graf Bobby vor einem Berg Semmelscheiben) – Entwicklung (Baron Mucki fragt, was das soll) – Pointe (das Missverständnis).
Dem Schmäh hingegen ist an der Pointe viel weniger gelegen. Dafür ist das Drumherum anschaulicher: Wieso will der Graf Bobby ausgerechnet einen Scheiterhaufen kochen? (Er ist – oder vielmehr: war – sein Leibgericht.) Wieso kommt der Graf Bobby in die missliche Lage, selbst den Scheiterhaufen zubereiten zu müssen? (Weil er die Köchin entlassen hat.) Wo hat der Graf Bobby die Semmeln her? (In Unmengen beim Bäcker gekauft.) Und so weiter. Der Schmäh ist eine kleine Erzählung, ein G’schichterl.
Zumindest ist er es in diesem Fall.
Aber ich will reinen Wein einschenken – soweit das beim Schmäh überhaupt möglich ist. In den verschiedenen Redewendungen besitzt das Wort Schmäh nämlich unterschiedliche Bedeutungen und Nuancen.
Schmäh für sich genommen, das wäre in etwa das Graf-Bobby-G’schichterl. Dessen Perfektionierung wäre, würde unsereiner nach der Aufklärung des Missverständnisses ein „Schmähohne?“ einstreuen, worauf der Erzähler fortsetzen würde mit „Schmähohne“. Doch in den Redewendungen kann Schmäh andere Bedeutungen annehmen: „A aufglegta Schmäh“ bedeutet etwa eine leicht durchschaubare Flunkerei oder Lüge, „wen mi’n Schmäh packn“ heißt, jemanden durch Charme für sich einzunehmen versuchen, und wenn man „mi’n Schmäh hausian geht“, dann tut man, was ich gerade gemacht habe: Man schmückt sich mit fremden Federn, denn ich habe die Definitionen aus Wolfgang Teuschls „Wiener Dialektlexikon“ genommen.
Gerade fällt mir etwas auf: Könnte Schmäh in allen Zusammensetzungen und Redewendungen möglicherweise eine Distanz zwischen der Wahrheit und der Realität des Schmähs bedeuten?
Neulich habe ich mich beim Schmähführen ertappt. Ich habe in meinem Stamm-Modehaus ein Sakko für mich gekauft, weil in mein noch gar nicht altes die Motten hineingekommen sind. Mistviecher! Die Verkäuferin, die mich seit gut fünf Jahren kennt, war ein bisserl erstaunt, dass ich schon wieder ein Sakko kaufe. Gesagt hat sie natürlich nichts, aber ihrem Blick habe ich es angesehen. Also sage ich: „Schauen Sie7, das Sakko, das ich letztes Mal bei Ihnen gekauft hab’ – das haben die Motten aufgefressen. Ich mach den Kleiderkasten auf und hab’ das Malheur gesehen. Was soll ich Ihnen sagen? – Eines von den Biestern ist da gesessen, hat noch auf einem Fetzerl von dem Sakko herumgekaut und mich frech angegrinst.“ Haben Sie je eine Motte grinsen gesehen oder auf einem Stückchen Stoff herumkauen? Das war natürlich der reine Schmäh. Wenn er rennen soll, der Schmäh, dann bedarf es des gegenseitigen Einverständnisses zwischen Schmähführer und Zuhörer. Das kommt stillschweigend zustande. Keiner sagt: „Jetzt tuan ma a wengal schmähführen.“ Man spürt: Jetzt ist der richtige Moment für einen Schmäh. Wie man den erwischt, den richtigen Moment? Was soll ich Ihnen sagen? – Den richtigen Moment zu sagen, „ich liebe dich“, kann man ja auch nur spüren und nicht planen.
Aber machen wir uns nichts vor: Außerhalb von Wien, bei den Fremden quasi, steht der Schmäh in schlechtem Ruf. Er gilt als Zeichen einer spezifisch wienerischen Form der Unehrlichkeit. Diesen üblen Leumund verdient der Schmäh nicht. Doch ein bisserl was könnt’ schon dran sein. Man braucht ja den Schmäh nicht gleich mit der faustdicken Lüge gleichzusetzen. Mit der Lüge ist immer etwas Bösartiges verbunden, zumindest ein Vorteil, den man für sich selbst herausholen will.
Der Schmäh hingegen: Sie erinnern sich an die Frau Barischitz mit der Geschichte vom eingefrorenen Feuer? – Wahr an ihr ist nur, dass die Frau Barischitz an einem Wintertag ein Feuer in ihrem Ofen gemacht hat, aber es war wohl dermaßen kalt, dass sie die Wohnung selbst damit nicht ausreichend aufwärmen konnte. Die Geschichte in der Schmäh-Variante nützt niemandem und schadet keinem. Sie bebildert die extreme Kälte. Zwischen der Wahrheit und dem Schmäh klafft aber ein Spalt.
Auch bei der Graf-Bobby-Geschichte ist diese, sagen wir: verschobene Wahrheit vorhanden. Natürlich, weil der Witz, der als Ausgangspunkt diente, eine absurde Situation darlegte. Aber in der Schmäh-Variante wird es nicht logischer: Wieviel Geld muss der Graf Bobby in einer einzigen Nacht im Badener Casino verspielt haben, wenn er danach sogar Dienstboten entlassen muss? Wieso entlässt er gerade die Köchin, wenn er weiß, dass er selbst gerade davon keine Ahnung hat? Wie hat der Graf Bobby die Unmengen an Semmeln nach Hause gebracht? Fragen über Fragen.
Natürlich braucht der Schmäh keine Logik, es bedarf keiner in sich stimmenden Geschichte. Aber diese fehlende innere Logik verursacht dann eben diese Trennung zwischen Schmäh und Wahrheit oder zwischen Schmäh und Wirklichkeit.
Und wenn der Schmäh ganz einfach eine ganz und gar wahre Geschichte ist, die der Erzähler nur durch seine Darstellung über Gebühr aufwertet? Auch das kann Schmäh bedeuten. Ich will es so versuchen: In diesem Fall macht der Erzähler aus einer Mücke einen Elefanten. Da aber Mücken keine Elefanten sind, diese Mücke aber für einen Elefanten ausgegeben wird, besteht in solch einer Maskierung die Abkehr von der Realität. Die US-amerikanische Dichterin Gertrude Stein hat zwar in Wahrheit geschrieben „Rose is a rose is a rose is a rose“, aber der Satz ist in sanfter Verballhornung längst auch in den deutschen Wortschatz eingegangen, wenn man sagen will: „Es ist, was es ist. Nicht mehr und nicht weniger.“ Demnach würde die Realität sagen: „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“, während der Schmäh spräche: „Eine Rose ist ein Rosenstrauß ist ein Feld voller Rosen – darf ich Ihnen, schönste Frau der Welt, wenigstens eine davon schenken?“
Der Schmäh wäre also eine Geschichte oder Ausdrucksweise mit – sagen wir: speziellem Verhältnis zur Wahrheit. Als ob man damit den Schmäh eingrenzen könnte! Vielleicht lässt er sich ja bei seinem Namen packen: Schauen wir uns also an, woher die Bezeichnung kommt.
Wie bitte? Das Kapitel ist lang geworden? Richtig. Und so lange Kapitel sind nichts für die Lektüre in der Straßenbahn oder im Kaffeehaus? Nochmals richtig. Ich selbst ziehe ja kürzere Kapitel vor. Was es mit dem Wort Schmäh auf sich hat, steht daher erst im nächsten.
Da fällt mir gerade noch etwas ein – wird nicht lang, ich versprech’s, aber ich muss Ihnen noch etwas über die Frau Barischitz erzählen. Sie, die meine erste Begegnung mit dem Schmäh bewirkte, ist auch die Ursache dafür, dass ich bis heute kein Huhn esse. Der Schmäh kann halt ab und zu nach hinten losgehen. Bis zu jenem Tag meiner ferne zurückliegenden Kindheit habe ich Huhn leidenschaftlich gerne gegessen. An diesem bestimmten Tag ist meine Großmutter mit mir auf den Markt gegangen, um bei Frau Barischitz ein Henderl zu kaufen. Das sollte es, gebraten, als Mittagsessen geben. Meine Großmutter hat wirklich fabelhaft gekocht. Aus purer Vorfreude auf die resche Haut ist mir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Meine Großmutter verlangt das Henderl und fragt ganz automatisch: „Is s eh frisch?“ Nun hätte Frau Barischitz einfach antworten können: „Ja.“ Aber eine einfache Ja-Nein-Antwort widerspricht allem, was Schmäh ist. So antwortete Frau Barischitz sozusagen stilecht: „Eh. Heunt’ in da Fruah hot s no Keandln pickt.“ Aus war’s. Nie wieder Huhn. Es war mir egal, ob das Huhn wirklich noch am Morgen Körner aufgepickt hat oder gestern Abend seine Henkersmahlzeit zu sich genommen hatte. Ich war kein völlig naives Kind. Ich meine: Instinktiv war mir durchaus klar, dass Kühe und Schweine das Schnitzelfleisch nicht freiwillig zur Verfügung stellen, und dass Brathühner kein Gemüse aus dem Glashaus sind. Aber die Vorstellung, dieses Tier zu essen, dass sich vor ein paar Stunden noch ein Korn nach dem anderen schmecken ließ und dabei glücklich war: Es war für mich so absolut unerträglich, dass ich nie wieder Huhn gegessen habe. Nicht als Kind – und irgendwie sitzt mir dieser Schock von damals noch immer so sehr in den Knochen, dass ich auch heute kein Huhn esse.
Schmähohne.