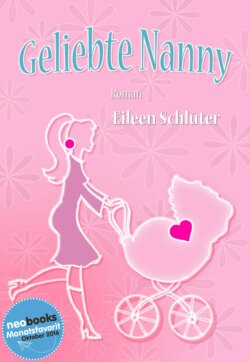Читать книгу Geliebte Nanny - Eileen Schlüter - Страница 5
»Worum zum Geier handelt es sich bloß bei ihren geforderten Bedingungen? Für die Kohle nehme ich fast alles in Kauf!«
ОглавлениеEine Woche später bekomme ich Post. Es ist die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch als Kindermädchen, bei der Dame mit der ich wenige Tage zuvor telefoniert habe. Der Termin ist schon morgen. Sofort rufe ich meine Freundin Yasi an und berichte ihr von der positiven Neuigkeit.
Am selben Abend kauert Yasemin mit betrübter Miene auf meinem Bett. Im Minutentakt kontrolliert sie ihr Handy, doch sie empfängt weder eine SMS noch ruft Cengiz, der Rechtsanwalt mit den Schmalzlocken, sie an.
Ich schaue auf die Uhr. Ich trage bereits meinen Schlafanzug. Eigentlich war ich gerade im Begriff ins Bett zu gehen, als Yasi tränenüberströmt vor meiner Wohnungstür stand. Da musste ich sie ja wohl oder übel reinlassen.
»Hab ich was falsch gemacht, Mel?«, fragt sie mit glasigen Augen.
»Was sollst du denn falsch gemacht haben?« Üblicherweise sind es doch die Männer, die immer alles falsch machen.
»Keine Ahnung. Alles hat so gut angefangen, aber jetzt meldet Cengiz sich nicht mehr bei mir.« Sie bläst geräuschvoll Luft durch ihre Nasenlöcher aus und presst die Lippen fest aufeinander.
Ich setze mich neben sie.
Ruhelos fährt sie mit den Händen durch ihr ungeordnetes Haar.
»Ich hab seit unserem letzten Treffen nichts mehr von ihm gehört. Das ist jetzt vier Tage her. Also langsam drehe ich durch. Heute im Verlag, konnte ich mich auf nichts konzentrieren, dabei musste ich einen superwichtigen Text überarbeiten.«
»Er wird sich schon melden, Yasi. Schließlich ist er Rechtsanwalt und hat bestimmt ’ne Menge Arbeit und Termine«, versuche ich sie zu beruhigen. Wobei ich dazu sagen muss, dass Sören auch als Nicht-Rechtsanwalt ständig Arbeit und Termine hatte. In seinem Fall handelte es sich aber ausschließlich um Arbeit an seinem dämlichen fahrbaren Untersatz und um Termine mit irgendwelchen blechgeilen Schnitten.
Yasis Miene wird zuversichtlich.
»Ja, vielleicht hast du Recht.« Sie setzt sich auf und grinst. »Er ist doch wirklich ein Traumkerl, findest du nicht?«
Ich verkneife mir gerade noch eine Antwort, die ihm, hinsichtlich seiner Frisur, wenig Schmeichelhaftes angedeihen ließe.
»Ihn würde ich sogar meinen Eltern vorstellen.« Ihre tiefgrünen Augen strahlen mit meiner Schlafzimmerbeleuchtung um die Wette. »Ich glaube ich bin verliebt, Melissa.«
»Ja, du bist verliebt, Yasi«, erwidere ich nachdrücklich. »Sonst würdest du nicht wie eine euphorische Dreizehnjährige alle zehn Sekunden auf dein Handy schauen, in der Hoffnung dein Angebeteter würde sich endlich melden.«
»Tut mir leid, dass ich dich so spät noch damit belästige«, entschuldigt sie sich. »Ich hatte völlig vergessen, dass du morgen früh ein Vorstellungsgespräch hast. Was ist das überhaupt für eine Stelle?«
»Reiche Geschäftsleute, die ein Kindermädchen suchen«, repliziere ich, »…und sie wohnen in einem der nobelsten Düsseldorfer Villenviertel.« Na gut, große Chancen rechne ich mir sowieso nicht aus. »Wenn das klappen würde…stell dir mal vor, Yasi – ich, eine Nanny bei den Superreichen.« Bei diesem Gedanken setze ich ein breites, strahlendes Grinsen auf. »Wär’ das nicht super?«
»Allerdings«, staunt sie.
»Shoppen auf der Kö…, Spaziergänge im Rheinpark…«, schwärme ich überschwänglich.
»Nicht zu vergessen, mit den unerzogenen, verwöhnten Gören im Schlepptau«, erörtert Yasi mit feierlichem Unterton in der Stimme. »Kinder von Reichen sind nicht ohne! Viel Spaß Mel.«
Ach Mann, Yasi kann einem wirklich die Stimmung vermiesen, mit ihrer ständigen Schwarzmalerei.
Da ertönt ihr SMS-Signal. Sie zuckt zusammen und stiert auf’s Display.
»Cengiz...«, informiert sie mich und studiert fiebrig die eingegangene Kurzmitteilung.
»Hallo hübsche Frau. Habe viel zu tun in der Kanzlei. Ich melde mich die Tage«, liest sie laut vor, während sie entgeistert auf ihr Handydisplay starrt. Sie gibt ein unbeherrschtes Geräusch von sich, das fast wie ein Fauchen klingt. »Das ist alles?!« Ihre Augenbrauen ziehen sich grimmig zusammen. Auf meiner Unterlippe kauend, verfolge ich ihren stetig ansteigenden Wutausbruch.
»Nicht zu fassen«, schnaubt sie verächtlich. »Wie kann er so belanglos daher schreiben ›Ich melde mich die Tage‹, tickt der noch ganz richtig?« Mit gewaltigem Schwung landet das Handy in ihrer Handtasche. »Vermisst er mich denn kein bisschen?!« Sie gibt mir keine Chance, mich in ihren unbändigen Monolog zu integrieren. »Daran ist nur diese blöde Kanzlei schuld! Sollen die doch noch jemanden einstellen, wenn es da so viel zu tun gibt, damit die Mitarbeiter endlich ein Privatleben haben.«
Ich kann mich nur über meine Freundin wundern. Immerhin gehört Yasi selbst zu der Sorte Frauen, die nichts als die eigene Karriere im Sinn haben. Bisher waren ihr Beziehungen nie wichtiger, als das Studium und die anschließende Karriere als Journalistin. Gerade macht sie ein Redaktionsvolontariat bei einem Zeitungsverlag, was bis jetzt immer vorrangig war.
Und nun scheint Yasi tatsächlich ernsthafte Absichten bei Schmalzlocke zu haben. So kenne ich sie gar nicht. Sie hat noch nie einem Mann hinterher gejammert. Na, hoffentlich hat sie Glück mit diesem.
»Übrigens Mel. Was ist eigentlich aus dem Typen geworden, der dich neulich im Club pausenlos angeschmachtet hat? Wenn der mal nicht total scharf auf dich war!«
Jetzt übertreibt sie aber.
»Du meinst den Anhang von deinem Rechtsanwalt? Was soll schon mit ihm sein? Nichts! Hab ihm die kalte Schulter gezeigt. Nach der Sache mit Sören, brauche ich erstmal eine Erholungsphase von den Männern!«
»Cengiz hat erwähnt, dass sein Kumpel dich gern kennengelernt hätte.« Belustigt mustert sie meinen rosa Snoopy-Schlafanzug. »Aber im Grunde sind ja alle Männer scharf auf dich, wenn sie dich sehen«, offenbart sie mir mit vorgespielter Langeweile.
»Ach, hör auf.« Es nervt mich, wenn sie mir das ständig vorhält. »Okay, er sah schon zum Anbeißen aus...«, gebe ich zu, »…also von weitem jedenfalls. Aber diese Typen sind doch alle gleich. Die sehen nur eine scharfe Blondine in mir. Mehr nicht. Die wollen sowieso alle nur das Eine!«
»Hach ja, Mel«, seufzt Yasemin theatralisch. »Du hättest natürlich gern, dass er in dir die engagierte UN-Botschafterin oder die großzügige Charity-Lady gesehen hätte, stimmt’s?«
»Ja oder wenigstens die aufopferungsvolle Nanny, deren Arbeitgeber keine Zeit für die eigenen Kinder haben«, füge ich emphatisch hinzu.
»Du bist drollig. Wie hätte er das denn sehen sollen? Es steht dir ja schließlich nicht auf der Stirn geschrieben. Auf den ersten Blick bist du nun mal die scharfe Blondine, für so ziemlich jeden Mann.«
Sie erhebt sich vom Bett und stellt sich vor meinen Schminkspiegel, der an meiner himbeerfarbenen Schlafzimmerwand hängt.
»Und überhaupt«, fährt sie fort, »im Endeffekt bist du genauso oberflächlich. Schließlich weißt du auch nichts über ihn, außer dass du ihn sexy findest. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja in Wirklichkeit ein engagierter Umweltschützer oder ein anständiger Millionärssohn, der kranke Kinder in Entwicklungsländern finanziell unterstützt. Dummerweise hast du ihm keine Chance gegeben, dir sein wahres Gesicht zu zeigen.«
»Hmm..., meinst du?« Ach was. Jetzt hat sie mich völlig aus dem Konzept gebracht.
Ist ja auch egal. Wie ich bereits mehrmals erwähnte, brauche ich gegenwärtig sowieso keinen Mann. Ich konzentriere mich derzeit lieber auf das Wesentliche in meinem Leben, nämlich darauf meine Mission als Engel zu erfüllen. Warum eben nicht als Nanny, bei einer Millionärsfamilie? Wenn ich den Kindern damit was Gutes tun kann.
Am nächsten Morgen wache ich viel früher auf als sonst. Heute steht mir das Vorstellungsgespräch bei dieser Familie von und zu Dingsbumshausen bevor. Ich bin so was von aufgeregt. Vorstellungsgespräche lösen von jeher Panik in mir aus und gehören deswegen nicht unbedingt zu den Dingen, die mir besonders leicht fallen. Im Gegenteil, ich habe ständig Angst, kein Wort herauszubekommen und völlig idiotisch vor meinem potentiellen Arbeitgeber zu stehen.
Im Vorfeld habe ich neugierigerweise ein paar Recherchen im Web getätigt und besagte Familie samt Nobeladresse gegoogelt. Man will ja schließlich wissen, mit wem man es zu tun hat. Mir fiel fast die Kinnlade herunter, als mir die sagenhafte Familienchronik ins Auge stach. Bei der unwirschen Dame, neulich am Telefon, handelt es sich nämlich um eine waschechte Millionenerbin mit adeligen Vorfahren. Claudia Freifrau von Degenhausen. Ihr Ehemann Arndt von Degenhausen geborener Vorschulze (er hat den Familiennamen seiner Frau angenommen) ist ein Geschäftsmann mit Harvard-Abschluss (wie es in der Firmen-Homepage geschrieben steht) und seit dem Tod seines Schwiegervaters, Heinrich Freiherr von Degenhausen, Chef eines bekannten Schmuckkonzerns, der von Degenhausener Gold & Silber GmbH. Ein Familienunternehmen, das seinen Anfang (seinerzeit als kaiserliche Goldschmiede) im späten Mittelalter nahm und heute einen Umsatz von mehreren Millionen Euro im Jahr verzeichnet.
Ganz nebenbei betreibt die gute Freifrau von Degenhausen eine Wellness-Oase der Luxusklasse mit allem Pipapo. Beispielsweise die isländische Schlammpackung, die exquisite Schokoladendusche oder das fürstliche Cleopatrabad, wobei sich die Preise auch ordentlich gewaschen haben. Laut Homepage. Und logischerweise gehören Prominente und Millionärsgattinnen zur bevorzugten Kundschaft.
Während ich mir zum wiederholten Mal die glamouröse Homepage anschaue, stelle ich mir in Gedanken vor, das Privileg zu genießen, mich in diesem erstklassigen Spa, einer beglückenden Ganzkörpermassage hinzugeben und dazu ein paar Gläser Champagner zu schlürfen. Am liebsten natürlich auf Kosten des Hauses. Ob einer Nanny wohl ein Wellness-Tag zu vergünstigten Konditionen eingeräumt wird? Wobei, eigentlich mag ich gar keinen Champagner, dieser komische Nachgeschmack erinnert mich so ungemein an Schimmelpilz.
Innerlich bin ich erregt. Was, wenn ich tatsächlich diesen Job bekäme? Melissa Bogner – Nanny bei Familie Millionär. Klingt nicht übel.
Eine halbe Ewigkeit habe ich verzweifelt den Inhalt meines Kleiderschranks durchwühlt. Der erste Eindruck ist schließlich der Wichtigste, und ich will ja alles richtig machen, bei der Garderobe für’s Vorstellungsgespräch.
Ein komplettes Outfit muss bei mir immer perfekt aufeinander abgestimmt sein. Sowohl die Formen als auch die Materialien müssen fließend ineinander übergehen. Die Schuhe sollten natürlich auch nicht aus der Reihe fallen. Ich bekomme eine Krise, wenn meine Klamotten optisch nicht zusammenpassen. Dabei vermeide ich allzu viele extravagante modische Highlights und setze lieber auf zwei bis drei zweckmäßige Accessoires. Also konkret bedeutet das, dass ich zu den experimentier-unfreudigen Leuten gehöre und es tunlichst vermeide, mit fragwürdigen Trends aufzufallen. Ich bevorzuge das klassisch Elegante, am allerliebsten Ton in Ton. Ein weiteres meiner zwanghaften Bedürfnisse, die ich ausleben muss: Akribisches Klamottenkombinieren.
Manche Leute könnten jetzt behaupten, ich sei ein bisschen gaga. Aber dafür werde ich bestimmt niemals auf jenen Seiten landen, wo diese chronischen Kritiker mannigfaltiger Klatschblätter schlechtgekleidete Leute abbilden (zumeist Promis) und oben drüber schreiben: ›Der Griff ins Klo - der Woche!‹ und zusätzlich jede noch so winzige Fehlinterpretation modischen Stilgefühls mit höchster Verachtung strafen.
Ich entscheide mich für einen schlichten kurzärmeligen Feinstrickpulli, gut sitzende Jeans mit cognacfarbenem Gürtel und dazu ein Paar Pumps, selbstverständlich auch in passendem Cognac. Für gewöhnlich kaufe ich meine Sachen in konventionellen Trendmodegeschäften, wo die Preise einigermaßen erschwinglich und sämtliche Kollektionen harmonisch aufeinander abgestimmt sind, was es mir enorm erleichtert, meiner speziellen Angewohnheit nachzukommen. Doch hin und wieder bin auch ich nicht vor modischen Fehlkäufen gefeit; etwa die quietschorangenen Overknee-Stiefel aus Wildleder, die ich mich nicht einmal zu Karneval wagen würde anzuziehen. Es sei denn, ich wollte mich als Storch verkleiden. In der Regel sind solche Klamotten unkombinierbar mit dem, was üblicherweise in meinem Schrank hängt. Mittlerweile bewahre ich haufenweise solcher Fehlkäufe samt Preisschild in einem Extrafach meines Kleiderschranks auf, alles ungetragen.
Mein Blick fällt auf genau dieses Fach im Schrank. Vielleicht sollte ich das Zeug bei Ebay versteigern. Vor allem diese absoluten No Go’s, die meine Mutter mir in regelmäßigen Abständen vom Wochenmarkt mitbringt, als wäre ich immer noch sechs. Ihrer Tochter permanent unbrauchbare Kleidungsstücke zu kaufen, die dann für immer und ewig im Schrank vergammeln, ist nämlich ihre besondere Macke. Sie sollte sich wirklich einen Job suchen.
Ich betrachte mein Spiegelbild. Nicht schlecht. Aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Outfit. Hm, etwas Luftigeres wäre besser geeignet. Es ist Anfang Juli und beinahe tropisch. Peinlich, wenn unter dem Strickteil eine fette Achselparty stiege, während ich einer Millionenerbin in Worte zu kleiden versuchte, was für eine tolle Nanny ich doch wäre.
Letztendlich habe ich mich für eine leichte, ärmellose Bluse in einer zarten Farbe, die sich – unglaublich aber wahr »Knochen« nennt, entschieden. Ich schwöre, das ist kein Scherz; meine Bluse ist knochenfarbig. Ich muss schon sagen, diese Mode-Fuzzis leben in einer verschrobenen Welt! Dazu ein schmaler, schwarzer Gürtel. Ein eleganter, dunkelblauer Stiftrock und ein paar hübsche schwarze Sandaletten. Nicht zu bieder. Nicht zu aufgedonnert. Perfekt.
Meine frisch gewaschenen Haare sind dagegen alles andere als perfekt. Sie sind kaum zu bändigen. Doch für das Glätteisen habe ich definitiv zu wenig Zeit. Ich binde sie also zu einem hochangesetzten Pferdeschwanz zusammen, der mir immerhin noch fast bis zur Taille reicht. Übrigens ist das meine Lieblingsfrisur, bei der, wie ich finde, mein Hals und der Nacken besonders schön zur Geltung kommen. Fix noch ein dezentes Make-Up aufgetragen und los geht’s.
Mit meinen Unterlagen von diversen Fortbildungen, mit denen ich zusätzlich Eindruck schinden möchte, sause ich los zur Bushaltestelle. Um diese Uhrzeit wimmelt es im Linienbus immer von Pendlern und Schulkindern, die sämtliche Sitzplätze in Beschlag nehmen.
Ein geschniegelter Anzugträger mit schwarzem Aktenkoffer, dessen Nebenplatz der einzige, noch unbesetzte Sitz im ganzen Bus ist, beschwört mich mit transparenten Gesten, genau dort Platz zu nehmen. Widerwillig setze ich mich neben ihn.
Der Typ grinst mir genügsam ins Gesicht, wobei sein Blick schrittweise immer tiefer rutscht, und er schlussendlich auf meine Bluse stiert, als hätte er Röntgenaugen. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Clark Kent hat er ja.
»Schönes Wetter heute…«, legt Clark los.
»Mmh…«, mache ich.
»Fährst du öfter mit dieser Linie? Ich habe dich noch nie hier gesehen, du wärst mir mit Sicherheit aufgefallen«, schleimt er mich voll.
Nicht schon wieder! Hat man denn nirgendwo seine Ruhe vor notgeilen Lustmolchen?
Hektisch fummelt der Bürohengst an seiner Aktentasche herum. Anscheinend überlegt er fieberhaft, wie er mich in ein tiefgründigeres Gespräch vertiefen kann. Ohne Erfolg. Ich drehe mich absichtlich von ihm weg.
An der nächsten Bushaltestelle steigt eine junge mit Kopftuch und langem Mantel bekleidete Frau ein, der eine baldige Entbindung unleugbar anzusehen ist. Sie hat erhebliche Probleme mit ihrem Kinderwagen, den sie vergeblich in den Bus zu hieven versucht. Gleichzeitig balanciert sie ein schreiendes Kleinkind auf der Hüfte. Das kann ja nicht gutgehen. Die Arme rackert sich sichtlich ab, doch keiner der übrigen Fahrgäste kommt ihr zur Hilfe. Täusche ich mich, oder drehen einige Leute sogar demonstrativ ihre Köpfe weg?
Die Frau schaut sich ratlos um. Erheblich schockiert über die von Lethargie befallenen Businsassen, erhebe ich mich und rufe: »Warten Sie, ich helfe Ihnen!«
Während ich den schweren Kinderwagen hochstemme und ihn an der dafür vorgesehenen Seite parke, verfolgen mich die Blicke meiner tatenlosen Fahrgenossen.
»Sagol«, sagt die Türkin, was soviel wie Danke heißt. Ein paar Brocken Türkisch verstehe ich mittlerweile, da Yasemins Brüder es vorziehen, grundsätzlich auf Türkisch zu kommunizieren, auch wenn Deutsche anwesend sind.
»Kein Problem«, antworte ich. »Setzen Sie sich ruhig auf meinen Platz, ich kann stehen.« Mein Sitznachbar wird ganz blass. Dankbar und völlig außer Atem, lässt sie sich auf den Sitz plumpsen. Der vorhin noch so überaus zuvorkommende Schleimscheißer rückt sofort ein Stück von ihr ab, umschlingt krampfhaft seine Aktentasche und blickt den Rest der Fahrt reglos aus dem Fenster. Unglaublich.
Ich bin ziemlich spät dran, als ich endlich in ein Taxi steige, das mich zur Zieladresse ins noble Kaiserswerther Villenviertel bringt.
Ziemlich ruhige Gegend. Alles sehr weitläufig. Und diese Häuser...ach was rede ich – Villen!
Mein Herz pocht wie wild vor Aufregung. Welche Villa ist es wohl? Eventuell die riesige gelbe, hinter den schwarzen verschnörkelten Eisentoren?
Oder vielleicht das Monte-Carlo-mäßige Luxusobjekt mit einer Garage, so groß wie das Reihenhäuschen meiner Eltern?
Das Taxi hält am Straßenrand. Aha, ein schneeweißes Anwesen mit gigantischen Ausmaßen. Ich bezahle.
»Einen schönen Tag noch«, wünscht der Fahrer mir mit einem freundlichen Lächeln, bevor ich die Tür hinter mir zuwerfe.
Das riesige Grundstück ist vollständig von einer weißen Mauer umgeben. Ich stehe vor dem ansehnlichen, verschlossenen Tor und läute.
»Ja bitte?«, ertönt eine Männerstimme durch die Gegensprechanlage.
Ich räuspere mich. Wenn ich aufgeregt bin, habe ich immer einen Frosch im Hals und meine Hände sind auch schon ganz feucht.
»Mein Name ist Melissa Bogner. Ich habe einen Termin bei Frau von Degenhausen.«
»Nehmen Sie das Personaltor. Rechts!«, fordert der Mann. Ich schaue mich um und entdecke ein kleines Eingangstor.
Ein surrendes Geräusch ertönt. Ich eile zum besagten Eingang und drücke gegen die geschmiedete Eisentür, die sich sogleich öffnet.
Ich husche hinein. Wow, ein Golfplatz, direkt vor dem Haus. Nur sehe ich gar keine Löcher. Komisch. Mitten durch diesen lochfreien Golfplatz führt eine gepflasterte Auffahrt, umsäumt von einigen Bäumen. Überall gibt es hübsche Blumenbeete. Alles ist penibel gepflegt. Der gepflasterte Vorplatz ist von akkurat beschnittenen Büschen verschiedenster Formen eingefasst. Die müssen einen Gärtner haben, der sich den ganzen Tag ausschließlich damit befasst. In der Mitte plätschert ein niedlicher Springbrunnen in Form einer Muschel (oder so was in der Art).
Von Architektur habe ich zwar keine Ahnung, aber diese Villa mit dem kolossalen, säulenüberdachten Eingangsbereich, kommt mir vor wie eine Kreuzung aus dem römischen Pantheon und diesen alten Herrenhäusern in Fackeln im Sturm.
Im nächsten Moment öffnet sich die Eingangstür und vor mir steht ein…
Butler!?
Jedenfalls sieht dieser Frackträger mit den schneeweißen Handschuhen aus, wie ein typischer James oder Niles oder wie sie alle heißen.
»Guten Tag«, begrüße ich den Butler. Er mustert mich unaufdringlich und erwidert meine Begrüßung. Ich schätze ihn auf Ende fünfzig. Er trägt den gleichen Haarschnitt wie Howard Carpendale und sieht dem Sänger auch noch zum Verwechseln ähnlich. Was mich für einen Augenblick mutmaßen lässt, der Schlagerstar könnte einem Zweitjob nachgehen, von dem niemand etwas weiß.
»Folgen Sie mir.«
Ich marschiere hinter ihm her und erschaudere zugleich vor dem Hall meiner eigenen Absätze, auf dem steinernen Fußboden der riesigen Eingangshalle. Sofort bemühe ich mich, nicht mehr ganz so fest aufzutreten, was total bescheuert aussehen muss, da ich ihm nun auf Zehenspitzen in den ersten Stock folge. Aber immerhin fast lautlos. Oben angekommen, stehen wir in einer Galerie, von wo aus man hinunter in den Eingangsbereich schauen kann.
Platzmangel herrscht in diesem Haus jedenfalls nicht. Und alles ist so ordentlich und auf Hochglanz poliert. Es ist beeindruckend. Ja, ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen.
Ich schaue durch eine Reihe bodentiefer Sprossenfenster nach draußen.
Mannomann, hinterm Haus noch ein Golfplatz!? Manche Leute übertreiben es aber wirklich. Der hier hat sogar Löcher.
Endlich bleibt Howard vor einer Tür stehen und klopft an.
»Herein«, ertönt die mir im Gedächtnis gebliebene Frauenstimme vom Telefon. Mittlerweile zittere ich vor Nervosität. Immerhin stehe ich kurz davor, mich hier für einen Superjob zu bewerben. Einen Augenblick lang plagen mich Zweifel, ob ich das Richtige tue.
Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Erfahrungen im Bereich der häuslichen Kinderbetreuung. Schließlich bin ich nur eine stinknormale Kindergärtnerin ohne Referenzen oder Empfehlungsschreiben von den Pitt-Jolies oder den Beckhams. Nicht mal von diversen ansässigen Promieltern in dieser Gegend. Ich meine, haben die meine Unterlagen richtig überprüft, bevor sie mich hierher bestellt haben?
Katholische Kindertagesstätte-Meerbusch-Osterrath. Die schmeißen mich doch hochkant wieder raus.
»Die gnädige Frau erwartet Sie nun«, näselt Howard.
»Kommen Sie rein«, sagt die wasserstoffblond gefärbte Grazie, die vor einer Fensterfront an einem Schreibtisch sitzt. Howard schließt die Tür. Ich trete ein und gleichzeitig versagt mein Deo. Dabei scheint das ganze Haus klimatisiert zu sein. Die Frau am Schreibtisch sitzt schweigend und regungslos auf ihrem gepolsterten Bürostuhl. Nur ihre Blicke verfolgen mich, als ich mich ihr unsicher nähere.
»Guten Morgen, mein Name ist Melissa Bogner. Ich möchte mich bewerben. Als Kindermädchen.«
Jetzt betrachtet sie mich intensiv mit ihren eisblauen Augen, die von einem Kranz megalanger falscher Wimpern umrahmt sind. Grob geschätzt ist sie Ende Dreißig. Sie hat ein Cindy Crawford Schönheits-Mal über der rechten Oberlippe. Zarte Krähenfüße machen sich um die Augenpartie bemerkbar. Sie wirkt schlank und durchtrainiert. Und definitiv hat ein Chirurg bei ihrer Oberweite nachgeholfen. Vielleicht auch bei den Lippen. Jetzt erst fällt mir auf, dass sie einen pinkfarbenen Jogginganzug aus Nicki trägt und sportliche Sneakers. Sie sieht aus, wie diese Yoga-, Pilates- oder Fitness-Tussis aus dem amerikanischen Frühstücksfernsehen, die den ganzen Tag nur Rohkost futtern, um ihren Körper vor Übersäuerung und demzufolge vor Cellulite zu schützen. Zum Glück bin ich von Natur aus ein basischer Typ und habe keine Probleme mit Orangenhaut.
Mit einem Mal verzieht sie ihre Lippen zu einem Schmollen.
»Schade…«, fängt sie mit ihrer tiefen, leicht heiser klingenden Stimme an, »…ich hatte gehofft, Sie wären mindestens zwanzig Kilo übergewichtig.«
???
Ich gaffe sie begriffsstutzig an.
Sie mustert mich bis ins kleinste Detail.
»Setzen Sie sich Frau…wie war doch gleich ihr Name?«
Während sie einen vor ihr liegenden Ordner öffnet, schiebe ich eilig meine restlichen Unterlagen zwischen ihre manikürten Finger.
»Bogner. Melissa Bogner.«
»Ich bin Freifrau von Degenhausen. Man nennt mich Claudia.« Dabei spricht sie ihren Namen auf französisch-distinguierte Weise aus, sodass es klingt wie Klodia. Nicht, dass ich sie so nennen dürfte.
»Für das Personal bin ich selbstverständlich die gnädige Frau.«
Sie blättert meine Unterlagen durch. Dann sagt sie in richtungweisendem Ton: »Mein Mann Arndt hat kein Mitspracherecht, was die Wahl der Bewerberinnen für die Stelle der Nanny betrifft. Ich allein bestimme, wer am Ende diese Stelle bekommt. Ich drücke es mal so aus: Das Urteilsvermögen meines Mannes, ist in dieser Angelegenheit deutlich getrübt.«
»Aha, ich verstehe«, entgegne ich. Dabei habe ich gerade keinen blassen Schimmer, worauf sie hinaus will; falls sie überhaupt auf irgendetwas hinaus will. Aber ich bemühe mich, ein ernstes, verständnisvolles Gesicht aufzusetzen, um nicht allzu dämlich auf sie zu wirken.
Wieder blättert sie. Diesmal überfliegt sie mein überdurchschnittliches Abschlusszeugnis.
»Wollen Sie diese Stelle wirklich haben?«, fragt sie mit energischer Stimme.
»Ja, sehr gerne« Und wie. Ich nicke tatkräftig.
»Nichts gegen Sie persönlich, Frau Bogner. Ihr Abschluss ist hervorragend und die Beurteilungen sind ausgezeichnet, aber so wie Sie aussehen, kann ich Sie leider nicht einstellen.«
»Darf ich fragen warum?« Ich bin ganz und gar perplex über ihre Aussage.
»Meine Tochter Pauline und ich, sind die einzigen weiblichen Personen in diesem Haus«, fängt sie an. »Sämtliches Personal vom Koch bis zum Gärtner ist männlich. Und das ist auch gut so. Dann kommt mein Gatte wenigstens nicht noch mal auf dumme Gedanken.«
Ihre Miene nimmt einen finsteren Ausdruck an.
Wieder spricht sie in ihrer auffallend dominanten Tonart.
»Um ehrlich zu sein, am liebsten hätte ich eine männliche Nanny. Aber leider hat Arndt recht. Er meint, Männer würden sich nicht für diesen Job eignen. Aber wie gesagt, mit den Frauen ist das so eine Sache.« Sie ächzt, dann schnalzt sie ärgerlich mit der Zunge. So langsam frage ich mich, worauf genau dies alles hinauslaufen soll. Sie versteht es wirklich, jemanden auf die Folter zu spannen.
Sie sieht mir entschieden in die Augen. Dann sagt sie: »Mein Mann rechnet natürlich nicht damit, dass es durchaus auch qualifizierte muslimische Kindermädchen gibt. Muslimische Kindermädchen, die ihre weiblichen Reize vor den Augen lüsterner Arbeitgeber gut zu verstecken wissen, hinter ihren langen Gewändern und den seidenen Kopftüchern.«
Ähm… Moment mal. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Was für’n muslimisches Kindermädchen überhaupt?
»Bedauerlicherweise sind Nonnen heutzutage wahnsinnig schwer zu kriegen. Alle zu alt.«
Irritiert versuche ich ihrem unlogischen Geplänkel zu folgen, doch meine Ratlosigkeit erreicht gerade ihren Höhepunkt. Sie schaut mir erwartungsvoll ins Gesicht. Dann gleitet ihr Blick langsam an mir herunter.
»Wissen Sie, ich liebe meinen Mann. Und im Grunde liebt er mich auch. Diese Sache mit der tschechischen Au-Pair-Schlampe, war nur ein unbedachter Ausrutscher, soweit ich das beurteilen kann.« Missfällig rümpft sie die Nase und fährt fort. »Aber es ist nun mal meine Pflicht, meinen Ehemann in Zukunft vor der ständig lauernden Versuchung zu bewahren, indem ich gewisse Vorkehrungen und Maßnahmen ergreife. Verstehen Sie was ich meine, Frau Bogner?«
Sprachlos starre ich in ihre Miene, die mir fast ekstatisch erscheint. Irgendwie hat die nicht alle Tassen im Schrank. Aber egal. Diese Superreichen haben ja bekanntlich alle einen an der Waffel. Viel Geld vernebelt einem offensichtlich die Sinne. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass sie sich einfach die besseren Drogen leisten können.
»Ich verstehe nicht so ganz, Frau von Degenhausen…«, sage ich, doch sogleich widerfährt mir ein Geistesblitz, der aber innerhalb eines Sekundenbruchteils wieder verschwimmt. Also nein, was für ein absurder Gedanke.
Ungeduldig kräuselt Klodia ihre Lippen und beginnt, mich über ihren engsten Familienkreis aufzuklären: »Pauline ist sechs. Vormittags geht sie in den Kindergarten. Im Spätsommer wird sie eingeschult. Gerald lernt gerade erst laufen, dabei ist er schon vierzehn Monate alt. Also, in meiner Familie konnten alle schon vor ihrem ersten Geburtstag laufen. Diese Verzögerung muss, genetisch bedingt, aus der Familie meines Mannes stammen. Arndt ist auch nicht der Pünktlichste.«
Sie kneift ihre Augen zusammen. »Arndt arbeitet täglich mindestens dreizehn Stunden in der Firma. Häufig auch an den Wochenenden, deshalb bekommt er die Kinder nur selten zu Gesicht.«
Volltreffer. Ein Workaholic.
»Und ich betreibe seit fünf Jahren erfolgreich ein luxuriöses Wellness-Center«, verrät sie mir stolz.
Ich tue natürlich so, als käme ich aus dem Staunen darüber gar nicht mehr heraus, dabei weiß ich das ja schon längst. Dank Internet.
»Die Hälfte des Tages verbringe ich dort. Manchmal auch länger. Und nebenbei habe ich alle Hände voll mit anderen Dingen zu tun«, – die sie jedoch nicht weiter erörtert.
»Wir brauchen dringend jemanden, der die Erziehung der Kinder in die Hand nimmt, während mein Mann und ich arbeiten. Jemand, dem man die beiden bedenkenlos anvertrauen kann. Und dabei denke ich zu allerletzt an meine Schwiegermutter, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Sie klappt meine Bewerbungsmappe zu.
»Mhm«, mache ich und schildere ihr von meiner bisherigen Erfahrung mit Kindern dieses Alters. Und dass ich bislang nur in Kindergärten und Tageseinrichtungen gearbeitet habe, nicht aber in privaten Haushalten. Das sei kein Hindernis, bei meiner guten Ausbildung, versichert sie mir.
»Sie erhalten selbstverständlich vollständige Verpflegung und ein eigenes Zimmer mit Bad. Allerdings hätten Sie nur jedes zweite Wochenende frei. Leider lässt es sich nicht anders einrichten, bei unseren unzähligen Verpflichtungen.«
Aufmerksam halte ich ihrem Blick stand. Hört sich alles nicht schlecht an. Na gut, bis auf die Wochenendarbeit, aber solange man ordentlich dafür entlohnt wird, soll’s mir Recht sein.
»Der normale Stundensatz liegt bei 6,90 € Brutto, pro Stunde…«, eröffnet sie mir im nächsten Moment, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
Wie bitte? Das soll wohl ein Scherz sein!?
Ich stehe hier im Büro einer Millionenerbin, in einer Millionenvilla, und diese sonderbare Wellness-Tante namens Klodia erzählt mir etwas von 6,90 € die Stunde...Brutto!? Das ist ja die reinste Ausbeutung.
»Äh…tja, eigentlich...«, zögere ich, noch immer fassungslos über das popelige Angebot.
Doch Klodia unterbricht unverzüglich meinen misslungenen Sprechversuch: »Wenn Sie aber meine angeforderten Bedingungen annehmen, Frau Bogner, dann verdienen Sie offiziell 6,90 €; erhalten aber einen Zuschuss von dreiundachtzig Euro Netto pro Tag, den Sie sozusagen einfach einstecken dürfen.«
Mein Mund steht weit offen.
»Sie wissen schon...steuerfrei und so«, ergänzt sie mit verschmitztem Lächeln, offensichtlich davon überzeugt, dass ihr unzweifelhaft krimineller Vorschlag Anklang bei mir findet.
Dreiundachtzig Euro? Schwarz? Bar auf die Hand?
Ich muss mich verhört haben. Worum zum Geier handelt es sich bloß bei ihren geforderten Bedingungen? Für die Kohle nehme ich fast alles in Kauf. Also beteuere ich in gekünstelt gefälligem Ton (nicht, dass sie es sich wieder anders überlegt): »Verehrteste gnädige Frau, Sie würden es mit Sicherheit nicht bereuen mich einzustellen. Ich habe wirklich einen sehr guten Draht zu Kindern, wissen Sie. Fast alle Kinder lieben mich. Und was Ihre Bedingungen betrifft…äh…die würde ich unter diesen Voraussetzungen selbstverständlich auch annehmen.« Ich habe ohnehin das Gefühl, dass ich in ihren Augen genau die Richtige für den Job bin. Wer weiß, was für Transusen sich vor mir für diese Stelle beworben haben?
»So, dann kommen wir also ins Geschäft?« Klodia lächelt zufrieden.
»Sehr gern«, sage ich heftig nickend. »Also, was sind das nun für Bedingungen, die Sie an mich stellen?«
»Wie gesagt, Frau Bogner. So wie Sie aussehen, kann ich Sie leider nicht als Kindermädchen einstellen. Mein Mann hat eine Schwäche für schlanke, langbeinige Blondinen mit Engelsgesicht. Aber ich hab nun wirklich keine Zeit, laufend neues Personal zu suchen, nur weil er ständig der weiblichen Belegschaft nachstellt.«
»Ich verstehe«, bekräftige ich ihre Aussage, ohne sie in Wirklichkeit zu verstehen.
»Daher empfehle ich Ihnen, sich ab jetzt ein wenig…hm, ich nenne es mal…normabweichender zu kleiden. Es muss ja nicht gleich eine Burka sein. Ein Kopftuch und keine körperbetonende Kleidung sollten reichen. Außerdem sollten Sie sich einen zweckdienlichen Namen zulegen. Zum Beispiel Semra oder Ayse. So können wir sicherstellen, dass unserer künftigen Zusammenarbeit nichts im Wege steht.«
»Pardon?«
Semra? Ayse? Normabweichende Kleidung?...
Ich bin verwirrt.
Sie will, dass ich mich züchtig verhülle und mir einen türkischen Namen zulege, damit ihr Ehemann Arndt (offensichtlich ein notorischer Fremdgeher), mir nicht nachstellt und ich ihn meinerseits nicht verführen kann?
Also, ganz ehrlich, die gute Frau hat ’ne Meise.
Sie kramt in einer Schublade und zieht eine Mappe heraus, die sie mir über den Schreibtisch reicht.
»Der Arbeitsvertrag«, fügt sie hinzu. »Dort stehen alle einzelnen Punkte noch einmal aufgelistet. Studieren Sie ihn zu Hause in Ruhe und wenn Sie damit einverstanden sind, können Sie ihn unterschrieben zurückbringen und auch sofort anfangen.«
Sie erhebt sich aus ihrem Bürosessel und schaut auf ihre pompöse Armbanduhr, die mindestens ein Kilo wiegt, so viele Brillis wie die hat.
»…schon wieder zu viel Zeit vertrödelt…«, nuschelt sie in sich hinein, während sie mich quasi aus ihrem Büro hinausschiebt.
»Überlegen Sie es sich, Frau Bogner«, redet sie mir ins Gewissen. »Auf Wiedersehen!«
Die Tür schlägt vor meiner Nase zu und ich stehe allein auf dem Flur. Doch der Butler ist schon im Anmarsch. Wortlos begleitet er mich zur Haustür. Als ich draußen auf dem Bürgersteig stehe, atme ich tief durch. Dann rufe ich mir per Handy ein Taxi.
Ich, Melissa Bogner soll ein muslimisches, kopftuchtragendes Kindermädchen werden? Ich lasse das kuriose Vorstellungsgespräch noch einmal vor meinem inneren Auge Revue passieren. Wer hätte vorher ahnen können, dass ich es mit einer Verrückten zu tun haben würde?! Höchstwahrscheinlich hat das Gehirn dieser Frau einen irreparablen Schaden genommen, bei ihren Endlossitzungen, in der hauseigenen Klappkaribik.
Während der Fahrt schaue ich mir den Arbeitsvertrag genau an. Immer wieder fällt mein Blick auf diese sagenhaften dreiundachtzig Euro extra, welche in einer kleingedruckten Zeile, ganz am Ende des Vertrages, erwähnt werden.
Wie dem auch sei, ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen. Was soll schon dabei sein, diese Stelle anzunehmen? Als gebürtige Rheinländerin, bin ich Verkleidungen grundsätzlich nicht abgeneigt. Ich war sogar mal Mitglied im Karnevalsverein. Unter Umständen erweist sich das Arbeiten in dieser Maskerade sogar als angenehm. Im Endeffekt wäre ich nämlich nicht ständig unliebsamen, wollüstigen Männerblicken (in diesen Fall denen des Hausherren) ausgesetzt, wie so oft. Wie gesagt, auf Dauer nervt das ganz schön.