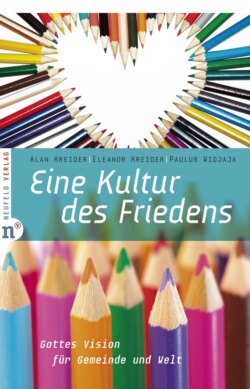Читать книгу Eine Kultur des Friedens - Eleanor Kreider - Страница 8
ОглавлениеEinleitung
Die Idee zu diesem Buch entstand auf einem Flughafen. An einem verregneten indonesischen Abend im Juli 1993 trafen wir Paulus Widjaja auf dem Flughafen von Semarang. An den folgenden Tagen, als meine Frau Eleanor und ich uns ausführlich mit ihm unterhielten, empfanden wir eine besondere Nähe. Ein Satz von Paulus beeindruckte uns zutiefst: „Wenn die christliche Kirche eine Wirkung auf Indonesien haben soll, muss sie sich der größten Friedensfrage überhaupt zuwenden – der Versöhnung mit den Muslimen.“
Teile dieses Buches haben allerdings auch einen englischen Ursprung. Als Eleanor und ich auf das Ende unseres 30-jährigen Dienstes in England zugingen, nahm ich an einer Retraite in einem anglikanischen Benediktinerkloster teil. Dabei las ich die ersten beiden Verse in Philipper 1:
Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle in Philippi, die an Jesus Christus glauben und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus.
Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Abschnitt bereits gelesen hatte, doch auf einmal wurde mir klar: Paulus, der einer Gemeinde schrieb, die er schätzen gelernt hatte, segnete sie zweifach mit „Gnade und Frieden“. Gnade und Friede – eine schlagkräftige Kombination. Ich fragte mich: Wie viele apostolische Briefe beginnen auf diese Art und Weise? Also schaute ich nach und stellte fest, dass fast alle so anfangen. Dann hielt ich inne: Wenn Paulus und Petrus beide ihre Briefe in diesem Sinne eröffnen, müssen sowohl Gnade als auch Friede von großer Bedeutung sein.
Eleanor und ich machten uns also daran, unser Verständnis von Gnade und Frieden zu klären und darüber nachzudenken, wie es im Leben ganz normaler Gemeinden angewandt werden könnte. In unseren Gesprächen mit Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen gelangten wir immer mehr zu der Überzeugung, dass die „Friedensbotschaft Gottes“ (Apostelgeschichte 10,36) wahr ist – und dass sie eine gute Nachricht ist. Sie lässt sich auf alle Bereiche des Gemeindelebens anwenden, auf das Verhältnis zwischen der Gemeinde und Gott, die Beziehungen untereinander, auf das gottesdienstliche Leben, auf die Haltung, in der Christen ihrer Arbeit nachgehen, wie sie auf Krieg reagieren und ihren Glauben weitergeben.
Wir stellten unsere Überlegungen vielen Gruppen vor, und ihre Reaktionen halfen uns dabei, unsere Gedanken weiterzuentwickeln, und beschenkten uns mit vielen hilfreichen Bildern. Zunächst erschienen Artikel darüber in Anabaptism Today, der Zeitschrift des Anabaptist Network in Großbritannien.1 Später wurden sie gesammelt in einer Broschüre mit dem Titel Becoming a Peace Church herausgegeben.2 Nachdem wir in unsere US-amerikanische Heimat zurückgekehrt waren, konnten wir nicht nur vor Gemeinden in den USA, sondern auch in Kanada, Japan, Korea, Taiwan und Hong Kong über dieses Thema sprechen.
Unterdessen promovierte Paulus am Fuller Theological Seminary in Kalifornien und kehrte nach Indonesien zurück. Dort wurde ihm eine Herausforderung und Ehre zuteil: Er wurde zum Direktor des Center for the Study and Promotion of Peace (Zentrum zur Erforschung und Förderung des Friedens) an der Duta Wacana Christian University in Jogjakarta. Rasch entdeckte Paulus, dass seine Vermutungen sich bestätigten: Christen konnten tatsächlich zum Frieden in Indonesien beitragen.
Paulus unterrichtete angehende Pastoren im Friedenstiften; zugleich gab er seine Kenntnisse im Bereich der Konflikttransformation weiter und war persönlich in spannungsreiche Auseinandersetzungen verwickelt, die neben Geschick Glauben und Hoffnung erforderten.
Seit 1993 ist Paulus Vorsitzender des Rates für Frieden der Mennonitischen Weltkonferenz. 2003 folgte ich einer Einladung der Mennonitischen Weltkonferenz nach Jogjakarta, um gemeinsam mit Paulus und Judy Zimmerman Herr, seiner Stellvertreterin, ein Dokument für die Weltversammlung täuferischmennonitischer Christen vorzubereiten, der in Bulawayo, Simbabwe, stattfand. Gemeinsam lasen wir die Stellungnahmen der vielen nationalen Kirchen über die Rolle des Friedens im Leben ihrer Gemeinden. Diese Texte inspirierten uns und wir gewannen den Eindruck, dass die weltweite täuferisch-mennonitische Glaubensfamilie dabei ist, eine Friedenskirche zu werden. Und dankbar beobachteten wir, wie Paulus gemeinsam mit seinen Kollegen in Jogjakarta in den Freuden und Mühen des Gnaden- und Friedensstiftens aufblühte.
Im Jahr 2004 trafen Paulus, Eleanor und ich uns in Pennsylvania, USA, um an diesem Buch weiterzuarbeiten. Zu Beginn trugen wir einfach unsere Gedanken zusammen; Eleanor und ich machten uns dabei viele Notizen. Als Ergebnis dieser Gespräche überarbeitete ich die erwähnte Broschüre Becoming a Peace Church. Anschließend revidierte Eleanor das Manuskript noch einmal, das wir dann elektronisch auf die Reise zu Paulus nach Indonesien schickten. Paulus war extrem gefordert; er hatte nicht nur neue Kurse zu unterrichten, sondern half auch bei der Lösung von Konflikten. Im Januar 2005 wurde das Zentrum, dessen Direktor er ist, vom Bedarf an Traumatherapie in Folge des gewaltigen Tsunami in der Provinz Aceh geradezu überwältigt. Trotz dieser schwierigen Umstände leistete Paulus hervorragende Arbeit. Er überarbeitete unseren Text und ergänzte nicht nur theologische Aspekte, sondern auch viele Beispiele aus seiner praktischen Erfahrung in Indonesien.
Warum haben wir uns dafür entschieden, von einer „Kultur des Friedens“ zu schreiben anstatt von „Friedenskirchen“? Aus drei Gründen: Erstens, weil Denker aus verschiedenen christlichen Traditionen das Leben der Kirche seit einiger Zeit mit dem Begriff „Kultur“ beschreiben. Einflussreiche Christen, angefangen mit dem inzwischen verstorbenen Papst Johannes Paul II., haben die Kirche dazu aufgerufen, eine „Kultur des Lebens“ zu sein. Andere Autoren haben den Begriff „Kulturen des Friedens“ eingeführt.3
Zweitens, weil das Wort „Kultur“ ein ungemein reicher Begriff ist. Anthropologen verstehen Kultur als ein „Bedeutungsgewebe“, worin wir leben und das wir selbst „gesponnen“ haben. Das Gewebe von Sprache, Überzeugungen, Institutionen und Praktiken gestattet uns, so zu leben, dass wir gedeihen und uns zuhause fühlen können.4 Deshalb fragen wir die dynamischen, sich verwandelnden Kulturen, in denen wir leben: Sind sie gastfreundlich? Können wir und andere uns ganzheitlich heimisch in ihnen fühlen? In diesem Buch stellen wir eine Vision der Kirche als eine Kultur des Friedens dar. Wir glauben, dass dies eine Kultur ist, die Gott schafft – eine wohnliche Kultur.
Drittens, weil Kultur aus unseren Geschichten heraus entsteht. Der britische baptistische Theologe Paul S. Fiddes ist überzeugt, dass Kulturen aus Erzählungen entstehen; sie seien verwurzelt „in den Geschichten, die Menschen über sich selbst erzählen“.5 In diesem Buch beschreiben wir die Überzeugungen und Handlungen, die zur Entwicklung von Kulturen des Friedens erforderlich sind.
In den verschiedenen Familien und erst recht Ländern werden nicht die gleichen Geschichten erzählt. Doch für Christen entwickeln sich Überzeugungen und Verhaltensweisen aus einer ergreifenden universellen Geschichte – der Geschichte von Gottes Gnade und Liebe. Sie zieht sich quer durch die hebräischen Schriften und das Neue Testament und findet ihren Höhepunkt in der Menschwerdung, in Leben und Lehre, Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die Geschichte, die Petrus (inzwischen Mitglied der jüdischen Bewegung, die in Jesus den Messias sah) dem heidnischen Soldaten Kornelius erzählte. Dabei nannte er sie die „Friedensbotschaft Gottes“ (Apostelgeschichte 10,36). Die Kultur des Friedens, die unser Buch beschreibt, erwächst aus zahlreichen Geschichten aus vielen Teilen des Globus. Aber diese Geschichten sind alle derselben übergreifenden Erzählung untergeordnet.
Letztlich haben wir über „Kulturen des Friedens“ geschrieben, weil der Begriff „Friedenskirche“ einen begrenzten und privaten Beigeschmack hat – als ob er sich auf Menschen aus historischen pazifistischen Gruppierungen beschränkte. Wir schreiben aus der weltweiten mennonitischen Glaubensfamilie, einer der historischen Friedenskirchen, und viele unserer Geschichten erzählen von mennonitischen Erfahrungen und Bemühungen. Doch die „gute Nachricht“ des Friedens, die in Jesaja 52,7 erstmals erwähnt wird, war eine gute Nachricht für das gesamte Volk Gottes. Das Evangelium und die Praxis von Friedensstiften, Gottesdienst, Arbeit, Zeugnis und Leben in einer Welt, die sich im Kriegszustand befindet – gehören den Christen aller Traditionen.
Von den Überlegungen und Aktionen von Christen aus den verschiedensten Traditionen haben wir viel gelernt. Wir freuen uns darüber, ein Teil der weltweiten Kirche zu sein! Wir bekennen zugleich, dass wir noch viel von anderen Christen zu lernen haben. Wir haben versucht, dieses Buch in der biblischen Überlieferung zu verwurzeln, die uns alle vereint, und im Evangelium, das uns alle mit Leben erfüllt. In diesem Sinn ist dieses Buch ein Angebot an die weltweite Kirche Jesu Christi.
Wir beten, dass das, was Sie hier lesen – das Ergebnis der Zusammenarbeit eines Indonesiers mit zwei Amerikanern, eines Ehepaares mit seinem Freund – für Sie hilfreich ist. Wir drei haben schon oft gehört, dass das Thema Frieden Probleme in die Gemeinden trägt. Das ist zweifellos wahr. Wir haben aber auch das Empfinden, dass das Evangelium des Friedens, wenn es in alle Bereiche von Leben und Praxis der Gemeinde aufgenommen wird, lebensverändernden Nutzen mit sich bringen kann – eine Friedensdividende! Es erfordert Einfallsreichtum und harte Arbeit, sich das Friedenstiften anzugewöhnen. Und es hat seinen Preis – Jesus wirklich nachzufolgen, hat stets seinen Preis. Aber es lohnt sich. Kein Wunder, dass in beiden Testamenten der Bibel ständig von der „guten Nachricht des Friedens“ die Rede ist!
Wir sind überzeugt, dass die Neuentdeckung des Friedens zur Lebendigkeit der Kirche beiträgt. Doch was ist dazu erforderlich? Die folgenden Kapitel vermitteln beides, eine Vision sowie eine Vielzahl praktischer Vorschläge. Jedes Kapitel ließe sich beliebig ausweiten – wir haben gerade erst begonnen, uns der Herausforderung zu stellen, heute Kulturen des Friedens zu sein. Wir laden Sie ein, Beispiele und Ergänzungen hinzuzufügen, während Ihre Gemeinde das Abenteuer entdeckt, sowohl Gnade als auch Frieden zu lehren und zu leben.
Ich wünsche euch nun von Herzen, dass Gott selbst euch hilft, das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er ist es ja, der uns seinen Frieden schenkt. … Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt (Hebräer 13,20–21).
Alan Kreider Elkhart, Indiana/USA Pfingsten 2005
Anmerkungen
1Alan Kreider, „Is a Peace Church Possible?“; „Is a Peace Church Possible? The Church’s ‚Domestic‘ Life“; „Is a Peace Church Possible? The Church’s ‚Foreign Policy‘ – Worship“; „Is a Peace Church Possible? The Church’s ‚Foreign Policy‘ – Work, War, Witness“, in: Anabaptism Today, Ausgaben 19–22 (1998–1999).
2London, New Ground, 2000.
3Johannes Paul II., Enzyklika „Evangelium vitae“ [Evangelium des Lebens] (1995), http://www.vatican.va/edocs/DEU0073/_INDEX.HTM; Elise Boulding, Cultures of Peace – The Hidden Side of History (Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2000); Fernando Enns, Scott Holland, und Ann Riggs (Hrsg.), Seeking Cultures of Peace – A Peace Church Conversation (Telford, PA, Cascadia Publishing House, 2004).
4Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures – Selected Essays (New York, Basic Books, 1973), 5.
5Paul S. Fiddes, „The Story and the Stories, Revelation and the Challenge of Postmodern Culture“, in Paul S. Fiddes (Hrsg.), Faith in the Centre – Christianity and Culture (Oxford, Regent’s Park College, with Macon, GA, Smyth & Helwys, 2001), 77.