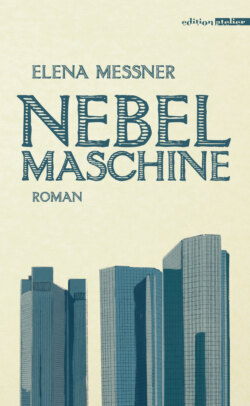Читать книгу Nebelmaschine - Elena Messner - Страница 4
I.
ОглавлениеIch stelle mir vor, ich könnte die ganze Aktion noch einmal durchleben, von Anfang bis Ende. Noch einmal alles sehen: mich als Beobachterin mit durchgestrecktem Rücken an der Bar, die anderen auf der Bühne, noch einmal zuschauen, wie aus nichts etwas geworden ist, beim Frieren und Teetrinken, der Argwohn Edwins, Iris und ihre Perlmuttzähne, das Streiten, Nikos Witze, Laura am Laptop, der ihren Blick gefangen hält, noch einmal das Surren der Beamer, und dazu Baugrubers oder Kattnigs Miene. Noch einmal mich mit geschlossenen Augen auf dem Rücksitz eines Autos sehen, während auf den Vordersitzen zwei streiten. Noch einmal (und noch einmal und noch einmal) mich betrachten, bei den Proben, wie ich mit Unverständnis den Kopf schüttele, Listen studiere, auf einen Bildschirm, auf eine Mauer oder in den bauchigen Nebel starre. Die Gesten noch einmal sehen: Lauras ausgestreckte Hand, Nikos Streicheln über Holz, die ausgebreiteten Arme von Iris, als sie sich ins Publikum fallen lässt.
Ich stelle mir auch vor, die Bilder von Küsten, vom Meer noch einmal zu sehen, schlammigen Boden, durchsetzt von Weidengebüsch, oder den Hinterraum mit den Matratzen, das offene Fenster, durch das vor der Premiere die sternenklare Nacht dringt. Sehen, wie ich bei der Premierenvorstellung mit geschlossenen Augen im Publikum sitze, zuhöre, am Ende klatsche mit vor Überraschung offenem Mund, während immer noch blendende Lichtspuren über die Personen flirren, die sich auf der Bühne zusammendrängen.
Es ist acht Jahre her, dass ich bei der Premierenfeier am Bretterboden herumkugelte. Genauso alt sind die Fotos von dieser Feier, die seit Kurzem wieder in den Zeitungen zu sehen sind. Das immer gleiche Foto von Iris mit ausgestreckten Armen oder die Fotos von Laura, Rosen haltend. In der digitalen Variante dann die Bilderstrecken, durch die man sich klickt, Fotogalerien, in denen man umherscrollt, vor, zurück, wieder vor: der Nebel, die Polizeiwagen, die Gruppenaufnahmen von der Bühne. Jeden Tag erreicht mich eine weitere Nachricht mit Links zu weiteren Fotos, mehr Berichten, neuen Interviews und Stellungnahmen, man druckt Spezialausgaben zum Thema. Seit die Geschichte wieder hochkommt, ist alles noch stärker geworden in meiner Erinnerung, und bei jedem erscheinenden Artikel stelle ich mir also vor, ich könnte die Ereignisse von vor acht Jahren erneut sehen, alles noch einmal fühlen, allerdings nicht aus heutiger Sicht, sondern streng der Reihenfolge des Geschehens folgend, ohne Wissen um den Ausgang, mit der damals empfundenen Anspannung und Neugierde. Wie erstmals erlebt.
Aber: Jeder Rückblick auf das »Theater auf Lager« ist bloß eine weitere Wiederaufnahme im Repertoire meiner Erinnerungen. Egal, auf welchen Moment ich da zurückschaue, ich sehe immer sofort, wie er weitergehen wird. Schlimmer sogar: Denke ich an diese Wochen zurück, kann ich sie nur von ihrem unerwarteten Ende her denken. Beim Gedanken an Iris beginne ich Edwin zu erinnern, und dann die Spalte zwischen zwei Holzbrettern, durch die ein süßlich-stickiger Nebel dringt. Beim Gedanken an Baugruber sehe ich Kattnig oder Lauras Haarzopf, sehe langstielige Rosen, achtlos in einen Eimer geworfen, und auch wieder die Polizeiwagen, mit eingeschaltetem Blaulicht, ohne Sirene. Nie, wirklich nie kann ich isoliert und für sich genommen den Moment der Überraschung am Ende der Premiere erinnern. Immer schieben sich zeitgleich die Bilder des Davor und Danach übereinander, als könnte ich meinen Blick nicht fixieren, weil er durch das nachträgliche Wissen verwischt wird. Ja, im Rückblick sieht naturgemäß vieles anders aus, als es mir damals vorkam, aber: Im Rückblick ist es auch nicht erlebt worden.
Um zu verstehen, wie sich die Ereignisse so spektakulär entwickeln konnten, dass sie noch heute, acht Jahre später, die Zeitungen füllen, muss man wissen: Die Krise war zu dem Zeitpunkt, als ich vom »Theater auf Lager« erfuhr, in unserem Land gewiss keine Abstraktion mehr. Die Platzwunden der Wirtschaft, und damit die Menschen, die im Schatten illegaler Geldgeflechte und Seilschaften existiert hatten, wurden zunehmend unübersehbar. Die Theatergruppe bekam viel Aufmerksamkeit, weil sie von nichts anderem redete als vom Bankrott unseres Landes. Mir hatte die Intendantin an meinem Stadttheater, Magda Mazur, schon zu Winterbeginn eine Lawine von aufeinanderfolgenden Nachrichten weitergeleitet, weil sie (richtigerweise) dachte, das Projekt, zu dem darin eingeladen wurde, könnte interessant für mich sein. Magda war es auch, die mir auf eine meiner Rückfragen hin einen Straßennamen zuschickte, zusammen mit der Erklärung, dass unter dieser Adresse die Lagerhalle zu finden sei, die das neue Ensemble als Proberaum bezogen hatte.
Natürlich wusste ich, dass sie mich vorschob (sie schob mich ja häufig vor). In solchen Situationen meinte sie stets zu mir, ich sei der einzige Mensch an ihrem Theater, dem sie vertraute, und ich denke nicht einmal, dass sie dabei log. Die Schieflage zwischen uns beiden, die nicht nur eine Schieflage zwischen meiner und ihrer Gehaltsstufe war, sondern eine zwischen Bühnenarbeit und Geschäftsführung, legt es nicht nahe, aber Magda mochte mich, gerade weil ich aus der Technik kam, sie respektierte mich mehr als die ständig wechselnden Dramaturgen und Regisseurinnen. Ich vertraute umgekehrt also auch ihr. Wohin ihre als Hinweise getarnten Befehle führen sollten, konnten wir damals beide nicht wissen.
Heute könnte ich die Lagerhalle nicht mit Sicherheit wiederfinden, und das, obwohl ich eine Zeit lang fast jeden Tag dort war. Ich weiß noch, dass man, um von der Stadt aus dorthin zu gelangen, die Ausfahrtsstraße in Richtung Süden nach einigen Kilometern verlassen und danach etwa zehn Minuten weiterfahren musste. Irgendwo an dieser Straße zweigte ein Feldweg ab, und von diesem später ein zweiter, dritter, vielleicht ein vierter. War man an einem Bach vorbei, endete der Weg, hier dann: ein Steilhang, der zu einem Wiesenstück mit anschließendem Wald führte, und auf der Wiese die alte Lagerhalle, in der die Gruppe sich eingerichtet hatte.
An meine erste Ankunft dort erinnere ich mich gut. Es war ein Freitag. Erste Ankunft, das hieß in dem Moment: ein Übermaß jener Neugierde, die wie so vieles, das ich damals empfand, nicht wieder aufrufbar ist (der Rückblick bleibt nüchtern, zu sicher ist man sich der retrospektiven Überlegenheit). Am Hügel oberhalb der Halle waren neben dem Feldweg nur wenige Autos geparkt, weswegen ich zunächst befürchtete, kaum Leute anzutreffen. Es war Dezember und kalt, noch war kein Schnee gefallen. Die Einsamkeit der Gegend rührte mich. Dunkle, harte Erde am Steilhang. Das wenige mattgelbe, teils braune Gras rund um das Lager war zertreten. Außerdem lagen Zigarettenstummel herum, die ich gerne eingesammelt hätte.
Mir bleibt unbegreiflich, dass das alles acht Jahre her sein soll.
Ich sehe mich in meiner Erinnerung, wie ich mich dem Lager nähere, das ich einige Wochen später zum letzten Mal betreten sollte. Unweit davon waren Reste eines Belags zu sehen, der von einer Anfahrtsstraße aus der anderen Richtung, vom Wald her, übrig geblieben war. Der Eingang zur Halle war offen, ich konnte im Näherkommen hören, dass im Inneren etwas vorging. Das gesamte Äußere des Gebäudes war Relikt: Stahlgerüst, dreckiges Mauerwerk aus Ziegeln, die Glasscheibe neben dem Eingang herausgebrochen, allesamt Anzeichen dafür, dass hier seit Längerem nichts produziert, gelagert oder verarbeitet wurde, dass es sich also um eines der vielen Lager nahe unserer Stadt handelte, die nicht mehr in Betrieb waren. Meine Annahme bestätigte sich, als ich die Halle betrat. Das Innere war nicht so groß, wie ich gedacht hatte, es wirkte auf den ersten Blick chaotisch. Der Boden betongrau, da standen ein Ohrensessel, drei Kleiderständer, zwei Schminktische mit Spiegeln, dazwischen Holzstühle und Holzbänke. Zwischen diesen Gegenständen wuselten Menschen umher. Die Trennung von Zuschauerraum und Bühnenanlage war bestenfalls angedeutet durch ein paar staubige zusammengezimmerte Bretter, und wären nicht Leute auf den Brettern gestanden, hätte ich nicht einmal diese Andeutung erkannt.
Ich sehe mich, wie ich in der Halle stehe und schaue: mit einem sofort einsetzenden Gefühl der Verbundenheit. Wahrscheinlich empfand ich mich dem schäbigen Raum, der mehr Baracke als Institution war, und den Leuten, die herumstanden, zugehörig, weil ich alles dort als meines zu erkennen glaubte. Die Abläufe waren mir bekannt, mir war, als würde ich nicht die anwesenden Menschen sehen, sondern nur mir vertraute Tätigkeiten. Es wurde geprobt: Eine ältere Frau schlug sich erst gegen die eigene Brust, dann gegen die Brust ihrer Nachbarin, beide taumelten, warfen sich aufeinander, ließen voneinander ab, eine ging in die Knie, die andere zog sie hoch, und sie wiederholten alles, mit kleinen Abweichungen – ein Stupsen statt des Schlagens oder ein Zurückreißen statt des Wegstoßens. Daneben hüpften vier andere herum, und hinter ihnen lasen zwei einander zuflüsternd etwas vor.
Ich hatte bereits gelesen, dass sie ihre offenen Proben zum Happening erklärt hatten, sie übten, arbeiteten und diskutierten in einem durch. Das wunderte mich nicht, sie hatten ohnehin keine getrennten Räume, weswegen die Lese- und Spielproben und auch die Besprechungen ineinanderfielen. Es erstaunte mich allerdings, wie viele sie waren, wie voneinander unabhängig ihr Spiel wirkte und wie wenig Abgestimmtheit ich auf den ersten Blick erkennen konnte. Die Leute, die ich zu sehen bekam (manche hörte ich nur, weil sie hinter Gegenständen oder Tüchern versteckt blieben), reagierten nicht aufeinander, wie voneinander abgekapselt. Dazu das andauernde Gemurmel, die Repetitionen und der Gesang, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und Lautstärke. Ein jüngerer Mann hatte sich ein Gebüsch aus Kabeln gebastelt – eine Pose, in der ich ihn, Edwin, später oft sehen sollte. Wenn er sein Pult bediente, gingen Lichter in der Halle an und aus oder eine rote Leuchtschrift begann zu blinken. Ich betrachtete eine Zeit lang die kleine, gebretterte Bühne. Im Grunde war es bloß ein Podium, eher für Vorträge und Reden geeignet als für Aufführungen. Mehrere Menschen drängten sich darauf, spielten und diskutierten – eine weitere Situation, die sich später häufig wiederholen sollte.
Jemand rempelte mich von hinten an und lachte auf (richtig, Nikos ständiges Lachen). Eben noch hatte die Truppe auf der Bühne debattiert, nun wurde es leise. Eine junge Frau drehte sich zu mir um, sie kam mir sogleich bekannt vor. Heute weiß ich, es war die Geste, mit der sie, mich fixierend, skeptisch, eine Strähne über ihre Schulter zog, um danach in Brusthöhe daran herumzuflechten, die mich an etwas erinnerte. Das Gewusel und Gerede hob wieder an, nachdem ich »Hallo!« und »Lasst euch nicht stören!« gerufen hatte. Nur der Blick dieser langhaarigen Frau verunsicherte mich, denn er blieb auf mir ruhen, auch als andere schon aufgehört hatten, sich für mich zu interessieren.
Laura, denke ich heute, Laura und ihre Haarsträhnen, mein erster Eindruck dieser Frau (ein irreführender).
Allgemein überraschte es niemanden, dass ich gekommen war, zu den wenig Überraschten gehörte Niko, der Lachende, der mich angerempelt hatte. Er war es, der mich ansprach, retrospektiv würde ich, da ich ihn besser kenne, sagen: aus Höflichkeit. »Erstmals zu Besuch?«, fragte er, und ich nickte. Gleich darauf nahm er mich am Arm, zog mich zur Bar, die sie in einem Eck der Halle eingerichtet hatten, auch das, so bin ich mir sicher, weil er sich gastfreundlicher zeigen wollte als die anderen, die in ihre Arbeit vertieft blieben. Niko, der, wie ich später verstehen sollte, alles auf seinen Schultern trug, ohne es jemanden merken zu lassen, Niko, der gelegentlich eingreifende, immer freundliche Gastgeber, dessen Ruhe die immer gleiche, widerständige Zähigkeit in sich verbarg.
Im Gehen versuchte ich mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Die Bar, auf die wir hinsteuerten, war ein erster Anhaltspunkt, daneben erkannte ich zwei Garderobenständer, auf denen weiße Kittel mit roten Flecken hingen, dahinter lag ein Berg Plastikknochen. Auch die zwei Schminktische und den Ohrensessel in senfgelbem Bezug sah ich im Vorbeigehen aus der Nähe und bemerkte, dass sie alt und schlecht lackiert waren (heute stehen sie in meiner Werkstatt). Es wurde weitergeprobt, während der Mann aus einem Kühlschrank, der keine Tür hatte, zwei Flaschen herausnahm. Da er sich dafür weit nach unten beugen musste, konnte ich unter dem Wollpullover, der sich verzog, seine nackten Rippen und den starken Oberkörper erkennen. Ein Arbeiter, dachte ich unwillkürlich, und ganz unrecht hatte ich damit nicht. Er erhob sich wieder, öffnete beide Flaschen, stellte sich mir vor, wieder lachend, und reichte mir eine (wie andere Menschen Visitenkarten anbieten). Das Bier schmeckte lauwarm und schlecht. Der Kühlschrank war nicht an Strom angeschlossen, alle Steckdosen in erreichbarer Nähe bereits belegt.
Ich wollte mich anstandshalber für das Getränk bedanken, aber er kam mir mit einer Frage zuvor, ganz rundheraus, wie er auch später immer sein würde. Er wollte wissen, für wen ich arbeitete. Ihn interessierten Details, welche Tätigkeit, welche Produktionen, schon waren wir in ein Gespräch verwickelt. Es dauerte nicht lange, dann stellte ich meine erste Frage, die jemand anderes in ihrer Direktheit als unhöflich hätte auffassen können, er aber nahm sie gelassen: »Wer finanziert euch?«, wollte ich wissen, weil ich nach dem begonnenen Gespräch, das sich von Anfang an so angenehm konkret anfühlte, das Gefühl hatte, ihn alles fragen zu dürfen, mehr noch, ihn gerade etwas Unpassendes fragen zu müssen, als ein Zeichen der Zugehörigkeit.
»Das zahlt genau niemand«, antwortete er ohne Zögern und ohne Spur von Gereiztheit oder Verärgerung.
Wir redeten, wie wir später oft miteinander reden sollten, kein missverständliches Aneinander-Vorbei, sondern ein zielgerichteter Informationsaustausch.
Nach einiger Zeit unterbrach uns eine junge blonde Frau, indem sie ihn von hinten anstupste: »Wir sind hier nicht Privatsphäre, gospod komandant, stell uns vor!«, und was daraufhin folgte, war ein geradezu mechanischer Vorgang, der sich in den folgenden Stunden permanent, nur mit leichten Änderungen im Ablauf, wiederholen sollte: Ich, die ich höflich lächelnd meinen eigenen Namen ausspreche: »Veronika«, meine Hand zu einem Winken gehoben, dann mein Gegenüber, das seinen Namen nennt: »Iris«, während sie bereits jemanden herbeiwinkt und uns vorstellt, der danach noch jemanden herbeiwinkt. Wieder und wieder wurde ich vorgestellt, wieder und wieder hörte ich einen Namen, freundliches Geplauder mit Fremden, die mir ihres Berufes wegen vertraut erschienen: »Schauspielerin?«, »Kostüme?«, »Regie?«, nach Technik fragte niemand. Der Abend war insofern rege, obwohl ich mich kaum bewegte und die meiste Zeit an der Bar stand. Andauernd war jemand Neues neben mir, allerdings, das sei zugegeben, nicht bloß meinetwegen, sondern auch, weil ich neben dem Kühlschrank stand, aus dem man sich das warme Bier holte. Alles in allem entstand bei mir der Eindruck einer geübten oder gewohnten Kennenlernfreude, ein schematisches Ritual der Freundschaftlichkeit: zuerst die Begrüßung, das Willkommenheißen, dann ein kurzes Gespräch oder ein Scherz, manche schlugen mir dazu auf die Schulter, mit anderen tauschte ich bereits Nummern aus, zum Schluss dann immer ein »Bis später« und das Weiterreichen an den Nächsten oder die Nächste.
Ich verließ an diesem Abend meine Position neben der Bar nur, um zur Toilette zu gehen. Und selbst diese Toilette (die keine war, sondern bloß ein gefliester Raum im hinteren Teil der Halle) wurde für mich zu einer Kontaktzone. Dort dominierte die gleiche Improvisation wie in der Halle. Die Klomuscheln: große Löcher im Boden; der Wasserhahn: ein Schlauch, der neben zwei Heizkörpern aus der Wand hing und leckte, weswegen man sich beim Spülen jedes Mal anspritzte; und die Beleuchtung: Neonröhren im Raum, die ständig zuckten. Keine der Heizungen war an. Man stand und hockte in der Kälte, in einem boshaften, staubigen Licht, an dem unhygienischen Ort, von dem man sich zwar sofort abgestoßen fühlte, zugleich führte das distanzlose Sich-Erleichtern ohne Trennwände (mit höflich abgewandtem Kopf) zu Gesprächen, die später an der Bar fortgeführt werden konnten.
Insgesamt also: ein fröhlicher Beginn, ein leichtherziges Sich-Anfreunden, wenn zwar nicht mit allen Menschen einzeln, so doch im Allgemeinen, und mit dem Raum. Diese Offenheit, die meinerseits und seitens der Gruppe den Ton bestimmte, wirkte genauso stark auf mich wie die Einsamkeit der Gegend, als hätte das eine mit dem anderen zu tun, ohne dass ich genau verstand, weshalb.
Mich irritierte an diesem Abend nur eine Person: die Langhaarige, nämlich die für mich bis dahin noch immer namenlose Laura. Sie beäugte mich immer wieder, einmal hob sie eine Schulter in meine Richtung. Das war alles, was sie mir zunächst als Begrüßung anbot. Erst nach Stunden kam sie neben mir zu stehen, aber das führte zu keinem echten Gespräch. Ihr Blick war ein flüchtiges Lächeln voller Spott, während sie ihre Hand zu mir ausstreckte. Als wolle sie sich gar nicht vorstellen, sei allerdings dazu gezwungen, seufzte sie ihren Namen in meine Richtung, wobei aus diesem Seufzen sogar ein Gähnen wurde, wie eine beabsichtigte Reaktion der Gleichgültigkeit mir gegenüber. In der Erinnerung sehe ich auch diesen Moment – wie viele andere – nicht isoliert, sondern ich sehe ihn, wie man den Inhalt übereinandergelegter Folien sieht: gedoppelt, als ob nur ein wackeliger, zweideutiger Blickkontakt mit dem Gesehenen zustande kommt. Da ist einerseits die fremde Frau, wie sie an diesem Abend unseres Kennenlernens vor mir steht, den Kopf schief gelegt, eine lange Strähne zwischen zwei Fingern, ihre nahezu herablassende Begrüßung, unsere einander wie nebenbei gereichten Hände, die beiläufige Nennung ihres Namens, dann ihr rasches Weggehen. Niemand hätte mir so nebensächlich erscheinen können in jenem Augenblick.
Und zugleich sehe ich sie, Laura, wie sie wenige Wochen später im selben Raum steht, unweit der Bar, an der sie mir so beiläufig die Hand gereicht hat, jetzt aber eine Laura, die von allen Seiten umworben, mehr noch: belagert dasteht, Interviews gibt, diese abbricht, ein anderes Gespräch wieder aufnimmt, auch dieses abbricht, weil von der nächsten Umarmung, den nächsten Gratulationen unterbrochen, oder weil jemand ihr Blumen überreicht, langstielige Rosen, rote, gelbe, weiße, Laura, die in eine Kamera lächelt, grimmig schaut, wieder lächelt, von ein paar für die Kameras posierenden Schauspielern umgeben, Laura, der man einen Eimer bringt, in den sie mit gleichgültiger Geste die Blumen hineinwirft, Laura, die Hände schüttelt, wie sie meine geschüttelt hat, von Zivilbeamten umstellt und von Mikrofonen und Aufnahmegeräten umringt, ja, keineswegs nebensächlich. Jene Laura, die heute noch, acht Jahre später, Schlagzeilen macht.
Damals aber, an meinem ersten Tag im »Theater auf Lager«, war sie nur eine kurze Irritation, vielleicht ein wenig rätselhaft, weil ihr Spott mich verwirrte. Nach der unauffälligen Begrüßung und ihrem ebenso unauffälligen Verschwinden beachtete ich sie kaum weiter.
Das war bereits gegen Ende des Abends. Edwin, ganz der beschäftigte Arbeiter, der er auch später immer sein würde, drehte gerade eine rote Leuchtschrift und die paar Scheinwerfer ab. Ich bemerkte, dass in der Halle die gleichen Neonröhren wie jene auf der Toilette installiert waren, die wegen der Bühnenbeleuchtung nicht eingeschaltet gewesen waren. Sie dienten als Arbeitslicht, das nur ein Ziel kannte: alle krank aussehen zu lassen, damit sie den Raum rascher verließen.
Natürlich hatte ich Edwin im Laufe des Abends immer wieder beobachtet, um zu vergleichen, ob er anders mit den Möglichkeiten des Lichts umging als ich. Niemand außer ihm schien etwas mit Technik am Hut zu haben, so blieb mir nichts anderes übrig, als ihn für meinen einzigen Kollegen zu halten. Er war mir als jemand aufgefallen, der sich gerne abseits hielt, immer in seine Arbeit vertieft.
Umso mehr überraschte es mich, als er sich neben mich auf einen Hocker an der Bar schwang, mir sein Bier zum Anstoßen hinhielt und meinte: »Du bist vom Stadttheater, hört man«, das Klirren unserer Flaschen, »Auf Betriebsspionage?«
Ich verzieh ihm den Scherz (später sollte ich ihm seine Beleidigungen schwerer verzeihen). Wir unterhielten uns, und er war im Gespräch genauso, wie er beim Arbeiten gewirkt hatte: konzentriert. Ich erklärte ihm, weil ich diese Ruhe für ernsthaftes Interesse hielt, offen, wie ich es Niko gegenüber gemacht hatte, dass unsere Intendantin mich und andere einen Solidaritätsbrief hatte unterschreiben lassen, der morgen in der Zeitung abgedruckt werden sollte. Aus seiner Reaktion darauf, er wirkte nicht überrascht, machte weitere ironische Bemerkungen, verstand ich, dass sie das alle längst wussten. Und ich verstand auch: Man kannte Magda hier (was ich mir hätte denken können), aber mochte sie offenbar nicht (was ich mir ebenfalls hätte denken können).
Gespräche mit Edwin, das sei gleich gesagt, waren zu Beginn wirklich kein entspanntes Unterfangen. Ich sehe uns, wie wir vom ersten Kontakt an in einem Ungleichgewicht waren: Während ich ihm bereitwillig von meiner Arbeit als Bühnentechnikerin erzählte, antwortete er auf meine Fragen nach den technischen Möglichkeiten im Raum nur knapp, unwillig. Es bestätigte sich im weiteren Gespräch immer mehr, dass es ihnen an fast allem fehlte, was ein professionelles Theater haben sollte. Darum bastelte er zum Beispiel vieles selbst, Kabel, Farbfolien, Blenden und Röhrchen, und zwar mit Entschlossenheit und großer Lust. Ich kannte das zwar von mir, aber da es im Stadttheater nie Gelegenheit gab, Selbstgebautes einzusetzen, war dieses Basteln eine Leidenschaft, die ich mir fürs Private aufhob. An diesem Abend war er gerade dabei, eine Installation aus Flaschen und Blech zu montieren. Das rührte mich. Es gab keine gut geplante Lichtgestaltung im Raum, oder nur Ansätze davon: die unfertige Installation, die rote Leuchtschrift, ein paar Scheinwerfer. Mir war klar, man bewertete hier Erfolg nach ganz anderen Kriterien als jenen, die ich gewohnt war: Um Perfektion konnte es nicht gehen, schon die bloße Durchführung war eine Leistung.
Es bestätigte sich im Gespräch auch nochmals, dass ihre gesamte Arbeit unbezahlt war, und über diesen Punkt zerstritten wir uns beinahe (ich kenne nicht viele Menschen, mit denen man sich beim ersten Gespräch zerstreiten kann, das war Edwin at his best). Ich erinnere mich nämlich, ihn ohne böse Absicht und mehr aus Bewunderung denn aus Herablassung gefragt zu haben, wovon er denn all das bezahle. Woraufhin er laut wurde, was die anderen auf uns aufmerksam machte, die sich einmischten, sobald sie mitbekamen, dass wir von Geld sprachen (oder: vom Bankrott). Es würde nicht das letzte Mal sein, dass ich sie darüber reden hören sollte. Ich kann nur die starken Sager rekonstruieren, nicht die Details der folgenden Diskussion, viele stammten von Edwin, aber es war jene Schauspielerin, die sich bei mir als Iris vorgestellt hatte, die als erste ein paar Bemerkungen über den Fetisch Kunst im Kapitalismus machte. Daraufhin argumentierten plötzlich alle wie wild geworden durcheinander: Im Zeitalter des Kapitals sei die Lohnarbeit das Schlachtfeld, auf dem die gesellschaftlichen Konflikte ausgetragen würden – es sei darum Aufgabe der Kunst, dieses Feld zu zerstören – aber ein Feld zu zerstören, hieße, sich dennoch darin zu bewegen – was wiederum – der Warencharakter der Kunst – ein Witz ohne Pointe – gerade das sei doch variabel – und die Arbeit? Die Mehrarbeit? – das Verhältnis von Wissen und Tun? – Kunst als Mehrarbeit als Anti – weshalb, es sei doch heute jeder antikapitalistisch, nur eben auf die Art, wie jeder demokratisch sei: ohne Vorstellung – Kunst als transformiertes Kapital, nicht aber transformierte Arbeitskraft – und Selbstausbeutung als vorauseilender Gehorsam jener, die aufgeben – nicht doch, als der letzte mögliche Widerstand – und noch einmal: das Verhältnis von Widerstand und Wissen?
Ich hatte das Gefühl, das sei eine schon lange währende Debatte, die sie immer wieder führten, um vor sich selbst ihren schockierenden Enthusiasmus zu legitimieren. Und da sich solche Gespräche in den folgenden Wochen häufen sollten, sind sie mir in der Erinnerung zu einer einzigen langen Diskussion verschwommen, die außerdem immer, wenn ich an sie zurückdenke, überschattet bleibt von dem Bild eines Spezialtransporters, aus dem wenige Wochen später mehrere Männer schwere, braune Kartons auf ihre breiten Rücken heben und in die Halle tragen sollten. Und auch dieses Bild ist wiederum von der Ansicht eines an die Decke des Lagers stoßenden bauchigen Nebels überdeckt, von meinem Starren in ein weißes sirrendes Loch.
An jenem Abend blieb der sich andeutende Streit jedenfalls höflich, es wurde gepfiffen und gelacht, kein echter Konflikt, im Grunde ein fröhlicher Disput unter Freunden. Man vergnügte sich, und es wurde spät. Die Letzten begannen gegen Mitternacht nach Hause aufzubrechen oder verabredeten sich in einem Nachtkaffee in der Innenstadt, ich denke, es war das »Flamingo«.
Ich stand noch eine Zeit lang da, wie ich später oft dastehen würde: an die Bar gelehnt, ein Bier in der Hand, neben jemandem, der auf mich einredete. In diesem Fall Edwin, der einer der Letzten im Raum war. Von den vielen Menschen, die ich am Anfang herumwuseln gesehen hatte, waren nur er und zwei Schauspielerinnen übrig. Die beiden unterbrachen ihn und fragten mich, ob ich mit dem Auto gekommen sei. Ich versprach, sie in die Stadt zu bringen. Edwin lehnte meinen Vorschlag ab, auch ihn mitzunehmen. Er war für den Wachdienst in der Halle eingeteilt. So lernte ich noch etwas an diesem Abend, nämlich, dass er als einziger aus der Gruppe über Nacht im Lager blieb, einerseits um auf alles, was sie bislang dort angehäuft hatten, aufzupassen, und andererseits, weil er nicht nach Hause wollte.
Draußen fiel mein Blick wieder auf die Zigarettenstummel, die vor der Halle verstreut waren. Daneben lagen jetzt ein paar zerschnittene weiße Schutzanzüge voller roter Flecken. Eine der Schauspielerinnen, die ich mitzunehmen versprochen hatte, war Iris, und sie fragte mich, während wir den Hang hinauf zu meinem Wagen kletterten: »Was bringst du uns morgen mit? Als Einstandsgeschenk?«
Sie lachte dabei laut, in hohen, sich hochschraubenden Tönen, ein Lachen, das ich später in vielen Varianten kennenlernen sollte, wobei jede dieser Varianten der vorangegangenen zum Echo wurde, das sich über Wochen hinweg zu einem zusammenzufügen schien: Da war das Kichern vor dem Anlegen des Lippenstifts oder dem Öffnen einer Puderdose, das kreischende Auflachen nach dem Zupfen der Augenbrauen mit der Pinzette, das Gelächter beim dritten Sektglas, der triumphale Jubel nach der Premiere. Das Lachen einer Frau, die mir im Rückblick zu einem noch größeren Rätsel als Laura wurde, gerade weil an ihr, Iris, wenn man sie kennenlernt, vorerst gar nichts rätselhaft zu sein scheint. Es ist kein Zufall, dass gerade diese beiden Frauen am häufigsten auf jenen Fotos zu sehen sind, die man den Berichten über das »Theater auf Lager« hinzufügt.
Ich erinnere mich: Nach diesem ersten Lachanfall, den ich erlebt hatte, folgte eine lange Atempause, und daraufhin ihre plötzlich scharf gestellte Frage: »Bringst du Blutkapseln?«
Da machte ich mir das erste Mal Gedanken über das Theaterstück, das sie aufführen wollten, und stellte fest, dass ich nichts darüber in Erfahrung gebracht hatte.
LINA UND LEOPOLD
Manuskript (Laserdruck auf Papier, s/w, einseitig, annotiert)
Ein Stück des »Theater auf Lager«
In der Regie von Michael Baugruber und Gisela Kattnig
Raumgestaltung: Niko Koschutnig
Technik und Lichtdesign: Edwin Tolmaier
Es spielen
Mateja Kippner als LINA RENDE
Iris Kertschnig als PETRA NEUHAUS
Franz Vogl als GERHARD (GERTSCHI) OBERBAUER
Roswitha Karner als MANAGEMENT 1 und
RENATE (KOLLEGIN)
Hannelore Werner als MANAGEMENT 2
Samuel Köhler als MANAGEMENT 3
Hans Gerd als HANSI (KOLLEGE)
Gustin Moll als GUSTAV (KOLLEGE)
Ludwig Malleg als LEOPOLD RENDE