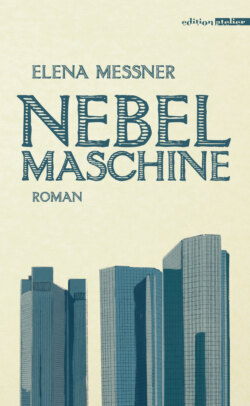Читать книгу Nebelmaschine - Elena Messner - Страница 6
II.
ОглавлениеDie meisten aus der Gruppe werden sich noch daran erinnern, dass ich bereits am folgenden Tag wieder bei ihnen vorbeischaute, und sie werden sich auch daran erinnern, dass an diesem Tag die Wochenendausgabe der Regionalzeitung voll war mit Artikeln über sie. Es hatte sich in der Stadt herumgesprochen, was das »Theater auf Lager« war, was es sollte und versprach, wogegen es antrat, wie es zustande gekommen war. Es hatte sich zudem einiges andere herumgesprochen. In der Provinz sammeln sich Gerüchte und Falschinformationen, Verschwörungen und Geheimnisse rasch an, es wird enthüllt, wo es nichts zu enthüllen gibt, aufgedeckt, wo bereits aufgedeckt wurde, und zum Skandal erklärt, was keiner ist. Die Berichterstattung über das, was bei uns unter der Rubrik Kulturelles läuft, bleibt davon nicht verschont, und so wurde das neue Theaterensemble, dem von seiner Gründung an etwas Umstrittenes, Undurchsichtiges anhaftete, gerne besprochen. Außerdem war Magdas Solidaritätsbrief nicht der einzige, der erschienen war. Die intellektuelle Öffentlichkeit gab sich partnerschaftlich, es gab eine Welle an Unterstützung (in Worten, nicht in Taten oder Geld).
Als ich in der Lagerhalle ankam und die gleiche Anzahl der Biere, die ich am Vortag getrunken hatte, in den Kühlschrank stellte, wurde ich freundschaftlich begrüßt und von mehreren dazu aufgefordert, in Zukunft regelmäßig vorbeizukommen. Man war in der Halle damit beschäftigt, die Presseberichte zu sortieren. Es wurde gelesen, debattiert, noch einmal nachgelesen, weiter debattiert, sogar gepfiffen und ausgebuht. Niko, der, wie ich verstanden hatte, in der Gruppe die Rolle des Gastgebers innehatte, wollte den offenen Brief, den »die Mazur«, wie sie Magda nannten, verfasst hatte, vorlesen lassen. Edwin hatte über Nacht seine Installation aus Pfandflaschen fertig montiert, die hing den Lesenden direkt über den Köpfen, als sie sich auf die Bühne stellten. Immer wieder gingen die milimetergroßen Lämpchen in dem grünen Glas an, aus, wieder an. Das Licht hinterließ farbige Spuren, nicht nur auf ihren Köpfen, sondern auch auf den aus der Zeitung kopierten Zetteln, die sie in ihren Händen hielten.
Die Stimmen der Lesenden, unterbrochen von Lachen, Klatschen und Rufen, verkündeten zunächst den Titel des offenen Briefes: »Aufruf zur Solidarität«. Den Text, der dann folgte, kannte ich fast auswendig, Magda hatte ihn mir mehrfach vorgelegt, mich zunächst um Feedback gebeten, dann mit Pflichtmiene um Unterschrift. Er enthielt die Erklärung, dass vor zwei Wochen die Landesregierung verkündet hatte, den Etat der Schauspielensembles des Bundeslandes zu kürzen. Bleibt zu sagen: Die Summe, um die es ging: ein paar Hunderttausende Euro. Vergleichsweise also nichts, wenn man bedachte, dass die Landesverschuldung zu jenem Zeitpunkt bei neunzehn Milliarden lag, und wenn man außerdem bedachte, dass dies dem Zehnfachen des jährlichen Landeshaushalts entsprach. Die damalige Situation lässt sich auf eine einfache Formel bringen: Die Politik hatte für die landesweit größte Bank gebürgt, die in mehrere Spekulationsskandale verwickelt gewesen war, deren Ausmaße zum damaligen Zeitpunkt kaum jemandem klar waren (oder doch? Man weiß ja kaum, wer wann zu Wissen gelangt). Allerdings ging diese Bürgschaft bereits als ein boshaftes Zukunftsgespenst um, ein toxisches Versprechen, das aus Nichts gemacht worden war, aber keine Nichtigkeit bleiben sollte.
Im offenen Brief fehlte fast alles, was einen Zusammenhang dieser Bürgschaft und ihren Folgeschäden herstellte, obwohl gerade auf diese Folgeschäden, auf die Verwicklungen, die sie verursacht hatten, wiederum die Reform oder, wie Magda es im Brief nannte, die Abschaffung der Kulturpolitik zurückzuführen war. (Und das sieht man nicht erst retrospektiv so, das hatte dereinst auch Magda so gesehen; sie hatte es mit mir genau so besprochen, aber dann bewusst nicht in den Brief aufgenommen.) All das erhielt im Brief nur kurze Erwähnungen: die Bank als Zockerbude, Kredite als Halsbruch, Verschuldung und Milliardengrab. Stattdessen wurde ausführlich beschrieben, dass die Brauchtumsvereine beziehungsweise ihre den performativen Künsten kaum zuzurechnenden Faschingsumzüge und Volksfeste von den Kürzungen verschont geblieben seien. Ebenso verschont geblieben war als anerkannte Kulturinstitution das Stadttheater. Wogegen freilich nichts zu sagen sei, schrieb Magda, Intendantin ebendieses Stadttheaters, schlimm aber sei es, die kleineren Bühnen zu bestrafen: Der Umfang der Kürzungen sei für die von staatlicher Finanzierung übergangene freie Szene so hoch, dass er sich durch Kartenverkauf nie mehr ausgleichen ließe. Dies bedeute für kleinere Ensembles des Landes zumeist das Ende, und dies wiederum bedeute eine Kampfansage, mehr noch, einen Vernichtungsschlag der Landespolitik gegen die Landeskultur.
Ich weiß noch, dass mir der Text, an dem ich mitgearbeitet hatte, während er öffentlich vorgelesen wurde, bissig und fremd erschien. Zudem wurde das Vorlesen zu einem Desaster: Man kam durcheinander, wiederholte zu oft, las unterschiedlich schnell, stolperte über die erste Formulierung, dann die zweite und dritte, fand keinen gemeinsamen Rhythmus, keine gemeinsame Linie. Da hieß es sechsmal, die Sparbeschlüsse seien eine Verrohung und Bedrohung des Landes, es hieß dreimal, sie gefährdeten die Existenz und die Freiheit von Kultur, fünfmal, sie beschmutzten das Ansehen des Landes. Dabei passte die Körperhaltung der Menschen auf der Bühne nicht zum Gesprochenen, als ob sie sich dagegen zu wehren versuchten. Ein Mann zum Beispiel, den ich bei den Bargesprächen des Vorabends als still und aufmerksam erlebt hatte (er sollte später den Gerhard Oberbauer spielen, diese unglückselige Gertschi-Figur), ein Mann jedenfalls, dessen feste Schultern ich erinnere, ohne dass mir sein Namen einfällt, krümmte sich beim Lesen übermäßig stark, und was an diesen Schultern zunächst zuverlässig gewirkt hatte, wurde mit jedem ausgestoßenen Ruf weniger und weniger kräftig, er nahm sich zurück, versteckte sich fast, obwohl das Vorgelesene gerade das Gegenteil verlangt hätte. Auch die Jüngste unter ihnen, jene Mateja oder Marjeta, die mir bei den Proben später als schüchtern gespielte Lina immer wieder auffallen sollte, verrenkte sich unbeholfen, während sie vorlas. Als wären ihr die Sätze peinlich oder als stünde sie nicht hinter dem Gesagten: »Retten wir die freien Schauspielhäuser, denn wir Freundinnen und Freunde der Kunst sind fassungslos, dass so etwas in unserem Land möglich sein soll.«
Am ärgerlichsten war Laura, die mit halb geschlossenen Augen vom Blatt las, ungerührt lächelnd, ironisch wohl (natürlich ironisch, ja sarkastisch sogar, denke ich heute, und es wundert mich, dass sie beim Vorlesen überhaupt mitgemacht hatte), genau wie bei unserer ersten Begegnung, als sie mir ihren Namen hingeworfen hatte, ihr übertriebener Tonfall war schwer auszuhalten, sie dehnte die Laute, leierte mehr, als sie las, ihr Blick drückte Herablassung aus: »Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass einige der innovativsten jungen Theater so massive Einschnitte durch eine kurzsichtige Sparpolitik erfahren, und werden daher mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diesen Kulturabbau vorgehen.«
Das Dumme daran: In dem Raum gab es plötzlich einen Überschuss an Protest, der lächerlich wirkte. Tonfall und Syntax waren, wie es so heißt, völlig daneben, eine Inszenierung für die Katz. Es dauerte seine Zeit, bis sie einen einheitlicheren Rhythmus fanden. Erst, als die Leute jene Passagen vortrugen, in denen erklärt wurde, dass einige Wochen nach Bekanntwerden der Sparbeschlüsse sich eine Bewegung formiert und zum »Theater auf Lager« zusammengeschlossen hatte, sprich: erst, als von ihnen selbst die Rede war, hörten sie sich wieder einstimmig und überzeugt an, ohne Wiederholung, ohne Überlappung, ohne Übertreibung: »Das Ensemble hat seit dem letzten Wochenende angekündigt, sein Lagertor und die Proben offen zu halten. Es lädt alle Interessierten ein, vorbeizuschauen. Wir werden da sein. Kommen auch Sie!«
Ich war froh, als das Ganze vorbei war und alle die Bühne wieder verließen. Wie erwartet wurde der Brief an dem Abend zum meistdiskutierten Thema. Es war das erste Mal, dass jemand in einem größeren Medium auf das Theater und seinen Protest hingewiesen hatte. Kein anderer Artikel, keine andere Nachricht oder Wortmeldung in der Presse berichtete genauer über die Sache. Das löste Freude, sogar Begeisterung bei manchen aus. Andererseits habe ich Uneinigkeiten und böse Witze in Erinnerung. Ein paar Szenen empfand ich sogar als angespannt, obwohl ich damals nicht verstand, weshalb. Ich sehe zum Beispiel: wieder die Bar, an der ich stehe und mit einem mir zugeneigten Niko rede, der Whisky oder Wodka trinkt. Die Kommentare, die er abgibt, sind aufmerksam, im Grunde sind wir uns zwar politisch einig, aber ich formuliere meine Meinung ernsthaft, er nur in beschwichtigenden Witzen, mit einem Lachen, das mich beruhigt. Oder ich sehe: noch einmal die Bar, vollgeräumt, der Kühlschrank, leergeräumt, eine Frau grinst mich an, fragt, ob ich alles alleine getrunken hätte und ob ich das am Stadttheater gelernt hätte. Ich sehe auch: Niko, der zu später Stunde auf die Bühne springt, sich bei mir bedankt, Zwischenrufe ignorierend, aber ein Niko, der (was mir bloß aus heutiger Sicht auffällt) weder das Stadttheater noch Magda erwähnt. Ich sehe: Laura, die von einem zum anderen eilt (ich wusste damals nicht, dass sie wie ich zu dem Zeitpunkt erst das zweite Mal im Lager gewesen war). Ich sehe: Iris und zwei Schauspielerinnen, wie sie ihre Köpfe zusammenstecken, während Niko auf der Bühne meinen Namen nennt und auf mich deutet, derweil steht ein Fotograf neben mir und fragt, ob er mich abbilden darf und ob ich ihm mein Einverständnis gebe, die Fotografie an seine Redaktion weiterzuleiten. Ich sehe: mich, die damit einverstanden ist, die Niko zu sich winkt, und ein paar andere, sehe uns umstellt von Leuten, die sich über den Fotografen, oder über uns, die Fotografierten, lustig machen. In dieser Stimmung entstand das Foto, das im Internet manchmal aufploppt, wenn rückblickend über die frühe Phase des »Theaters auf Lager« geschrieben wird. Aber das geschieht selten: Das Ende interessiert, nicht der Anfang.
Wenn ich an weitere Eindrücke zurückdenke, die diese Stunden bei mir hinterlassen haben, sehe ich indessen vor allem eines: mich, als Technikerin, die den gesamten Abend nur eines im Kopf hat: das Licht. Ich sehe, wie die Halle ständig ihre Farbe wechselt, was sonst kaum jemandem auffällt, sehe, wie immer neue Zonen im Raum entstehen, sobald sie ausgeleuchtet werden, einmal die Bühne, dann die Bar, dann der Zuschauerraum. Ich sehe mich, wie ich Edwin beobachte, der sich hinter seinem Lichtpult versteckt, dann hervorkommt, um etwas zu verkabeln, umzustecken, an Dimmern zu drehen und wieder zu verschwinden. Ich weiß noch, dass ich es interessant fand, welche Effekte er trotz des Mangels an echtem Gerät und Material erzeugte, und dass ich darüber nachdachte, was ihm mit seinem Talent alles möglich wäre, wenn er die volle Ausrüstung und den gesamte Apparat unseres Stadttheaters zur Verfügung hätte.
Ich sehe mich außerdem nach Stunden des Beobachtens und Beurteilens die Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm ergreifen: Als er versuchte, einen Beamer aufzuhängen, und ein Lichtkegel halb an einer Seitenwand, halb am Boden aufleuchtete, schmuggelte ich mich zu ihm hinter das Pult und begann ihm Ratschläge zu geben. Er fragte nur einmal etwas nach, ich erklärte, er arbeitete wortlos weiter, und bevor es zu leidigem Schweigen kommen konnte, fragte ich ihn nach seiner Ausbildung, ein wenig aufdringlich, aber es interessierte mich, ob er unseren Beruf erlernt oder ihn sich selbst beigebracht hatte. Seine Antworten blieben ausweichend, die Stimme bitter, »Beleuchter bei Messen«, er schaute mich an, »Aushilfe bei Events«. Er hatte also, so nahm ich an, seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Danach arbeitete er, in die Hocke gegangen, weiter an lose gewordenen Kontakten, und ich verstand, dass er nicht gestört, nicht in ein Gespräch verwickelt, nicht von seiner Tätigkeit abgelenkt werden wollte, obwohl er noch zweimal zu mir hochsah.
Weitere Erinnerungen an den Abend: Ich sehe mich mit Iris reden, die mir bereits wie ein Schatten zu folgen begann, was ich als Freundschaftsbeweis verstand, obwohl es mich schon nach kurzer Zeit störte. Sie fand erstaunlich viele Gründe, sich wieder und wieder an mich zu wenden. Mal war es, dass sie sich einen Lippenstift leihen wollte, dann ein Taschentuch, später ein Parfum – nichts davon konnte ich ihr geben, aber das war egal, sie benutzte es ohnehin nur als Ausrede, um mit mir zu reden. Später, da ich mehrmals erklärt hatte, weder Lippenstift, Taschentuch oder Parfum zu haben, fragte sie nach Kugelschreibern oder Aspirin. Als auch das nicht mehr glaubhaft war, änderte sie ihre Strategie: Nun war sie es, die von ihrem Lieblingsplatz, dem senfgelben Ohrensessel zwischen den zwei Schminktischen, aufstand und mir etwas brachte, einen Keks, einen Kamm, ein Glas. In einem Moment nahm sie mein Telefon, tippte ihre Nummer ein und rief sich selbst danach an. Hemmungslosigkeit der Jugend. Ich erfuhr in den Gesprächen, die sie so häufig initiierte, viel über sie: Sie war keine Schauspielerin, sondern Kindergärtnerin, in Ausbildung zur Theaterpädagogin, seit Jahren leitete sie ehrenamtlich eine eigene Kindertheatergruppe, und zwar eine in Pfarrbibliotheken oder in einem Altersheim auftretende. Ausgiebig erzählte sie von den Kindern, unglaublich, wie sie spielten, wie gerne sie sich schminkten, sich verkleideten, welche Freude sie an Perücken hatten – das sei etwas anderes als mit Erwachsenen.
Seit ich von ihrer Kindergruppe wusste, beobachtete ich Iris besonders. Sie fiel mir immer stärker auf, weil ich, ihr bei den ersten Proben zuschauend, gemerkt hatte, dass sie Talent besaß. Eine zweifellos angeborene Begabung, sie hatte sich nie im Schauspiel schulen lassen. Aber sofern sie nicht auf der Bühne stand und spielte, wirkte sie kindlich, was mit ihrer Begeisterung für den ohnehin verspielten Beruf einherzugehen schien. Den Traum von den Brettern, die die Welt bedeuten, hatte sie sich auf erzieherische Maßnahmen zurechtgestutzt. Gerade weil sie begabt war, gerade weil ihre Begeisterung echt war, rührte mich das. Sie war auch die Einzige, von der ich nie ein bitteres Wort über ihr schlechtes Einkommen gehört hatte, oder über die Tatsache, dass sie ihre Leidenschaft als Nebenberuf, vielleicht weniger noch, als bloßen Zeitvertreib ausüben konnte, den sie unter dem Deckmantel einer Weiterbildungsmaßnahme vor sich selbst legitimieren musste. Dazu ihre fröhliche Verträglichkeit mit allem, was sie milde lächelnd als schwierige Umstände bezeichnete. Als passte sie ihre Worte und ihren Charakter dem rundlichen Gesicht an, immerzu satte Zufriedenheit ausstrahlend. Ihr mädchenhaftes Getue, das sie nur auf der Bühne ablegte: Sie umgab sich ständig mit den Dingen, um die sie bat, als seien diese Requisiten ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Lagerhalle: Lippenstift (braun), Puderdose (blauer Glitzer), Kamm, Pinzette, ein Sektglas, Parfum, noch eine Puderdose (goldener Glitzer) und noch ein Lippenstift (rot), ein zweites, ein drittes Sektglas, alles in allem: ladylike, selbst die leichte Trunkenheit, so gelebt, wie es sich für eine exzentrische Filmschauspielerin gehört, oder besser gesagt, wie sie dachte, dass es sich für solch eine Filmschauspielerin gehört. Es fehlten bloß: Pelz, Federhut, Spitzendessous, und sie hätte im Atelier eines Malers Modell stehen können.
Außerdem war sie anhänglich. Sie sagte mehrmals, wenn ich ihr den Rücken zuwandte, zu mir: »Bleib da!« Und wenn ich fragte: »Weshalb?«, meinte sie: »Um zu reden.« Es gab kaum etwas zu reden, oder vielmehr meinte sie mit »Reden« Palavern über Alkohol, über Lippenstifte, über ihre Flirts und love interests. Die Gespräche mit ihr waren durchsetzt von Koseformen und Diminutiven, ein dragi moj, ein moja draga hier, ein nobl možej dort, die fremde Sprache (und Zärtlichkeit) einer Zwanzigjährigen, die ich erst mit der Zeit zu verstehen lernte. Dazwischen sprach sie über den Kapitalismus, zu dem sie immer einen stichhaltigen Spruch einstudiert hatte. Mit vertrauensvoller Begeisterung platzte sie auch in fremde Gespräche, immerzu vergnügt, mit allumfassender Neugierde auf alles und jeden. Ja, sie rührte mich. Ich musste an mich selbst in meiner Jugend denken, vor der Abhärtung und Anpassung, vor der Gewöhnung an die Tatsachen, an mich auch als Kind, dem das Theater noch als Abenteuer erschien.
Das war also mein Eindruck von Iris. Ich sagte bereits: An ihr haftet nichts Rätselhaftes. Wenn man sie kennenlernt, glaubt man bereits, sie zu kennen, so typisch ist sie, man urteilt, man spottet, man ahnt nicht, dass ihr Elan und ihre Leichtigkeit, ihre unbedarfte Fröhlichkeit auch Widerstandsfähigkeit sind.
Noch eine Erinnerung: An dem Abend entstand die Antwortnotiz auf Magdas offenen Brief, die mir gegen Mitternacht jemand in die Hand gab, ich glaube, es war der Mann mit den festen Schultern, dessen Namen ich nicht mehr weiß.
Der Text war nicht lang: »Wir danken allen Kulturschaffenden«, so begann er, »die so schnell und deutlich ihre Bereitschaft zur Unterstützung demonstriert haben. Allen voran den Kolleginnen und Kollegen, die während unserer Gespräche bei der Solidaritätsfeier einmal mehr unter Beweis gestellt haben, dass der Kampf um die Kultur nicht verloren ist.«
Der Mann überreichte mir diese Nachricht, damit ich sie, wie er meinte »zur Mazur« trug, aber ich war angesichts der Knappheit der Antwort in dem Moment nicht einmal sicher, ob ich die Notiz überhaupt an Magda weiterreichen sollte.
Ich wundere mich jedenfalls, dass meine Aufmerksamkeit an jenem Abend nicht den Debatten um Briefe und Presse und Streit galt und dass ich nichts mitbekam davon, was sonst im Raum vor sich ging. Ich hatte mich von den wesentlichen Dingen ablenken lassen durch den Wodka mit Niko, die leeren Gespräche mit Edwin, das Fröhliche an Iris, die Kürze einer Notiz.
Erst am darauffolgenden Morgen, als Niko mich anrief, erfuhr ich von ihm, dass es an diesem Abend innerhalb der Gruppe zunächst zu einem Streit über Magdas Solidaritätsbrief und danach zum Beschluss gekommen war, sich nicht mehr für das sichere Alte (ein Begriff, den Niko in unserem Telefonat mehrmals wiederholte) im Repertoire zu entscheiden, sondern etwas selbstsicheres Neues einzustudieren (Worte, die er später gerne verwendete). Genauer gesagt: Ich erfuhr übers Telefon von ihm, dass sie planten, ein nigelnagelneues Stück (auch das Nikos Wort) zu verwirklichen. Seine Stimme war heiser vor Anspannung. Er hatte große Erwartungen: Ein Stück mit Bodenqualität sollte das werden, gut gewachsen und goldrichtig, hackende Schärfe in der Sprache, brutale Kargheit in der Inszenierung, Furche um Furche, die Zeitlosigkeit, die Zähigkeit und vor allem die Fruchtbarkeit des Themas, dazu das Demonstrative des Theaterstandorts (so redete Niko grundsätzlich von Kunst, aber es hörte sich bei ihm immer an, als rede er über Ackerbau).
Ich verstand nicht sofort alles. Ein flauer Sonntagmorgen, ich war gerade erst aufgewacht, noch nicht geduscht, nicht angekleidet, ungekämmt und müde, mit dem Telefon in der Hand am Rande meines Bettes sitzend. Ich erinnere mich, den Hörer sogar von meinem Ohr weggehalten zu haben. Kurz darauf Nikos Stimme wieder an meinem Ohr, etwas gefasster, weil ich ihn gebeten hatte, langsamer zu reden, danach seine vertraute, ruhigere Stimme, zwar immer noch aufgeregt, jedoch deutlich entspannter: Ja, Bodenqualität, wiederholte er, Bodenqualität hat dieses Stück, es wird zweckmäßig sein und über die Lage, die Verhältnisse, über unsere Tage berichten, über die unübersehbare Gegenwart, nicht nur die des Theaters, sondern auch die größere Gegenwart, nämlich die des Landes.
Ich erinnere mich, dass mir seine Aufregung zu viel war in dem Moment, es fiel mir schwer, etwas dazu zu sagen, so benommen war ich von seiner Begeisterung. Erst im Rückblick verstehe ich die Freude des Anfangs: Hier deutete sich tatsächlich neuer Boden an, es entstand etwas auf Brachland, und zwar etwas, das bis heute Folgen haben würde. Doch meiner Ansicht nach konnte nicht einmal er damals ahnen, wie weitreichend ihre Entscheidung sein würde.
Ich legte auf, blieb am Bett sitzen, das Telefon auf der Bettdecke, und stellte, während ich gähnend über alles, was Niko mir aufgezählt hatte, nachdachte, fest, dass mich eine Information am meisten überraschte, obwohl er diese wie nebenbei hatte fallen lassen: dass nämlich Laura das Stück geschrieben und ihnen auf Drängen eines Regisseurs zur Inszenierung überlassen hatte.
Ich sehe mich aufstehen und ins Bad gehen. Jetzt glaubte ich mir den allumfassenden Spott, mit dem sie mich und andere beäugt hatte, erklären zu können, denn mir war bis dahin in meinem Leben als Bühnentechnikerin keine einzige Theaterautorin begegnet, die nicht überheblich war. Ich sehe mich zähneputzend vor dem Spiegel über Laura als Autorin nachdenken, mit gemischten Gefühlen, die mir heute naiv vorkommen. Ich erinnere die Spiegelung der schmutzigen Bettwäsche vor meinen Augen. Zwei Eindrücke, die sich zu einem vereinen: die auf blauen Bodenfliesen zerstreute Wäsche und das Wissen um eine Laura, die Stücke schreibt. Ich konnte nicht ahnen, dass sie im Grunde keine echte Autorin war, ganz wie ihr Stück, retrospektiv gesehen, kein echtes Stück war (falls es so etwas wie echte Autorschaft überhaupt gibt, und echte Stücke).
Rückblickend kann ich jedenfalls sagen: Ich hatte nicht einmal den mindesten Verdacht, dass mir Niko in dem Telefonat irgendetwas hätte verschweigen wollen.
Seine Stimme lag mir noch im Ohr, als Iris anrief und mir ebenfalls die Neuigkeiten mitteilte. Mittlerweile war ich fertig angezogen. Sie redete zuerst von sich, von einer alten Liebschaft, dann von einem neuen Flirt, von ihrer Anfälligkeit für solche und solche Kerle, »immer das Gleiche«, lachte sie, »immer, immer, immer das Gleiche mit mir und den Männern«, ich wunderte mich, dass mir jemand, den ich kaum kannte, so viel von sich erzählte. Danach berichtete endlich auch sie vom Stück, und zwar im gleichen Tonfall wie davor von der Liebschaft. Von nun an, so meinte sie, werde das Theater von Unnötigem befreit bleiben: Dieses Stück würde mit wenigen Requisiten, nein, nicht mit wenigen, so holte sie aus, sondern fast ohne produziert werden. Das hatte mir bereits Niko erzählt, und es kam mir (obwohl ich es den beiden gegenüber nicht erwähnte) weniger als eine freie Entscheidung vor, sondern vielmehr als die notwendige Konsequenz aus dem Mangel an Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen.
Iris lud mich, wie auch Niko es getan hatte, für denselben Nachmittag noch ins Lager ein. Es sei wichtig. Und zwar erstens wichtig, weil sie mir den Flirt zeigen wollte, der da sein würde, weil zweitens eine Pressekonferenz geplant war und weil drittens die erste offene Probe zum neuen Stück abgehalten werden sollte.
»Jetzt kannst du deine Solidarität zeigen«, sagte sie (was ich nicht kommentierte).
Sie berichtete mir auch, und das überraschte mich dann doch, dass sie von nun an ihren gesamten Jahresurlaub in Anspruch nehmen würde, um die nächsten Wochen am neuen Stück arbeiten zu können. Ich fehlte ihr, fügte sie danach hinzu, und zwar wieder in dem Tonfall, den sie mir gegenüber seit unserem Kennenlernen angeschlagen hatte. An jeden Satz hängte sie auch diesmal ein meine Süße an, oder meine Liebe, und wenn sie unkonzentriert war, wurde daraus ein draga moja, ljubica moja, weil sie vergessen hatte, dass ich sie nicht verstand. Ich frage mich, ob sie mich wirklich mochte oder ob sie mit allen so redete, weil sie auch das als charakteristisch für die Art von Schauspielerinnen empfand, zu denen sie gezählt werden wollte.
Ich zögerte lange, ob ich in die Halle fahren sollte. Schuld daran war nicht Iris, sondern das Wetter. Es zog Nebel auf, er durchfeuchtete die Erde, und ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie er den durchlässigen Boden des alten Lagers verwandeln würde.
Ich sehe mich durch meine Wohnung gehen, zunächst in die Küche, von der Küche zum Bett zurück, von dort wieder zurück in die Küche, an den Tisch, den ersten Kaffee trinkend, dann den zweiten. Ich weiß noch, dass ich lange auf den Topf Sauerkrautsuppe starrte, den ich spätabends aus dem Tiefkühler gestellt hatte, damit er über Nacht auftaute. Es schwammen Eisbrocken darin. Nur schwer entschloss ich mich nach dem dritten Kaffee, zu ihnen zu fahren, durch eine Landschaft, die mich deprimierte. Ich hatte aber abgewogen: Alleine zu Hause zu bleiben, noch dazu nach solchen Meldungen, erschien mir letztendlich nicht besser. Ich wollte wissen, was das für ein Stück sein sollte, das Niko und Iris so sehr in Begeisterung versetzt hatte. Ich muss auch zugeben: Neue Dramen, noch dazu von Frauen verfasste – davon gab es nicht viele an meinem Theater, daran hatte auch Magda, seit hundertfünfzig Jahren die erste Frau an der Spitze unseres Hauses, nichts geändert.