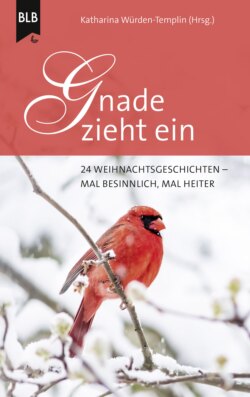Читать книгу Gnade zieht ein - Elisabeth Büchle - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеO du fröhliche
von Katharina Würden-Templin
Es war im November des Jahres 1813 in Weimar. Johannes und Caroline Falk standen auf dem Friedhof der Stadt und trockneten immer wieder ihre Tränen. Vor ihnen klaffte ein Loch in der Erde, daneben stand ein kleiner Holzsarg.
Nur ein paar Wochen zuvor hatten Napoleons Truppen bei Leipzig eine katastrophale Niederlage gegen die Alliierten Preußen, Russland, Österreich und Schweden einstecken müssen. Auf dem Rückzug plünderten die hungrigen französischen Soldaten sämtliche Städte, die auf ihrem Weg lagen – so auch Weimar. Doch mit den Soldaten kam auch Typhus in die Stadt, den die Menschen Nervenfieber nannten. Die Seuche hatte tags zuvor bereits das vierte der sieben Falkkinder hinweggerafft.
Gerade las der Pfarrer einen Abschnitt aus der Bibel vor: »Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.«
»Amen«, murmelten das Ehepaar Falk und ihre restlichen drei Kinder.
Die Totengräber ließen den Sarg in die Erde hinab. Caroline klammerte sich noch fester an ihren Mann. Johannes versuchte, stark zu sein. Doch er konnte nicht verbergen, dass seine Hände zitterten.
»Von der Erde sind wir genommen«, fuhr der Pfarrer fort, »zur Erde kehren wir wieder zurück. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.«
Mit tränenerstickter Stimme sprachen alle das Vaterunser und der Pfarrer segnete die Trauerfamilie. Danach ging er ein paar Meter weiter, wo schon die nächste Bestattung auf ihn wartete.
Johannes und Caroline Falk schauten stumm den Totengräbern zu, wie sie Schaufel um Schaufel das Grab zuschütteten. Etwas in ihrem Inneren war zerbrochen.
Nur wenige Tage später bekam Johannes Falk Kopfschmerzen. Bald packte ihn ein hohes Fieber und er lag nur noch schwach im Bett.
Der Doktor konnte ihm nicht helfen. »Das Nervenfieber«, erklärte er Caroline und zuckte mit den Schultern, »da hilft nur noch beten.« Also betete Caroline und erneuerte nebenbei regelmäßig die nassen Lappen, die sie auf den Körper ihres Mannes gelegt hatte.
Johannes spürte, wie die eisige Hand des Todes nach ihm griff. »Gott, wo bist du?«, röchelte er in der Nacht. »Du bist doch der allmächtige Vater! Erbarme dich und heile mich!« Er merkte gerade noch, wie Caroline seine Hand nahm. Dann wurde es dunkel um ihn …
Licht umflutete Johannes. So hell, dass es ihm Mühe machte, die Augen zu öffnen. War er im Himmel? Nein, wohl eher nicht. Langsam erkannte er die Stube, in der er lag. Die Wintersonne schien durchs Fenster herein. Auf dem Nachttisch standen eine Schüssel mit Wasser und ein Stapel Tücher. Dem Geklimper nach zu urteilen, übte eines seiner Kinder gerade Klavier im Nebenraum. Langsam setzte er sich auf; sein Kopf dröhnte. Schon eilte Caroline zu ihm.
»Gott sei Dank!«, rief sie aus. »Ich bin so froh, dass du noch lebst.«
Johannes sammelte sich. »Ich dachte, ich müsse sterben«, murmelte er. »Gott hat mich bewahrt.«
»Du sahst wirklich elend aus. Wir alle haben dich schon aufgegeben. Gott muss etwas Besonderes mit dir vorhaben, dass er dir erneut das Leben schenkt.« Caroline setzte sich auf den Hocker, der neben dem Bett stand. Sie sah aus, als wenn ihr die Last eines Berges abgenommen worden war.
Johannes schwieg einen Moment. Mit einem Mal war die Trauer über seine verstorbenen Kinder wieder da. Warum durfte er leben und sie nicht? Noch während er darüber grübelte, kam ihm ein neuer Gedanke.
»Weißt du, Caroline«, begann er, »ich glaube, es gibt viele Eltern, die wie wir ihre Kinder verloren haben. Aber es gibt auch unzählige Kinder, die niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert. Napoleons Soldaten und das Nervenfieber haben sie zu Waisen gemacht. Ich habe Mitleid mit ihnen. Es ist, als ob Gott mich drängt, für diese armen Kinder da zu sein.«
»Johannes, Waisen können unsere Kinder nicht ersetzen«, flüsterte Caroline.
»Das weiß ich, meine Liebe. Doch ich will diese Kinder vor Hunger und Tod retten. Kein Kind sollte betteln, stehlen oder sich verkaufen müssen, um an ein Stück Brot zu kommen.«
»Aber du hast erst im Mai die ›Gesellschaft der Freunde in der Not‹ gegründet. Mit diesem Verein unterstützt du doch schon notleidende Menschen.«
»Ich denke, ich kann meinem Freund Karl Friedrich Horn vertrauen, dass er die meisten Aufgaben auch ohne mich erledigen kann. Für mich sind jetzt die Kinder dran.«
Johannes sah Caroline in die Augen. Jetzt war er sich des neuen Sinns für sein Leben sicher: Er würde sich neben seiner Tätigkeit als Geheimrat und Dichter auch für das Wohl verwaister Kinder einsetzen. Gott hatte ihn barmherzig behandelt und ihn geheilt. Diese Barmherzigkeit wollte er an die ganz Schwachen weitergeben.
Es dauerte noch ein paar Tage, bis Johannes sich ganz vom Fieber erholt hatte. Aber schon an Weihnachten konnte er mit seiner Familie wieder in die Kirche gehen. Der Pfarrer sprach davon, dass Gott als Kind auf die Welt kam, schwach und hilfsbedürftig. Johannes’ Wunsch, sich um die vielen herumstreunenden Kinder zu kümmern, wurde immer stärker.
Den Weihnachtsnachmittag verbrachte Familie Falk bei einem kleinen, spärlichen Festessen. Irgendwie hatte Caroline einen Laib Brot aufgetrieben und gemeinsam verspeisten sie ihn mit ein bisschen Butter und Käse. Von draußen klangen immer wieder Rufe und Klageschreie herein. Die französischen Soldaten drangen in die Häuser ein und nahmen sich, was sie kriegen konnten.
Am Abend, als die drei Kinder und Caroline schon schliefen, klopfte es zaghaft an der Tür. Johannes, der in der Küche am Tisch saß und im Kerzenlicht in der Bibel las, stand auf und öffnete vorsichtig. Der Wind blies eine Schneewolke ins Haus. Durch die Flocken konnte Johannes eine jämmerliche, kleine Gestalt ohne Schuhe erkennen, die ihm die offene Hand entgegenstreckte.
»Bitte, Herr, habt Ihr vielleicht ein Stückchen Brot für mich?«, drang eine feine Stimme an sein Ohr.
Johannes erkannte einen kleinen Jungen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Schnell fasste er sich und antwortete: »Ja, natürlich, mein Kleiner, warte kurz.«
Er ging zurück in die Küche an den Tisch, wo noch die Reste des Brotes vom Nachmittag lagen. Als er etwas davon abbrechen wollte, fiel sein Blick auf die Bibel. Sie war bei Matthäus 18 aufgeschlagen und Vers 5 sprang ihm geradezu in die Augen: Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.
»Das muss ein Hinweis vom Himmel sein«, fuhr es Johannes durch den Kopf. Er ging zu dem kleinen, frierenden Jungen zurück, der ihn mit erwartungsvollen Augen ansah.
»Komm herein«, sagte er zu ihm und machte eine einladende Bewegung. Die Augen des Jungen wurden noch größer. Wahrscheinlich hatte er schon lange keine freundliche Geste mehr erlebt.
Zögernd und fast ein bisschen misstrauisch betrat der Junge die Küche. Johannes schloss die Tür und setzte den Kleinen an den Tisch.
Dann holte er schweigend Butter, Käse und einen Becher mit Wasser und schnitt zwei Scheiben vom Brot ab. Alles schob er dem Jungen zu, der nicht zögerte und sich gierig über die Mahlzeit hermachte.
Als der letzte Bissen in seinem Mund verschwunden war, fragte Johannes: »Wo sind denn deine Eltern?«
»Weg«, antwortete der Junge knapp. »Vater ist von der Schlacht bei Leipzig nicht wiedergekommen und wo Mutter und meine Geschwister sind, weiß ich nicht. Als ich von einem Botengang zurückkam, brannte unser Haus. Die Soldaten haben es angezündet …«
Der Junge biss sich auf die Unterlippe; seine Augen wurden feucht. Johannes merkte, wie sehr ihn das Schicksal des Jungen berührte.
»Wie heißt du, mein Kleiner?«, wollte er wissen.
»Friedrich«, schluchzte der Junge.
Johannes stand auf und nahm Friedrich in den Arm. Das war für ihn ungewohnt, denn normalerweise tröstete Caroline ihre Kinder.
»Bleib heute Nacht bei uns«, bot er dem Jungen an. »Ich gebe dir eine Decke, mit der du dich vor dem Kamin hinlegen kannst.«
Friedrich hob den Kopf und etwas wie Hoffnung schimmerte in seinen Augen.
Am nächsten Tag gab es bei Falks ein kleines Donnerwetter. Caroline hatte den Jungen am Morgen natürlich in der Küche entdeckt.
»Und wenn der unser Essen einsteckt?«, fuhr sie Johannes an und stand mit in die Hüften gestemmten Armen vor ihm.
»Caroline, er ist nur ein armer Junge …«
»Und die stehlen wie die Raben!«, fauchte Caroline.
»Hör mal. Als er gestern Abend an der Tür klopfte, war er durchgefroren und am Verhungern. Seine Eltern sind tot. Gott hat mir durch die Bibel gezeigt, dass wir ihn aufnehmen sollten. Er sollte ein warmes Dach über dem Kopf haben.«
»Aber das Essen reicht doch grade für uns fünf. Woher soll das Geld kommen, um den Jungen zu versorgen?«
»Er könnte Lesen, Schreiben und Rechnen lernen und später in eine Lehre gehen.«
»Und bis dahin?!«
Noch lange ging das so hin und her. Schließlich konnte Johannes Caroline überzeugen, Friedrich bei sich zu behalten.
Er schenkte ihm eine Hose und eine Jacke von einem seiner verstorbenen Kinder. Friedrich durfte auch ihre Zinnsoldaten und Holzpferde haben und mit ihnen spielen. In den nächsten Tagen wurde er immer fröhlicher. Er verstand sich gut mit den Falkkindern und sogar Caroline gab zu, dass Friedrich ein »reizendes Kind« sei.
Im neuen Jahr klopften immer mehr Kinder an die Tür der Falks. Es hatte sich in den Gassen rumgesprochen, dass dort ein Mann lebte, der ein Herz für sie hatte. Kein Kind, das ihn um Hilfe bat, wurde abgewiesen. Im Frühjahr 1814 betreute Johannes schon mehr als 30 Kinder und Jugendliche im Haus. Es war richtig eng geworden. Wie gut, dass Caroline mittlerweile ebenfalls Mitleid mit ihnen hatte und sich liebevoll um sie kümmerte.
Die meisten Kinder hatten ihre Eltern durch die Kämpfe mit den napoleonischen Truppen oder durch das Nervenfieber verloren. Johannes und Caroline trösteten sie, besorgten für sie warme Kleidung und gaben ihnen Brot. Und wenn es möglich war, brachte Johannes einzelne Kinder in Pflegefamilien unter.
Doch bald konnte er nicht mehr alle satt machen. Er pfändete den Familienschmuck seiner Frau, nahm hohe Kredite auf und wusste oft doch nicht, wie er einen Korb Holz bezahlen sollte. Aber Johannes und Caroline waren sich bewusst, dass ihr Leben in Gottes Hand lag. Und der versorgte sie immer wieder auf wundersame Weise.
So kam es, dass hilfsbereite Nachbarn öfter Johannes ihre Unterstützung anboten oder Essen vorbeibrachten und einige wohlhabende Bürger ihm Geld spendeten.
Mit viel Liebe und Geduld brachte Johannes den Kindern und Jugendlichen Lesen, Schreiben und Rechnen bei – wie in einer richtigen Schule. Abends sammelte er sie um sich und las mit ihnen in der Bibel. Er erzählte ihnen, dass sie in Gottes Augen unendlich wertvoll sind. Den Kindern und Jugendlichen tat die fröhliche Atmosphäre gut und sie genossen es, dass sich jemand Zeit für sie nahm.
»Ich möchte die Kinder und Jugendlichen in Freiheit zur Freiheit erziehen«, erklärte Johannes jedem, der ihn nach »seinen« Kindern fragte. »Dazu gehört, dass wir ihnen viele schöne Momente bereiten. Bei uns gibt es keine Ketten, keinen Zwang und keine Schläge. Sie können alle davonlaufen, aber es läuft keiner davon.«
Bei dieser Aussage rissen seine Zuhörer jedes Mal die Augen vor Staunen weit auf. Für sie stand fest, dass man Kinder nur mit einer strengen Hand erziehen könne.
Dann fuhr Johannes fort: »Unsere Anstalt hat drei Schlüssel: zum Brotschrank, zum Kleiderschrank und zum Himmel. Sobald der letzte nicht mehr funktioniert, klappt es auch mit den anderen beiden nicht mehr.«
Die Zeit verging, Napoleon wurde auf die Insel St. Helena verbannt, und so kam Weimar endlich zur Ruhe. Etwa zwei Jahre nachdem der erste Junge an seine Tür geklopft hatte, überlegte Johannes, wie er den Kindern ein schönes Weihnachtsfest bereiten könne. Für ein Festessen mit Braten fehlte das Geld. Für neues Spielzeug auch. Ganz zu schweigen von Luxusgütern wie Kakao.
Es musste etwas sein, das er selbst herstellen konnte. Eine Geschichte vielleicht? Doch Johannes hatte schon lange nichts mehr geschrieben. Und außerdem musste er in dieser Zeit immer wieder an seine vier verstorbenen Kinder denken. Worüber hätten sie sich gefreut?
Einmal blätterte er ziellos in einem Liederbuch herum und blieb dabei bei einem Fischer- und Marienlied hängen. Die Melodie, die er den Noten entnahm, war sehr einfach. »Das ist es!«, rief er aus, nahm Feder, Tinte und Papier zur Hand, setzte sich an sein Pult und begann zu schreiben.
Das Weihnachtsfest 1815 sollte für die Kinder und Jugendlichen im Falk’schen Haus unvergesslich werden. Am Nachmittag versammelten sie sich rund um Caroline, Johannes und die Mitarbeiter in der großen Stube. In einer Ecke stand ein Tannenbaum, der mit Kerzen, Zuckerwerk, Äpfeln und Walnüssen behängt war. Vor allem die jüngeren Kinder schielten immer wieder dorthin und warteten ungeduldig darauf, ihn plündern zu dürfen. Doch noch hörten sie artig Caroline zu, die die Weihnachtsgeschichte vorlas: »… Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids …«
Als sie geendet hatte, stand Johannes auf und die Kinder schauten ihn neugierig an.
»Liebe Kinder«, begann Johannes, »ich hätte gerne jedem von euch etwas zum Spielen geschenkt. Aber ihr wisst ja, dass das gerade nicht möglich ist. Deshalb schenke ich euch etwas, das ihr für immer in eurem Herzen tragen könnt. Es ist ein Lied, das ich für euch gedichtet habe und das die frohe Botschaft von Weihnachten in diese dunkle Welt leuchten lässt. Es heißt das ›Allerdreifesttagslied‹.«
Johannes setzte sich an das Klavier und spielte einmal die Melodie vor. Dann sang er dazu die erste Strophe:
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ist geboren.
Freue, freue dich, o Christenheit!
Sophie, ein aufgewecktes Mädchen von etwa sieben Jahren, rief begeistert aus: »Oh, das klingt aber schön. Kannst du das noch mal singen? Bitte!«
»Gerne«, antwortete Johannes und kam den Wunsch nach. Ein paar Kinder trauten sich schon, mitzusingen. Der inzwischen nicht mehr ganz so kleine Friedrich war einer von ihnen.
Johannes merkte, dass seinen Schützlingen das Lied gefiel. Sogar die jüngeren Kinder konnten ihre Blicke von der Tanne lösen und hörten fasziniert dem Gesang zu.
Nachdem sie geendet hatten, erklärte Johannes: »Das war eine Strophe für Weihnachten. Doch mit Weihnachten fängt die Geschichte von Jesus gerade erst an. So wie ihr jeden Tag größer werdet, ist auch Jesus größer geworden und war irgendwann ein erwachsener Mann. Er hat viele gute Sachen gemacht: den Menschen von Gott erzählt, ihnen zu essen gegeben, ihre Krankheiten geheilt und sogar Tote wieder lebendig gemacht.«
Obwohl die meisten Kinder diese Geschichten schon aus den Bibelstunden kannten, bekam Johannes mit, wie sehr seine Worte die Kinder berührten. Sie alle hatten schwere Erlebnisse durchgemacht und wünschten sich wohl, dass Jesus auch ihnen half, ihre Eltern wiederzufinden und ein Leben ohne Not und Hunger leben zu können.
»Trotzdem fanden einige Menschen Jesus nicht gut«, fuhr Johannes fort. »Sie dachten, dass er König werden wollte, oder noch schlimmer: dass er sich für Gott hielt. Weil das damals ein böses Verbrechen war, wurde Jesus mit dem Tod bestraft und an ein Kreuz gehängt, obwohl er tatsächlich Gott war.«
Bei diesen Worten wurde Johannes von Friedrich unterbrochen: »Doch Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und lebt jetzt bei Gott im Himmel. Dort hört er unsere Gebete und hilft uns.«
Johannes musste wegen Friedrichs Eifer innerlich schmunzeln. Er war einer der Jungen, die immer ganz aufmerksam zuhörten, wenn Johannes etwas in der Bibelstunde erzählte.
»Richtig, Friedrich«, antwortete er. »Hört euch also die zweite Strophe an.«
Johannes griff in die Tasten und sang dabei:
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Osterzeit!
Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden.
Freue, freue dich, o Christenheit!
»Johannes, ich mag dein Lied«, meldete sich der nachdenkliche Ludwig zu Wort. Er war mit seinen 14 Jahren schon ein junger Mann und würde bald eine Lehre beginnen. »Die Melodie und der Text machen mich irgendwie fröhlich. Mir kam eben der Gedanke, dass, auch wenn es im Leben düster aussieht, Jesus das Licht des Lebens und des Friedens bringt.«
»Und für mich bedeutet das Lied, dass ich immer fröhlich sein kann, weil es Jesus gibt«, sagte Sophie strahlend. Nun wurde es doch ein wenig unruhig, weil die Kinder alle gleichzeitig ihre Meinung kundtun wollten.
Johannes ließ ihnen ein paar Momente Zeit und spielte dann von Neuem die schöne Melodie. Die Kinder wurden still und lauschten der dritten Strophe:
O du fröhliche, o du selige,
gnadenbringende Pfingstenzeit!
Christ, unser Meister, heiligt die Geister.
Freue, freue dich, o Christenheit!
»Das verstehe ich nicht«, klagte Sophie. »Kannst du uns das erklären?« Mit dieser Frage hatte Johannes schon gerechnet. Es war ihm beim Dichten schwergefallen, einen passenden Reim für die Ereignisse um Pfingsten zu finden.
»Ja, das kann ich«, antwortete Johannes, »aber das ist ein bisschen kompliziert, deshalb müsst ihr gut aufpassen, einverstanden?« Die Kinder und Jugendlichen nickten und Johannes fuhr fort: »An Pfingsten feiern wir, dass Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist geschickt hat. Man könnte sagen, wer den Heiligen Geist bekommen hat, ist auch heilig. Heilig bedeutet, etwas ist ganz besonders kostbar für Gott. ›Geister‹ ist ein anderes Wort für Seelen, und gemeint sind damit die Menschen an sich. Die Strophe zeigt euch also: Wer an Jesus glaubt, ist für Gott ganz besonders kostbar.«
»So kann ich mir das merken«, sagte Sophie und Ludwig ergänzte: »Wenn ich für Gott kostbar bin, dann freut mich das sehr.«
Johannes war sehr bewegt von ihren Äußerungen. »Liebe Kinder, ich wünsche euch, dass ihr immer tiefe Freude in euren Herzen habt. Das ›Allerdreifesttagslied‹ soll euch immer daran erinnern, warum ihr euch freuen dürft. Kommt, lasst uns noch ein paar Mal die Strophen singen.«
Nur drei Wiederholungen später konnten die Kinder und Jugendlichen das Lied auswendig. Und dann bekamen sie endlich die Erlaubnis, sich über den Weihnachtsbaum herzumachen. Bald waren nur noch die Kerzen an der Tanne und verbreiteten ihr warmes Licht in der Stube.
Die Fröhlichkeit, die in Johannes Falks Erziehungsheim gelebt wurde, prägte die Kinder und Jugendlichen nachhaltig. Sie gewannen Mut zum Leben und durch Johannes’ vorgelebte Barmherzigkeit wuchs ihr Vertrauen auf Gott.
1826, im Todesjahr von Johannes Falk, dichtete Heinrich Holzschuher, ein Mitarbeiter im Falk’schen Heim, zwei alternative Strophen zum »Allerdreifesttagslied« und machte es damit zum reinen Weihnachtslied. Bis heute gehört es zum festen Bestandteil vieler Weihnachtsgottesdienste, allerdings unter einem anderen Namen: »O du fröhliche«.