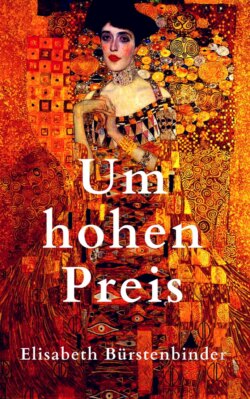Читать книгу Um hohen Preis - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеHeller Sonnenschein lag auf der Landschaft ringsum; der Spiegel des Sees dehnte sich weit und glänzend aus und warf das Bild der Stadt zurück, die sich in ihrer ganzen malerischen Schönheit am Ufer erhob, während das fern aufsteigende Gebirge, mit seinen zackigen Gipfeln und seinen Schneehäuptern sich in voller Klarheit zeigte.
Inmitten der villen- und gartenreichen Vorstadt, die sich am Ufer hinzog, lag eine kleine Besitzung von bescheidenem Ansehen. Das einstöckige Wohnhaus bot weder viel Raum, noch schien es besonderen Luxus zu bergen. Eine offene, weinumrankte Veranda bildete fast den einzigen Schmuck desselben; dennoch machte es mit seinen hellen Mauern und grünen Jalousien einen äußerst freundlichen Eindruck, und der nicht große, aber sorgfältig gepflegte Garten, der sich bis an den Rand des Sees erstreckte, gab dem kleinen Landsitze noch einen besonderen Reiz.
In der Veranda, die vollen Schutz gegen die Sonnengluth und selbst einige Kühlung gewährte, gingen zwei Herren, im Gespräch begriffen, auf und nieder. Der Aeltere der beiden war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, aber das Alter schien ihm früh genaht zu sein, denn die Gestalt war gebeugt und das Haar bereits vollständig ergraut. Das tief durchfurchte Gesicht verrieth, daß Kämpfe und vielleicht Leiden mancher Art darin gewühlt hatten, und der scharfe bittere Zug um die schmalen Lippen gab dem Antlitz ein beinahe feindseliges Gepräge. Nur in dem Auge blitzte noch ein Feuer, das weder Jahre noch Erfahrungen hatten dämpfen können und das einen seltsamen Contrast zu den grauen Haaren und der gebeugten Haltung bildete.
Sein Gefährte war um vieles jünger, eine schlanke mittelgroße Gestalt mit keineswegs regelmäßigen, aber im höchsten Grade anziehenden Zügen und ernsten blauen Augen. Das hellbraune Haar fiel auf eine schöne klare Stirn; die Gesichtsfarbe zeigte jene leichte Blässe, die, ohne krankhaft zu sein, doch auf angestrengte geistige Thätigkeit deutet, und der vorherrschende Ausdruck war der einer ruhigen Festigkeit, wie man sie bei einem Alter von sieben- oder achtundzwanzig Jahren nur selten ausgeprägt findet. Es konnte kaum einen schärferen Gegensatz geben als diese beiden Männergestalten.
„Also Sie wollen uns wirklich schon jetzt verlassen, Georg?“ fragte der Aeltere im Tone des Bedauerns.
Der junge Mann lächelte. „Schon jetzt? Ich dächte, Herr Doctor, ich hätte Ihre Gastfreundschaft lange genug in Anspruch genommen. Meine Absicht war es nicht, wochenlang zu bleiben, aber Sie nahmen den Fremden, der nichts weiter als eine Universitätsfreundschaft mit Ihrem Sohne geltend machen konnte, so herzlich auf, wie einen nahen, lieben Verwandten. Ich werde nie –“
„Nur keinen Dank für das, was mir eine Freude gewesen ist!“ unterbrach ihn der Doctor. „Ich fürchte nur, Sie werden die genossene Gastfreundschaft daheim büßen müssen. Man verzeiht dem Assessor Winterfeld schwerlich den Aufenthalt in meinem Hause. Ich habe Ihnen nie verhehlt, daß Ihr Besuch bei uns ein Wagniß ist und Ihre ganze Stellung gefährden kann.“
Der ironische Ton dieser Warnung rief eine flüchtige Röthe auf die Stirn des jungen Winterfeld und verschuldete jedenfalls die Lebhaftigkeit, mit der er antwortete: „Ich denke Ihnen bewiesen zu haben, daß ich meine Selbstständigkeit unter allen Umständen zu wahren weiß. Meine Stellung legt mir hoffentlich nicht die Verpflichtung auf, Freundschaftsbeziehungen zu meiden, die rein privater Natur sind.“
„Nicht? Ich bin vom Gegentheil überzeugt. Es wird sich bei Ihrer Rückkehr ja zeigen. Vergessen Sie nicht, Georg, daß Sie unter dem Regimente eines Raven stehen!“
„Ich glaube nicht, daß mein Chef sich so eingehend um die Ferienreisen seiner Beamten kümmert,“ sagte Georg ruhig. „Er ist allerdings von einer eisernen Strenge in allem, was den Dienst betrifft, mischt sich aber niemals in Privatverhältnisse. Die Gerechtigkeit muß ich ihm widerfahren lassen, wenn ich auch sonst keineswegs zu seinen Freunden gehöre. Sie wissen ja, ich bin ein entschiedener Gegner der Richtung, die er vertritt, also auch der seinige, wenn ich als sein Untergebener auch vorläufig noch zum Schweigen und Gehorchen verurtheilt bin.“
„Vorläufig?“ wiederholte der Doctor in schneidendem Tone. „Ich sage Ihnen, er wird Sie dauernd Schweigen und Gehorsam lehren, und wenn Sie sich nicht gelehrig zeigen, wird er Sie erdrücken und verderben. Das ist so seine Art, wie die all dieser verächtlichen Emporkömmlinge.“
Georg schüttelte ernst den Kopf. „Sie gehen zu weit. Der Freiherr hat viele Feinde, und ich glaube, daß im Geheimen sehr viel Haß und Bitterkeit gegen ihn genährt wird – Verachtung aber hat ihm noch Niemand zu bieten gewagt.“
„Nun wohl, so thue ich es,“ rief der Doctor mit ausbrechender Heftigkeit. „Und ich habe wahrlich Grund dazu.“
Der junge Mann sah ihn schweigend an; dann, nach einer secundenlangen Pause, legte er die Hand auf seinen Arm.
„Herr Doctor Brunnow, verzeihen Sie eine vielleicht indiscrete Frage. Was liegt eigentlich zwischen Ihnen und meinem [144] Chef? So oft sein Name genannt wird, verrathen Sie eine Bitterkeit, die unmöglich nur der politischen Gegnerschaft entstammen kann. Sie scheinen ihn genau zu kennen.“
Brunnow’s Lippen zuckten. „Wir waren einst Jugendfreunde,“ entgegnete er dumpf.
„Unmöglich!“ rief Georg. „Sie und –“
„Freiherr Arno von Raven Excellenz, Gouverneur der -schen Provinz und intimer Freund und Günstling der jetzigen Machthaber,“ vollendete der Doctor, einen scharfen, hohnvollen Nachdruck auf jedes einzelne Wort legend. „Das befremdet Sie, nicht wahr?“
„Allerdings; ich ahnte nichts von einer solchen Beziehung.“
„Es liegt auch fast ein halbes Menschenalter dazwischen. Damals hieß er freilich noch einfach Arno Raven und war arm und unbekannt wie ich selber. Wir lernten uns in einer stürmischen, mächtig bewegten Zeit, inmitten der Partei kennen, der wir Beide angehörten. Raven mit seinen glänzenden Geistesgaben, seiner rastlosen Energie hatte sich bald genug zu unser Aller Führer aufgeworfen. Wir folgten ihm mit blindem Vertrauen, ich vor Allem, denn ich liebte ihn, wie ich nichts wieder auf der Welt geliebt habe, nicht einmal mein Weib und Kind. Ihm galt die ganze Schwärmerei meiner Jugend; er war mein Vorbild, zu dem ich mit glühender Bewunderung aufblickte, mein Ideal, mein Alles – bis zu dem Tage, wo er mich und uns Alle verrieth und verließ, wo er die Ehre seinem Ehrgeize opferte und sich mit Leib und Seele unseren Feinden verkaufte, indem er uns dem Verderben preisgab. – Menschenfeindlich nennen mich die klugen Leute, die nie eine Enttäuschung erfahren, nie eine Verzweiflungsstunde durchlebt haben. Wenn ich es bin, so bin ich es an dem Tage geworden, wo ich mit dem Freunde auch den Glauben an die Menschheit verlor.“
Er wandte sich in stürmischer Bewegung ab. Man sah es, wie die Erinnerung noch jetzt das ganze Wesen des Mannes in all seinen Tiefen aufwühlte.
„Also ist doch etwas an jenen Gerüchten, die von irgend einem dunklen Punkte in der Vergangenheit des Freiherrn sprechen,“ bemerkte Georg leise. „Ich vernahm wohl hin und wieder Andeutungen, aber Niemand wußte etwas Gewisses darüber. Die Sache ist jedenfalls nie in die Oeffentlichkeit gelangt, denn man kennt Raven nur als den energischen, rücksichtslosen Vertreter der Regierung.“
„Die Renegaten sind immer die schlimmsten Verfolger des verlassenen Glaubens,“ sagte Brunnow finster. „Und in Arno Raven lag von jeher ein verhängnißvolles Element, ein glühender, verzehrender Ehrgeiz. Das war die eigentliche Triebfeder seines Charakters, und das hat ihn auch schließlich zu Falle gebracht. Er träumte immer nur von Macht und Größe; er wollte herrschen, gebieten um jeden Preis, und das ist ihm nun ja auch geworden. Seine Carrière ist geradezu beispiellos. Aus Armuth und Dunkelheit stieg er empor, von Stufe zu Stufe, von Auszeichnung zu Auszeichnung. Er wurde der Schwiegersohn des Ministers, dessen bevorzugter Günstling er stets gewesen, ließ sich in den Freiherrnstand erheben und ist jetzt der fast allmächtige Gouverneur einer der ersten Provinzen des Landes. Er steht auf der einst nur geträumten Höhe, aber ich, den er in Kerker und Verbannung gejagt, der auf ein Leben voll der herbsten Enttäuschungen zurückblickt und an der Schwelle des Greisenalters noch mit Existenzsorgen ringen muß – ich tausche nicht mit dieser Höhe. Sie hat ihm seine Ehre gekostet.“
Der Sprechende war furchtbar erregt; er brach ab und ging einige Male auf und nieder, um seiner Erregung Herr zu werden. Endlich trat er wieder zu Georg, der schweigend vor sich niedersah.
„Ich habe seit Jahren diesen Punkt nicht berührt,“ begann er von Neuem. „Aber Ihnen war ich Offenheit schudig. Sie sind keines von jenen blinden, gefügigen Werkzeugen, wie Raven sie braucht, wie er sie allein um sich duldet, und ich fürchte, es wird eine Stunde kommen, wo Sie gezwungen sein werden, ihm den Gehorsam zu verweigern, wenn Sie anders Ihre Ueberzeugung und Ihre Mannesehre retten wollen. Was dann aus Ihnen wird, ist freilich eine andere Frage. Stehen Sie fest, Georg! Durch das Gefühl der Abneigung und Gegnerschaft, das Sie für ihn hegen, klingt etwas wie Bewunderung dieses Mannes, und ich begreife das nur zu gut. Er übte von jeher eine fast dämonische Macht über Alles, was mit ihm in Berührung kam. Auch Sie können sich ihr nicht ganz entziehen, und darum mußte ich Sie über diesen Raven aufklären. Sie wissen jetzt, was an ihm ist.“
„Dachte ich es doch; da stecken sie schon wieder mitten in der Politik oder in sonstigen unerquicklichen Debatten!“ sagte eine Stimme hinter den Beiden. „Ich suche Dich im ganzen Hause, Georg. – Guten, Tag, Papa!“
Der Sprechende, der jetzt gleichfalls in die Veranda trat, war einige Jahre jünger als Georg, aber größer und stärker gebaut, eine frische, kräftige Erscheinung mit offenen Gesichtszügen, klaren Augen und dichtem, blondem Haar. Er warf einen prüfenden Blick auf das noch immer dunkel geröthete Antlitz seines Vaters und fuhr dann fort:
„Du solltest Dich beim Gespräche nicht so aufregen, Papa. Du weißt doch, wie nachtheilig das stets auf Dich wirkt, und überdies hast Du heute schon angestrengt gearbeitet, wie ich sehe.“
Damit trat er zu einem mit Büchern und Papieren bedeckten Tische, der in der Veranda stand, und begann in den Schriften zu blättern.
„Laß das liegen, Max!“ sagte der Doctor ungeduldig. „Du bringst mir Unordnung in die Manuscripte, und Du giebst Dich ja doch nicht mit tieferen wissenschaftlichen Studien ab.“
„Weil mir die Zeit dazu fehlt,“ erwiderte Max, die Papiere ruhig wieder hinlegend. „Ein junger Assistenzarzt im Hospital kann nicht tagelang über den Büchern sitzen. Du weißt ja, daß ich alle Hände voll zu thun habe.“
„Die Zeit würde sich schon finden,“ warf Brunnow ein.
„Was Dir fehlt, ist die Lust.“
„Meinetwegen auch die Lust! Mein Studium ist die Praxis, und ich denke damit ebenso weit zu kommen.“
„So weit Dein Ehrgeiz reicht, allerdings,“ in dem Tone des Vaters verrieth sich eine unverkennbare Geringschätzung. „Du wirst Dir jedenfalls eine ausgebreitete Praxis gründen und Deinen Beruf als ein einträgliches Handwerk betrachten. Ich zweifle durchaus nicht daran.“
Max kämpfte augenscheinlich mit einer aufsteigenden Gereiztheit; dennoch entgegnete er mit ziemlicher Ruhe: „Ich werde mir allerdings so bald wie möglich eine eigene Praxis gründen. Du hättest das schon vor zwanzig Jahren gekonnt, zogst es aber vor, medicinische Werke zu schreiben, die Dir neben dem geringen Honorare höchstens die Anerkennung einzelner Fachgenossen eintragen. Der Geschmack ist verschieden.“
„So verschieden wie unsere Auffassung des Lebens überhaupt. Du weißt freilich nicht, was es heißt, für die Wissenschaft zu leben und sich ihr zu opfern.“
„Ich opfere mich für Niemand,“ sagte Max trotzig. „Ich fülle meinen Platz im Leben gewissenhaft aus und denke damit genug zu thun. Du liebst die nutzlosen Aufopferungen, Papa – ich nicht.“
„Lassen Sie doch den unverbesserlichen Realisten, Herr Doctor!“ mischte sich Georg ein, den der gereizte Ton der Beiden eine Scene fürchten ließ, wie sie zwischen Vater und Sohn nicht eben selten war. „Ich habe es längst aufgegeben, ihn zu bekehren. Jetzt aber wollen wir Beide Sie nicht länger stören. Max versprach mir schon heute Morgen, mich nach seiner Rückkehr auf einem Spaziergange nach dem Wäldchen zu begleiten.“
„Jetzt um die Mittagsstunde?“ fragte der Doctor befremdend.
„Weshalb nicht später?“
In dem Gesichte des jungen Winterfeld zeigte sich eine leichte Verlegenheit, die er jedoch rasch bemeisterte. „Ich habe später noch mit den Vorbereitungen zur Abreise zu thun und möchte gern noch einmal den Blick auf den See und die Berge genießen. Das Scheiden wird mir schwer genug.“
„Das glaube ich,“ sagte Max mit einer eigenthümlichen, fast boshaften Betonung, brach aber ab, als er dem halb unwilligen, halb bittenden Blicken seines Freundes begegnete.
Brunnow schien der Sache keine Wichtigkeit weiter beizulegen; er winkte einen flüchtigen Abschiedsgruß und trat wieder an seinen Arbeitstisch, während die beiden jungen Männer durch den Garten schritten und, nachdem Max die Gitterthür desselben geöffnet hatte, einen Fußweg einschlugen, der dicht am See entlang führte. Eine Zeitlang schritten sie schweigend vorwärts. [145] Georg schien sehr ernst und nachdenklich, und der junge Arzt war offenbar übler Laune, an der das eben geführte Gespräch mit dem Vater und die nahe Abreise des Freundes gleichen Antheil haben mochten.
„Das wäre nun also der letzte Tag Deines Hierseins,“ begann er endlich, „und was habe ich eigentlich davon, wie überhaupt von Deinem Besuche hier? Den halben Tag lang declamirst Du mit meinem Papa gegen die Zustände in unserm geliebten Vaterlande im Allgemeinen und gegen die Raven’sche Dictatorwirthschaft im Besonderen, und wenn ich Dich endlich glücklich von der Politik entfernt habe, mißbrauchst Du meine Freundschaft in der unverantwortlichsten Weise, indem Du mich bei vierundzwanzig Grad Réaumur in der Mittagsstunde Schildwach’ stehen läßt. Ein höchst angenehmer Posten!“
„Welch ein Ausdruck!“ sagte Georg unwillig. „Ich habe Dich nur gebeten –“
„Dafür zu sorgen, daß Du bei Deinem, natürlich ganz zufälligen Zusammentreffen mit Fräulein von Harder ungestört bleibst. Man nennt das auf Deutsch ‚Schildwache stehen‘. Wie viele solcher Zufälligkeiten habt Ihr eigentlich schon mit oder ohne meine Statistenmitwirkung in Scene gesetzt? Nehmt Euch in Acht, daß die Frau Mama nicht hinter diese gemeinsamen Spaziergänge kommt!“
„Du weißt ja, daß mein Urlaub zu Ende ist und daß ich morgen fort muß,“ war die etwas kurze Antwort.
Max seufzte leise vor sich hin. „Und deshalb wird es vermuthlich heut’ sehr lange dauern. Nimm es mir nicht übel, Georg – für Euch mag es sehr interessant sein, wenn Ihr Euch bei Sonne, Mond und Sternen ewige Treue schwört, aber für den Unbetheiligten ist das äußerst langweilig, noch dazu bei einer Temperatur wie die heutige. Es ist das heißeste Freundschaftsstück, das ich je einem Menschen geleistet habe.“
Sie hatten inzwischen das nahgelegene „Wäldchen“ erreicht, eine Gruppe von Kastanienbäumen, die einen Wiesengrund am Ufer des Sees beschattete. Es war ein vielbesuchter und beliebter Spaziergang der Stadtbewohner, denn man genoß von hier aus eine prachtvolle Rundsicht, bei der sich der See und das Gebirge in ihrer ganzen Schönheit zeigten. Jetzt, um die Mittagsstunde, war der Ort freilich ganz einsam und verlassen. Georg, der vorausgeeilt war, blieb stehen und spähte erwartungsvoll, aber vergebens, umher. Max schlenderte langsam nach, und da er gleichfalls Niemand gewahrte, ließ er sich unter einem der mächtigen Kastanienbäume nieder, wo eine Rasenbank gerade an dem schönsten Aussichtspunkte einen natürlichen Ruhesitz bildete. Er lehnte sich in bequemster Stellung zurück und beobachtete mit einem Gemisch von Spott und Mitleiden seinen Freund, dessen fieberhafte Unruhe sich deutlich verrieth.
„Sag’ einmal, Georg, was soll denn nun eigentlich aus Deinem Liebesroman werden?“ begann er nach längerem Schweigen von Neuem.
Der Gefragte runzelte die Stirn. „Ich habe Dich schon öfter gebeten, nicht in solchem Tone davon zu sprechen.“
„Ist das etwa nicht zart genug ausgedrückt? Ich dächte, Romantik genug wäre in Deiner Liebe. Ein junger bürgerlicher Beamter ohne Vermögen – und eine hochgeborene Baroneß und dereinstige Erbin – heimliche Zusammenkünfte – voraussichtlicher Widerstand der ganzen Familie – Kämpfe und Aufregungen ohne Ende – ich gratulire Dir zu all den schönen Dingen. Mir wäre die Geschichte viel zu unbequem.“
„Das glaube ich,“ sagte Georg mit leisem Spott. „Aber, lieber Max, in solchen Dingen fehlt Dir wirklich die Berechtigung, mitzusprechen.“
„Weil ich eine durch und durch prosaische Natur bin,“ ergänzte Max in größter Gemüthsruhe. „Das ist mir nun gerade nichts Neues mehr. Mein Vater läßt mich oft genug anhören, daß mir die ‚ideale Richtung‘ fehlt. Er hat sich von jeher die redlichste Mühe gegeben, mir den Idealismus beizubringen, es ging aber leider nicht. Ich gehöre nun einmal nicht zu den ‚höher organisirten Naturen‘, wie Du zum Beispiel. Du bist weit mehr nach Papas Geschmack, und ich glaube, er würde sich nicht einen Augenblick bedenken, Dich als Sohn einzutauschen.“
Georg lächelte flüchtig. „Wenn Du damit einverstanden bist – ich hätte nichts dagegen.“
„Probire es erst einmal!“ sagte Max trocken. „Gegen Dich ist Papa allerdings ausnahmsweise liebenswürdig, weil er eine ganz besondere Vorliebe für Dich gefaßt hat, im Uebrigen fehlt ihm aber nicht viel zum Menschenfeinde. Nichts genügt ihm; Alles faßt er mit der Gereiztheit und Verbitterung auf, die er für unbefriedigten Idealismus hält, und das ist der Grund zum ewigen Kriege zwischen uns. Er vergiebt es mir nicht, daß ich mich in dieser nichtsnutzigen Welt ganz wohl befinde, während er nie damit fertig werden kann. Unser Verhältniß zu einander wird von Tag zu Tage unleidlicher.“
„Du thust Deinem Vater Unrecht,“ begütigte Georg. „Wer wie er Heimath, Lebensstellung und Freiheit dem geopfert hat, was ihm Ideal hieß, der hat auch das Recht, einen höheren Maßstab an Welt und Menschen zu legen.“
„Ich bin aber für diesen höheren Maßstab zu kurz gerathen,“ erklärte der junge Arzt ärgerlich. „Du entsprichst ihm weit eher; das hat Papa auch schleunigst herausgefunden; er hat Dich ganz für sich in Beschlag genommen. Du würdest freilich bedeutend in seiner Achtung sinken, wenn er ahnte, daß Du gleich in den ersten Tagen Deines Hierseins den grenzenlosen Unsinn begangen hast, Dich zu verlieben.“
„Max, ich bitte Dich,“ unterbrach ihn der Freund in gereiztem Tone, aber Max war einmal im Zuge mit seinem Aerger, und ließ sich durchaus nicht darin stören.
„Ich bleibe dabei, es ist ein Unsinn,“ sagte er kurz und bündig. „Du mit Deinen tiefernsten Lebensansichten. Deinem rastlosen Arbeiten. Deinen idealen Zielen – im Grunde höchst überflüssige Dinge, aber Du hast sie doch nun einmal – und diese verwöhnte, übermüthige Gabriele von Harder, in Reichthum und Ueberfluß aufgewachsen, in allen nur möglichen aristokratischen Vorurtheilen erzogen! Glaubst Du denn wirklich, daß sie jemals auch nur das leiseste Verständniß für Deine Interessen haben wird? Ich sage Dir, sie giebt Dich auf, sobald der Ernst dieser Reiseidylle an sie herantritt und der Einfluß der Familie sich geltend macht. Du wirst Dein Alles an diese Liebe setzen und Deine besten Kräfte im Kampfe mit den Verwandten verschwenden, um schließlich irgend einem Grafen oder Baron geopfert zu werden, der eine standesgemäße Partie für die junge Baroneß ist.“
„Nein, nein!“ rief Georg mit aufwallender Heftigkeit.
„Du kennst Gabriele ja kaum; Du hast sie stets nur flüchtig gesehen, ich dagegen –“ er hielt plötzlich inne und seine Stimme sank, als er fortfuhr: „Ich weiß es ja, daß noch eine ganz andere Kluft zwischen uns liegt, als die der äußeren Verhältnisse, aber sie ist noch so jung, das Leben hat ihr bisher nur seine Sonnenseite gezeigt – und ich liebe sie grenzenlos.“
Max zuckte die Achseln mit einem Ausdrucke, der deutlich verrieth, daß dieser letzte Grund ihm höchst ungenügend erschien.
„Jeder Mensch hat sein Vergnügen.“ sagte er phlegmatisch, „das meinige wäre diese grenzenlose Liebe nun gerade nicht, und es kommt auch gar nichts dabei heraus. Uebrigens,“ er stand auf, „ist es nun wohl Zeit, daß ich meinen Wachposten beziehe, denn ich sehe da hinter den Fliederhecken ein helles Kleid auftauchen und Dich aufflammen, als ob alle sieben Himmel sich vor Dir öffneten. – Georg, thu’ mir den einzigen Gefallen und vergiß nicht ganz, daß es so etwas wie eine Mittagsstunde in der Welt giebt, und daß gewöhnliche Menschen alsdann zu essen pflegen! Eine höchst unpraktische Idee, dies Rendezvous gerade auf die Mittagszeit zu verlegen! Ich hoffe, Du wirst mich zum Danke für meine aufopfernde Freundschaft nicht ganz hungern lassen.“
Damit zog sich Max Brunnow zurück. Der junge Winterfeld hörte kaum auf ihn; seine ganze Aufmerksamkeit war der hellen, schlanken Gestalt zugewendet, die jetzt am Ausgange des Wäldchens erschien. Sie flog leicht und graziös über den Rasen hin und stand nach wenigen Minuten an seiner Seite.
„Da bin ich, Georg. Hast Du lange gewartet? Es war heute gar nicht möglich, unbemerkt fort zu kommen, und beinahe hätte ich es ganz aufgegeben. Aber es wäre doch gar zu grausam gewesen, meinen Ritter umsonst harren zu lassen. Ich glaube, Du würdest es mir nun und nimmermehr verzeihen, wenn ich Dich ohne feierlichen Abschied abreisen ließe.“
Georg hielt die kleine Hand fest, die sich nach flüchtigem [146] Drucke ihm wieder entziehen wollte, und in seiner Stimme lag ein leiser Vorwurf, als er sagte: „So leicht wird Dir die Trennung, Gabriele? Hast Du kein anderes Lebewohl für mich, als Scherze und Neckereien?“
Die junge Dame blickte ein wenig erstaunt auf. „Trennung? Aber wir sehen uns ja in vier Wochen wieder.“
„In vier Wochen! Scheint Dir das eine so kurze Zeit?“
Gabriele lachte. „Es sind gerade viermal sieben Tage. Du wirst sie wohl ertragen müssen. Dann aber kommen wir gleichfalls nach R. Du verkehrst doch öfter mit meinem Vormunde?“
„Mit dem Freiherrn von Raven? Allerdings. Ich gehöre, wie Du weißt, zu seiner Kanzlei und habe ihm bisweilen Vortrag zu halten.“
„Ich kenne ihn kaum,“ sagte Gabriele gleichgültig. „Ich sah ihn immer nur sehr flüchtig, wenn er auf kurze Zeit nach der Residenz kam, das letzte Mal vor drei Jahren. Damals geruhten Excellenz noch gar keine Notiz von mir zu nehmen, und mich noch ganz und gar als Kind zu behandeln, obgleich ich schon volle vierzehn Jahr alt war. Ich war durchaus nicht entzückt von der Aussicht, künftig in seinem Hause zu leben, bis ich,“ sie lächelte schelmisch, „einen gewissen Georg Winterfeld kennen lernte und von ihm erfuhr, daß er das Glück habe, einer der Beamten meines Herrn Vormundes zu sein.“
Ueber Georg’s Züge glitt ein Ausdruck, als sei er über dieses „Glück“ anderer Meinung. „Du täuschest Dich, wenn Du daran irgend eine Hoffnung knüpfst,“ entgegnete er ernst. „Ich verkehre nur amtlich mit meinem Chef, und er versteht es, seinen Untergebenen die Grenzen des Verkehrs möglichst eng zu ziehen; im Uebrigen stehe ich ihm vollständig fern. Ein junger, bürgerlicher Beamter in vorläufig noch untergeordneter Stellung hat keinen Zutritt zu den Kreisen des Gouverneurs und darf es schwerlich wagen, eine nähere Bekanntschaft mit der Baroneß Harder geltend zu machen. Wir werden uns fern genug sein, auch wenn ich täglich das Haus betrete, in dem Du weilst. Hier, in der Freiheit des Reiselebens, durften wir uns kennen und lieben lernen –“
„Das verdankst Du doch im Grunde nur unserem Boote, das zu rechter Zeit auf die Sandbank fuhr,“ unterbrach ihn Gabriele. „Denkst Du noch an unsere erste Begegnung, Georg? Mama bildet sich noch heutigen Tages ein, damals in Lebensgefahr geschwebt zu haben, und hält Dich für ihren Retter, weil Du uns glücklich durch das seichte Wasser an’s Land brachtest. Sonst hätte sie Dir mit Deinem einfach bürgerlichen Namen auch schwerlich die öfteren Besuche gestattet, aber der Lebensretter war natürlich eine Ausnahme. Wenn sie wüßte, daß er mir bereits eine Liebeserklärung gemacht hat!“
Der offenbare Triumph, der in den letzten Worten lag, schien den jungen Mann zu verletzen; seine Augen hefteten sich forschend und unruhig auf ihr Antlitz.
„Und wenn die Baronin es nun früher oder später erführe, was würdest Du thun?“
„Dich ihr in aller Form als meinen künftigen Herrn und Gemahl präsentiren,“ erklärte Gabriele mit komischer Feierlichkeit. „Das würde natürlich eine Explosion geben – Thränen, Vorwürfe, Nervenzufälle – darin ist Mama besonders stark, aber es thut nichts; sie giebt schließlich doch nach, und ich setze immer meinen Willen durch.“
Sie warf das alles lachend und muthwillig hin. Es war augenscheinlich, daß der Gedanke an eine Katastrophe, die jedes andere Mädchen erschreckt haben würde, die junge Baroneß Harder höchlich amüsirte. Sie hatte sich auf den Rasensitz niedergelassen und ihren Strohhut abgenommen. Die Sonnenstrahlen, die hier und da durch das dichte Blätterdach der Kastanien drangen, spielten auf dem reichen blonden Haar und dem rosigen Antlitze, aus dem ein Paar große braune Augen lachend und glückselig in die Welt schauten. Das Gesicht mit seinen zarten, lieblichen Formen war ohne Frage von einem bestrickenden Reiz, aber es fehlte ihm jenes Seelenvolle, das dem Menschenantlitz erst seinen höchsten Zauber leiht. Man würde sich vergebens bemüht haben, hinter all diesem neckischen Uebermuth und dieser strahlenden Heiterkeit irgend einen Zug zu entdecken, der auf ernstere, tiefere Empfindungen schließen ließ. Aber das minderte nicht den Reiz dieser jugendlichen Erscheinung, an der Alles frisches, blühendes Leben und rosige Jugend athmete. Sie erschien wie ein Abglanz der Landschaft da draußen, ebenso sonnig und licht.
Georg blickte mit einem eigenthümlichen Gemisch von Unwillen und Zärtlichkeit auf sie nieder. „Gabriele, Du behandelst das alles nur wie ein Spiel und hast keine Ahnung von den Kämpfen, die uns bevorstehen,“ sagte er.
„Fürchtest Du diese Kämpfe?“
„Ich?“ Die Stirn des jungen Mannes begann sich zu röthen. „Ich bin bereit es mit Allen aufzunehmen, wenn Du mir nur fest zur Seite stehst. Aber Du bist im Irrthum, wenn Du auf die gewohnte Nachgiebigkeit Deiner Mutter rechnest, hier, wo alle ihre Vorurtheile, alle Traditionen ihrer Familie in’s Spiel kommen. Und wenn es Dir selbst gelänge, sie zu gewinnen – Deinen Vormund wird nichts umstimmen. Ich kenne ihn; er wird nie seine Einwilligung geben.“
Gabriele lehnte das blonde Köpfchen an den Stamm des Baumes und zerpflückte spielend einige Grashalme. „Ich frage gar nichts nach seiner Einwilligung,“ erklärte sie. „Ich lasse mir von ihm nichts befehlen oder verbieten. Er soll es einmal versuchen, mich zu zwingen!“
[159] „Es wird Dich Niemand zwingen,“ fiel Georg ein, „aber trennen wird man uns. In dem Augenblicke, wo unsere Liebe entdeckt wird, ist auch die Trennung ausgebrochen – das weiß ich, und das allein ist es, was mir Schweigen auferlegt. Du ahnst nicht, wie dieses Geheimniß, das Dir so reizend erscheint, dieses ängstliche Verbergen mich peinigt und demüthigt, wie sehr es meiner ganzen Natur zuwider ist. Jetzt zum ersten Male fühle ich, was es heißt, arm und unbekannt zu sein.“
„Was thut es denn, daß Du arm bist?“ fragte Gabriele sorglos. „Ich werde einmal sehr reich sein. Mama sagt es mir täglich, daß ich die einzige Erbin meines Onkel Raven bin.“
Georg schwieg und preßte die Lippen fest zusammen, als wolle er eine bittere Empfindung unterdrücken. „Ja wohl, Du wirst reich sein,“ sagte er endlich. „Nur allzu reich.“
„Ich glaube gar, Du willst mir einen Vorwurf daraus machen,“ schmollte die junge Dame mit sehr ungnädiger Miene.
„Nein, aber es öffnet eine Kluft mehr zwischen uns. Gehörtest Du meinem Lebenskreise an, dann dürfte ich offen hintreten und, wenn auch noch nicht Deine Hand, doch Dein Wort und Deine Treue fordern, bis ich Dir eine eigene Heimath zu bieten vermag. Jetzt dagegen – was würde der Freiherr von Raven mir wohl antworten, wenn ich es wagte, bei ihm um die Hand seiner Mündel, seiner muthmaßlichen Erbin zu werben? Er vertritt die Stelle Deines Vaters; Du stehst unter seiner Gewalt.“
„Aber doch nur bis zu meiner Mündigkeit. In einigen Jahren hat die vormundschaftliche Gewalt des gestrengen Herrn ein Ende. Dann bin ich frei.“
„In einigen Jahren!“ wiederholte Georg. „Und wie wirst Du dann denken?“
Es lag eine so bange Frage in den Worten, daß Gabriele halb erschreckt und halb beleidigt aufblickte. „Georg, Du zweifelst an meiner Liebe?“
Er schloß ihre Hand fest in die seinige. „Ich glaube an Dich, meine Gabriele; vertraue auch Du mir! Ich bin ja nicht der Erste, der sich emporarbeitet, und habe von jeher gelernt, der Zukunft und meiner eigenen Kraft zu vertrauen. Ich will Alles an diese Zukunft setzen, um Deinetwillen Du sollst Dich Deiner Wahl nicht zu schämen haben.“
„Ja, zur Excellenz mindestens mußt Du mich machen,“ neckte Gabriele. „Ich erwarte ganz bestimmt, daß Du auch einmal Gouverneur oder Minister wirst. Hörst Du, Georg? Ich will keinen andern Titel.“
Georg ließ plötzlich die Hand fallen, die er noch in der seinigen hielt. Er mochte auf seine mit so tiefer Innigkeit ausgesprochene Betheuerung wohl eine andere Antwort erwartet haben.
„Du verstehst mich nicht. Freilich wie solltest Du auch den Ernst des Lebens kennen, ist er Dir doch noch niemals genaht.“
„O, ich kann auch ernst sein,“ versicherte Gabriele. „Ganz außerordentlich ernst. Du kennst meine eigentliche Natur noch gar nicht.“
„Möglich!“ sagte der junge Mann mit aufquellender Bitterkeit. „Jedenfalls habe ich es nicht verstanden, sie zu wecken.“
Gabriele sah recht gut, daß er verletzt war, aber es beliebte ihr durchaus nicht, Notiz davon zu nehmen. Sie fuhr fort zu necken und zu scherzen und erschöpfte ihren ganzen Uebermuth. Sie pochte auf eine Macht, die sich oft genug bewährt hatte und auch heute ihre Wirkung nicht verfehlte. Georg’s Stirn begann sich zu entwölken; Verstimmung und Vorwurf wollten nicht Stand halten vor dem Geplauder jener rosigen Lippen, und als das geliebte Antlitz lächelnd und schelmisch zu ihm aufblickte, da war es vorbei mit dem Widerstande – er lächelte gleichfalls.
Drüben in der Stadt setzten die Glocken zum Mittagsgeläut ein. Die Klänge zogen hell über den See und mahnten das junge Paar zum Aufbruch. Georg zog die Hand der Geliebten leidenschaftlich an seine Lippen; die unmittelbare Nähe der Landhäuser und der Fahrstraße verbot jede weitere Zärtlichkeit. Gabriele schien die Trennung in der That sehr leicht zu nehmen. Einen Augenblick freilich wurde sie ernster, und es schimmerte sogar eine Thräne in ihren braunen Augen, aber in der nächsten Minute war Alles schon wieder sonnige Heiterkeit. Sie warf einen letzten Gruß zurück und eilte dann fort. Georg’s Augen folgten ihr unverwandt.
„Max hat Recht,“ sagte er träumerisch. „Ich und dieses verwöhnte übermüthige Kind des Glückes! Warum muß ich gerade sie lieben, die mir fern steht in so Vielem, wo wir uns nahe sein müßten? Ja, warum – ich liebe sie eben.“
Die Warnung des Freundes schien trotz aller Zurückweisung doch ein Echo in der Brust des jungen Mannes gefunden zu haben, aber was vermochte Vernunft und Ueberlegung gegen die Leidenschaft, die sein ganzes Wesen erfüllte? Er wußte längst, daß sich gegen den Zauber nicht ankämpfen ließ, der ihn schon bei der ersten Begegnung umsponnen hatte. Er unterlag ihm immer wieder von Neuem.
[160] „Ich bitte noch einmal, Excellenz: nehmen Sie diese harten Maßregeln zurück! Sie können unmöglich die ganze Stadt für die Ausschreitungen Einzelner verantwortlich machen.“
„Auch ich bin der Meinung, daß man nicht mit solcher Schärfe vorzugehen braucht. Es wird nicht schwer sein, die Schuldigen herauszufinden und sich ihrer zu versichern.“
„Sie sollten der Sache nicht solche Wichtigkeit beilegen, Excellenz. Sie verdient es in der That nicht.“
Der Gouverneur von Raven, an den all diese Mahnungen und Vorstellungen gerichtet waren, schien sehr wenig davon berührt zu werden, denn er erwiderte mit kalter Höflichkeit:
„Ich bedauere aufrichtig, meine Herren, mich in so vollständigem Widerspruch mit Ihren Ansichten zu befinden, aber ich habe den Entschluß nach reiflicher Ueberlegung gefaßt, und überdies wissen Sie, daß ich niemals eine bereits angeordnete Maßregel zurücknehme. Es bleibt dabei.“
Die Herren, welche sich im Regierungsgebäude von R. in dem Empfangszimmer des Gouverneurs befanden, schienen eine längere und lebhafte Conferenz gehabt zu haben; sie waren sämmtlich etwas erregt, bis auf den Freiherrn selbst, der mit unerschütterlicher Ruhe in seinem Sessel lehnte.
„Ich sollte meinen,“ sagte Derjenige, welcher zuerst gesprochen, „daß meine Stimme als die des Vertreters der Stadt doch von einigem Gewicht wäre. Um so mehr, als diesmal auch der Polizeidirector auf meiner Seite steht.“
„Allerdings,“ bestätigte der Genannte mit vorsichtiger Zurückhaltung. „Indeß bin ich erst zu kurze Zeit in meinem Amte, um die hiesigen Verhältnisse schon eingehend zu kennen. Excellenz werden das jedenfalls besser beurtheilen.“
„Ich fürchte nur,“ wandte sich der Dritte der Herren, der die Uniform eines Obersten trug, an den Gouverneur, „ich fürchte, man wird Ihre Strenge mißdeuten und sie als persönliche Besorgniß auffassen.“
Um die Lippen des Freiherrn spielte ein verächtliches Lächeln. „Seien Sie unbesorgt!“ entgegnete er. „Man kennt mich in R. zu gut, um mir Furcht zuzutrauen. Der Vorwurf bleibt mir unter allen Umständen erspart.“
Er erhob sich und gab damit das Zeichen zur Beendigung der Conferenz. Freiherr Arno von Raven stand im vollsten, reifsten Mannesalter und war trotz seiner sechs- oder siebenundvierzig Jahre noch eine imponirende Erscheinung. Die hohe, mächtige Gestalt hatte schon in ihrem bloßen Auftreten etwas Gebietendes. Die stolzen energischen Züge waren nicht schön und konnten es auch wohl nie gewesen sein, aber sie waren bedeutend und charakteristisch in jeder Linie. In das volle dunkle Haupthaar mischte sich noch kein Grau, nur an den Schläfen verrieth ein leichter Silberglanz, daß die Mitte des Lebens bereits überschritten war. Dagegen sprach aus den dunklen blitzenden Augen noch die ganze Vollkraft dieses Lebens, aber der Blick hatte etwas Strenges, Finsteres und gewann, sobald er sich fest auf einen Gegenstand richtete, eine durchbohrende Schärfe. Die Haltung war ein Gemisch von ruhiger Vornehmheit und unnahbarem Stolze. Auch nicht der leiseste Zug verrieth den Emporkömmling. Der Mann sah aus, als habe er von jeher nichts Anderes gekonnt, als befehlen und herrschen.
„Es handelt sich hier nicht um mich,“ fuhr er fort. „So lange die Schmähungen und Drohbriefe mir anonym zugingen, habe ich sie dem Papierkorb überantwortet, ohne weiteres Gewicht darauf zu legen. Wenn dergleichen sich aber offen und aller Welt sichtbar an den Mauern des Regierungsgebäudes findet, wenn man Miene macht, mich bei meinen Ausfahrten zu insultiren, und die Herren von der Bürgerschaft sich demonstrativ jedes Einschreitens enthalten, so ist es meine Pflicht, ernstlich vorzugehen. Ich bin die oberste Behörde der Provinz; dulde ich den Unfug, der sich gegen meine Person richtet, so gefährde ich damit die Autorität der Regierung, die zu vertreten ich berufen bin und die ich unter allen Umständen aufrecht erhalten muß. Ich wiederhole Ihnen, Herr Bürgermeister, daß ich es bedaure, Polizeimaßregeln verhängen zu müssen, die vielleicht schwer empfunden werden, aber die Stadt hat sich das selbst zuzuschreiben.“
„Wir sind es gewohnt, daß Excellenz sich in solchen Fällen nie von Rücksichten bestimmen lassen,“ sagte der Bürgermeister mit Schärfe. „Es bleibt mir also nur übrig, Ihnen, die volle Verantwortlichkeit zu lassen – und damit wäre unser Gespräch ja wohl zu Ende.“
Der Freiherr verneigte sich kühl. „Ich wüßte nicht, daß ich mich jemals der Verantwortung für meine Maßnahmen entzogen hätte; es wird auch diesmal nicht geschehen. Leben Sie wohl, meine Herren!“
Der Bürgermeister und der Polizeidirector verließen das Gemach und schritten durch die weiten Gänge des Regierungsgebäudes dem Ausgange zu. Auf dem Wege konnte der Erstere, ein etwas cholerischer alter Herr mit grauen Haaren, nicht umhin, seinem lang zurückgehaltenen Aerger Luft zu machen.
„Also haben wir mit all unsern Bitten, Mahnungen und Vorstellungen wieder einmal nichts erreicht, als ein souveränes: ‚Es bleibt dabei!‘“ sagte er zu seinem Begleiter. „Auch Sie scheinen sich diesem berühmten Lieblingswort Seiner Excellenz zu beugen. Ihre Opposition verstummte davor sofort.“
Der Polizeidirector, ein noch jüngerer Mann mit scharfen klugen Zügen und sehr höflichen Manieren, zuckte die Achseln. „Der Freiherr ist oberster Chef der Verwaltung, und da er erklärt hat, mich auf alle Fälle mit seiner Verantwortlichkeit zu decken, so –“
„Fügen Sie sich seinem Willen,“ ergänzte der Andere. „Im Grunde ist das nur natürlich. Sie haben schwerlich Lust, das Schicksal Ihres Amtsvorgängers zu theilen.“
„Jedenfalls hoffe ich meiner Stellung besser gewachsen zu sein als er,“ war die artige, aber bestimmte Antwort. „So viel ich weiß, wurde mein Vorgänger wegen Unfähigkeit auf einen anderen Posten versetzt.“
„Da irren Sie sehr. Er fiel, weil er dem Freiherrn von Raven nicht genehm war, und sich bisweilen herausnahm, eine andere Meinung als Dieser zu haben. Er mußte dem allmächtigen Willen weichen, der uns nun so lange schon unumschränkt regiert. Das heutige Auftreten unseres Gouverneurs wird Ihnen besser als eine monatelange Amtsdauer gezeigt haben, wie die ‚hiesigen Verhältnisse‘ eigentlich liegen, und Sie haben bereits Ihre Partei gewählt, wie mir scheint.“
Die letzten Worte klangen sehr anzüglich, aber der Polizeidirector schien das nicht zu bemerken; er lächelte nur verbindlich, ohne etwas zu erwidern, und da sie den Ausgang jetzt erreicht hatten, trennten sich die beiden Herren.
Im Zimmer des Freiherrn war Dieser mit dem Oberst zurückgeblieben. Letzterer, der Commandant des Regimentes, das die Garnison von R. bildete, war eine echt militärische Erscheinung, aber trotzdem und trotz seiner Uniform und Orden vermochte er doch nicht den Vergleich mit der gebietenden Gestalt des Gouverneurs auszuhalten, der den einfachen Civilanzug trug.
„Sie sollten nicht allzu schroff vorgehen, Excellenz,“ nahm der Oberst das Gespräch wieder auf. „Man sieht höheren Ortes diese fortwährenden Conflicte mit der Bürgerschaft sehr ungern.“
„Glauben Sie, daß ich diese Conflicte liebe?“ fragte der Freiherr. „Aber Nachgiebigkeit wäre hier Schwäche, und die wird man mir hoffentlich nicht zumuthen.“
Der Andere schüttelte mit dem Ausdruck der Besorgniß den Kopf. „Sie wissen, daß ich einige Wochen lang in der Residenz war,“ begann er von Neuem. „Ich habe viel im Ministerium verkehrt. Im Vertrauen gesagt, die Stimmung ist dort keine für Sie günstige. Man liebt Sie durchaus nicht.“
„Das weiß ich,“ sagte Raven kalt. „Ich bin den Herren von jeher unbequem gewesen. Ich war ihnen nie fügsam, nie devot genug, und überdies können sie mir meine bürgerliche Herkunft nicht verzeihen. Meine Carrière war nun einmal nicht zu hindern, aber Sympathie habe ich in jenen Kreisen nie besessen.“
„Eben deshalb sollten Sie vorsichtig sein. Es werden Versuche gemacht, Ihre Stellung zu erschüttern. Man spricht von Willkür, von Uebergriffen, und all Ihre Maßregeln werden in schärfster, oft in gehässigster Weise besprochen und kritisirt. Fürchten Sie nicht die gegen Sie gesponnenen Intriguen?“
„Nein, denn ich bin den maßgebenden Persönlichkeiten allzu nothwendig und werde dafür sorgen, daß diese Nothwendigkeit bestehen bleibt, trotz meiner ‚Willkür‘ und meiner ‚Uebergriffe‘. Ich kenne am besten die Schwierigkeiten meiner hiesigen Stellung; [161] sie finden so leicht keinen Zweiten, der dem ersten Posten in dieser Provinz und in diesem widerspenstigen, ewig oppositionslustigen R. gewachsen ist. Aber ich danke Ihnen trotzdem für die Warnung, die vollständig mit meinen eigenen Nachrichten übereinstimmt.“
„Ich wollte Ihnen wenigstens einen Wink geben,“ sagte der Oberst abbrechend. „Aber jetzt muß ich fort. Sie erwarten heute noch Besuch, wie ich höre.“
„Meine Schwägerin, die Baronin Harder, und ihre Tochter,“ erklärte der Freiherr, seinen Gast bis zur Thür begleitend. „Sie haben einen Theil des Sommers in der Schweiz zugebracht und wollen heute eintreffen. Ich erwarte sie jede Minute.“
„Ich habe die Frau Baronin vor einigen Jahren in der Residenz kennen gelernt,“ warf der Officier flüchtig hin, „und ich hoffe die Bekanntschaft bald zu erneuern. Darf ich bitten, der Dame vorläufig meine Empfehlung zu überbringen? Auf Wiedersehen, Excellenz!“ –
Eine halbe Stunde später rollte ein Wagen in das Portal des Regierungsgebäudes, und Freiherr von Raven kam die große Haupttreppe herunter, um die erwarteten Gäste zu begrüßen.
„Mein lieber Schwager, wie glücklich bin ich, Sie endlich wieder zu sehen!“ rief die im Wagen sitzende Dame, indem sie mit großer Lebhaftigkeit und Zärtlichkeit dem Herantretenden die Hand entgegenstreckte.
„Seien Sie mir willkommen, Mathilde!“ sagte Raven mit seiner gewohnten kühlen Artigkeit, die auch nicht um einen Grad wärmer wurde, als er den Schlag öffnete und seiner Schwägerin beim Aussteigen behülflich war. „Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Es war heute etwas zu heiß für die Reise.“
„O entsetzlich! Die lange Fahrt hat mich völlig nervös gemacht. Wir beabsichtigten anfangs, einen Tag in E. auszuruhen, aber uns trieb die Sehnsucht, unsere theuren Verwandten so bald wie möglich zu begrüßen.“
Der „theuere Verwandte“ nahm das Compliment sehr gleichgültig hin. „Sie hätten immerhin in E. bleiben sollen,“ meinte er. „Aber wo ist das Kind – Gabriele?“
Die junge Dame, die soeben den Wagen verließ und, ohne eine Hülfe abzuwarten, leichtfüßig auf den Boden sprang, wurde bei dieser höchst beleidigenden Frage von einer hellen Zornröthe übergossen. Aber auch der Freiherr stutzte und heftete einen langen erstaunten Blick auf das „Kind“, das er drei volle Jahre nicht gesehen hatte, und dessen Anblick ihn jetzt sehr zu überraschen schien. Doch sein Erstaunen und Gabrielens Triumph darüber dauerte nicht lange.
„Ich freue mich, Dich zu sehen, Gabriele,“ sagte er ruhig, und sich niederbeugend, berührte er mit den Lippen leicht ihre Stirn. Es war dieselbe flüchtige, gleichgültige Liebkosung, die er einst dem vierzehnjährigen Mädchen hatte zu Theil werden lassen, und dabei streiften seine dunklen, strengen Augen ihr Antlitz mit einem einzigen, aber so scharfen und prüfenden Blicke, als wolle er damit zugleich ihr ganzes Innere ergründen. Dann aber reichte er seiner Schwägerin den Arm, um sie in das obere Stockwerk hinauf zu führen, und überließ es der jungen Dame, ihnen zu folgen.
Die Baronin ergoß sich in einen Strom von Redensarten und Liebenswürdigkeiten, die nur einsilbig beantwortet wurden, aber das hemmte nicht ihren Redefluß, der erst stockte, als sie den Flügel erreicht hatten, in welchem die für die Damen bestimmten Zimmer lagen.
„Das ist Ihre Wohnung, Mathilde,“ sagte der Freiherr, auf die geöffneten Räume deutend. „Ich hoffe, daß sie nach Ihrem Geschmack ist. Diese Klingel ruft die Dienerschaft herbei. Sollten Sie irgend etwas vermissen, so bitte ich, es mir mitzutheilen. Jetzt aber möchte ich Sie allein lassen. Sie und Gabriele sind jedenfalls müde von der Reise und bedürfen der Ruhe. Bei Tische sehen wir uns wieder.“
Er ging, offenbar froh, sich der lästigen und unbequemen Pflicht des Empfanges entledigt zu haben. Kaum hatte sich die Thür hinter ihm geschlossen, als die Baronin, nachdem sie die Reiseumhüllung abgelegt, sofort begann, die Umgebung zu mustern. Die vier Zimmer waren mit großer Eleganz, sogar mit Pracht eingerichtet, das Meublement sehr reich, die Vorhänge und Teppiche von den schwersten Stoffen. Ueberall war auf die Ansprüche und Bedürfnisse vornehmen Besuchs Rücksicht genommen; kurz, es blieb auch nicht das Geringste zu wünschen übrig, und sehr befriedigt kehrte Frau von Harder von ihrem Rundgange zurück, als sie gewahrte, daß ihre Tochter noch in Hut und Reisemantel inmitten des ersten Zimmers stand.
„Willst Du denn nicht ablegen, Gabriele?“ fragte sie. „Wie findest Du die Wohnung? Gott sei Dank, endlich einmal wieder gewohnte Umgebungen, nachdem wir so lange in der Dürftigkeit unseres schweizer Exils geseufzt haben!“
Gabriele achtete nicht auf die Worte. „Mama, ich mag den Onkel Raven nicht.“ sagte sie plötzlich mit vollster Entschiedenheit.
Der Ton war so ungewöhnlich, so ganz abweichend von der sonstigen Art der jungen Dame, daß die Mutter sie erstaunt anblickte.
„Aber Kind, Du hast ihn ja kaum gesehen.“
„Gleichviel, ich mag ihn nicht. Er behandelt uns mit einer Gleichgültigkeit, einer Herablassung, die geradezu beleidigend ist. Ich begreife nicht, wie Du einen solchen Empfang hinnehmen konntest.“
„Nicht doch,“ beruhigte die Baronin, „diese Kürze und Abgemessenheit liegt nun einmal in der Art meines Schwagers. Du wirst Dich daran gewöhnen, wenn Du ihn erst näher kennen und lieben lernst.“
„Niemals!“ rief Gabriele heftig. „Wie kannst Du verlangen, Mama, daß ich den Onkel Arno lieben soll; ich habe ja immer nur Schlimmes von ihm gehört. Du sagtest, er sei ein Tyrann ohne Gleichen, Papa nannte ihn nie anders als den Emporkömmling, den Glücksritter, und doch wagtet Ihr beide niemals, ihm ein unfreundliches Wort zu sagen –“
„Kind, um Gotteswillen schweig’!“ unterbrach sie die Mutter, sich erschrocken umblickend, ob auch Niemand die verfänglichen Worte gehört habe. „Vergißt Du denn ganz, daß wir vollständig von der Güte Deines Onkels abhängen? Er ist unversöhnlich, wo er sich beleidigt glaubt. Du darfst ihm niemals mit einem Widerspruch entgegentreten.“
„Weshalb hattet Ihr denn Alle so großen Respect vor ihm, wenn er nichts weiter als ein Glücksritter war?“ fuhr Gabriele beharrlich fort. „Warum gab ihm der Großpapa seine Tochter zur Frau? Warum war er immer die Hauptperson in der Familie? – ich begreife das nicht.“
„Weiß ich es?“ fragte die Baronin mit einem Seufzer. „Die Macht, die diese Mann ausübt, ist mir von jeher ebenso unerklärlich gewesen, wie die Vorliebe Deines Großvaters für ihn. Er, mit seinem bürgerlichen Namen und seiner damals noch so untergeordneten Stellung, hätte den Eintritt in unsere Familie als eine hohe Gunst, als ein unverdientes Glück ansehen müssen, und er nahm es hin, als ob ihm damit nur sein Recht geschähe. Kaum hatte er in unserem Hause festen Fuß gefaßt, als er auch schon Alles beherrschte, von meiner Schwester an bis zur Dienerschaft herab, die größere Furcht vor ihm hegte, als vor ihrem Herr selber. Meinen Vater hatte er so vollständig in der Gewalt, daß nichts ohne seinen Rath und Beistand geschah, und alle Uebrigen unterdrückte er einfach. Wie es eigentlich geschah, das weiß ich nicht – genug es geschah, und wie in unserem Familienkreise, so riß er auch in der Gesellschaft und in seiner Carrière die Herrschaft an sich – es wagte Niemand ihm entgegenzutreten.“
„Nun, mich soll er nicht unterdrücken,“ rief das junge Mädchen, das Köpfchen trotzig zurückwerfend. „O, er dachte auch mich zu schrecken mit seinen finstern Augen, die sich so tief einbohren, als wollten sie einem die geheimsten Gedanken aus der Seele lesen, aber ich fürchte mich ganz und gar nicht davor. Wir wollen doch sehen, ob er auch mich zwingt, wie all die Anderen.“
Die Baronin erschrak; sie fürchtete nicht mit Unrecht, ihre sehr verzogene Tochter, die der Mutter gegenüber eine unbedingte Herrschaft behauptete und überhaupt nicht gewohnt war, sich Zwang aufzuerlegen, werde auch dem Freiherrn gegenüber ihrem Eigensinne die Zügel schießen lassen. Sie erschöpfte sich daher in Bitten und Vorstellungen, aber vergebens – Fräulein Gabriele schien ein eigenes Vergnügen in dem angesprochenen Trotze gegen ihren Vormund zu finden und war durchaus nicht geneigt, die bereits eingenommene kriegerische Stellung ihm gegenüber [162] aufzugeben. Ueberdies war sie schon ungewöhnlich lange ernst gewesen und kehrte nun schleunigst zu dem alten Uebermuthe zurück.
„Mama, ich glaube, Du fürchtest Dich im vollen Ernste vor diesem Währwolf von Onkel,“ rief sie fröhlich auflachend. „Da bin ich tapferer. Ich trete ihm gerade unter die Augen, und – verlaß Dich darauf! – mich verschlingt er nicht.“
Das Regierungsgebäude von R. war ein ehemaliges Schloß und lange Jahre hindurch der Wohnsitz einer fürstlichen Familie gewesen. Später war es an den Staat gefallen und diente jetzt zum Sitz der Provinzialregierung und zum Aufenthalte des jeweiligen Gouverneurs. Das große, weitläuftige Gebäude lag auf einer Anhöhe, oberhalb der Stadt, und hatte sich trotz seiner jetzigen Bestimmung noch einen Theil seines mittelalterlichen Ansehens bewahrt. Die vorspringenden Thürme und Erker und die hohe, die ganze Umgebung beherrschende Lage gaben ihm etwas Malerisches. Die alten Mauern und Befestigungen waren freilich schon längst der Neuzeit gewichen, aber dafür umrauschte jetzt ein ganzer Wald prächtiger Bäume den Schloßberg, an dessen Vorderseite ein breiter, bequemer Weg in die Stadt hinunterführte. Von den Fenstern des Schlosses, das sich stolz und mächtig über die Baumwipfel emporhob, genoß man den vollen Blick über die Stadt und das ganze weite Thal, das die Berge wie mit einem Kranze umgaben. Das Hauptgebäude war ausschließlich zur Verfügung des Gouverneurs gestellt, der das obere Stockwerk bewohnte, während sich in dem unteren seine Kanzlei befand; die beiden Seitenflügel enthielten die übrigen Bureaus und die Dienstwohnungen einzelner Beamten. Trotz dieser Einrichtung war auch dem Inneren sein alterthümlicher Charakter geblieben, der sich nicht verwischen ließ, weil er in der Bauart lag. Die gewölbten Zimmer mit ihren tiefen Thür- und Fensternischen gehörten noch dem vorigen Jahrhunderte an; lange, düstere Bogengänge und Galerien kreuzten sich in den verschiedensten Richtungen; hallende Steintreppen führten von einem Stockwerke in das andere, und der alte Schloßhof wie der ehemalige Schloßgarten waren noch ganz in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten. Jedenfalls war und blieb das „Schloß“, wie es kurzweg in der ganzen Umgegend genannt wurde, eine Zierde der Stadt.
Der jetzige Gouverneur bekleidete schon seit einer ganzen Reihe von Jahren seinen Posten. Hätte man nicht gewußt, daß er der Sohn eines mittellosen, früh verstorbenen Subalternbeamten war, man würde an seiner bürgerlichen Herkunft gezweifelt haben, denn sein Auftreten und seine Art zu leben waren so durch und durch aristokratisch, wie der Eindruck seiner Persönlichkeit. Wie Raven eigentlich der Günstling des damals allmächtigen Ministers geworden war, dem er seine spätere Laufbahn verdankte, das wußte Niemand. Vermuthlich hatte der Scharfblick des Ministers in dem jungen Manne eine ungewöhnliche Begabung entdeckt. Einige wollten auch wissen, daß noch andere geheime Beweggründe dabei mitgewirkt hätten; genug, er wurde urplötzlich zum Secretär Seiner Excellenz ernannt und hatte in dieser Eigenschaft nun freilich mehr Gelegenheit, seine Fähigkeiten zu entwickeln, als in der bisherigen untergeordneten Stellung. Der Secretär avancirte bald genug zum Vertrauten seines Chefs, der ihn bei jeder Gelegenheit bevorzugte und beförderte und ihm sogar seinen Familienkreis öffnete. Die unteren Stufen des Beamtenthums wurden rasch überwunden, und eines Tages wurden die vornehmen Kreise der Residenz mit der anfangs kaum geglaubten Nachricht überrascht, daß die älteste Tochter des Ministers sich dem jungen Ministerialrath verlobt habe. Allerdings erfolgte bald darauf dessen Erhebung in den Freiherrnstand, und damit war ihm die große Carrière geöffnet.
Der Schwiegersohn des einflußreichen Mannes fand überall die Bahn frei, aber es war nicht dies allein, was ihn so schwindelnd schnell emportrug. Seine in der That glänzende Begabung schien jetzt erst ihr eigentliches Feld gefunden zu haben und zeigte sich bald in einer Weise, die jede Begünstigung von anderer Seite überflüssig machte. Schon nach wenigen Jahren fand man die „Unbegreiflichkeit“ des Ministers, der, statt sich dieser Heirath zu widersetzen, sie begünstigt hatte, vollkommen begreiflich; er kannte seinen Schwiegersohn; er wußte, was von dessen Zukunft zu erwarten war, und seine Tochter spielte als Frau von Raven jedenfalls eine glänzendere Rolle, als ihre Schwester, die einen Baron von altem Adel, aber sehr unbedeutender Persönlichkeit geheirathet hatte.