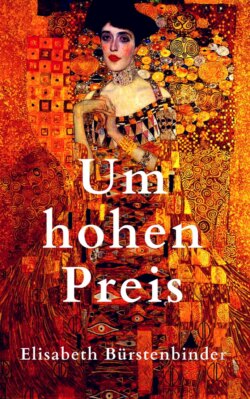Читать книгу Um hohen Preis - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление[207] Das Wort kam sehr trotzig und entschieden von den Lippen der jungen Dame; sie schien wieder einmal in kriegerischer Stimmung und fest entschlossen zu sein, den gefürchteten Vormund zu reizen, aber vergebens; er blieb vollkommen gelassen und schien den Widerspruchsgeist seines Mündels eher belustigend als beleidigend zu finden.
„Ein Glück, daß Deine Mutter nicht zugegen ist!“ bemerkte er. „Sie würde wieder in Todesangst gerathen über den Trotzkopf, der sich so gar nicht der Nothwendigkeit fügen will, wie sie es mit großer Selbstverleugnung thut. Du solltest Dir an ihr ein Beispiel nehmen.“
„O ja, Mama ist die Nachgiebigkeit selbst gegen Dich,“ rief Gabriele, immer erregter werdend, „und sie muthet das auch mir zu. Aber ich will nicht heucheln, und lieben kann ich Dich nicht, Onkel Arno, denn Du bist nicht gut gegen uns und bist es nie gewesen. Gleich Dein erster Empfang war so demütigend, daß ich am liebsten sofort wieder abgereist wäre, und seitdem hast Du uns täglich und stündlich empfinden lassen, daß wir von Dir abhängig sind. Du behandelst meine Mama mit einer Nichtachtung, die mir oft genug das Blut in’s Gesicht treibt. Du sprichst in wegwerfender Weise von meinem Papa, von ihm, der todt ist und sich nicht mehr vertheidigen kann, und mich behandelst Du wie ein Spielzeug, mit dem man es überhaupt nicht ernst nimmt. Du hast uns aufgenommen, und wir leben in Deinem Schlosse, wo Alles viel reicher und glänzender ist, als in meinem Elternhause, aber ich wäre doch weit lieber in unserem schweizer Exil, wie Mama es nennt, in unserem kleinen Landhause am See, wo Alles so einfach und bescheiden war, wo wir kaum das Nothwendige hatten, aber wo wir frei waren von Dir und Deiner Tyrannei. Mama verlangt, ich soll sie geduldig ertragen, weil Du reich bist und meine Zukunft von Dir abhängt, aber ich will Dein Vermögen nicht; ich frage nicht darnach, ob Du mich zur Erbin einsetzest. Ich möchte fort von hier, je eher, desto lieber.“
Sie war aufgesprungen und stand jetzt in leidenschaftlichster Erregung vor ihm, den kleinen Fuß energisch vorgesetzt, den Kopf zurückgeworfen, die Augen voll von Thränen des Zornes und der Erbitterung, aber es lag doch mehr in diesem stürmischen Ausbruch als nur der Trotz eines eigensinnigen Kindes. Jedes Wort verrieth die tiefste, innerste Gekränktheit, und es war nur allzu viel Wahres in den Anklagen, die sie dem Vormunde so kühn in’s Antlitz schleuderte.
Raven hatte sie mit keiner Silbe unterbrochen; er sah sie unverwandt an, und als sie jetzt schwieg und die Hände tiefathmend gegen die Brust preßte, während ein Thränenstrom aus ihren Augen stürzte, beugte er sich plötzlich zu ihr nieder und sagte mit tiefem Ernste: „Weine nicht, Gabriele! Dir wenigstens habe ich Unrecht gethan.“
Gabrielens Thränen stockten; jetzt, wo sie zur Besinnung kam, wurde ihr erst die ganze Unvorsichtigkeit ihrer Worte klar. Sie hatte sicher einen Ausbruch des Zornes erwartet – und nun statt dessen diese unbegreifliche Ruhe stumm, fast scheu sah sie zu Boden.
„Also Du willst mein Vermögen nicht?“ fuhr der Freiherr fort. „Was weißt Du denn überhaupt davon, wen ich zu meinem Erben einzusetzen denke? Ich habe Dir meines Wissens niemals etwas darüber mitgetheilt, und doch scheint es Gegenstand sehr eingehender Erörterungen zwischen Dir und Deiner Mutter gewesen zu sein.“
Das junge Mädchen wurde glühend roth. „Ich weiß nicht – wir haben nie –“
„Laß den Versuch, es zu leugnen, Kind!“ unterbrach sie Raven. „Noch hast Du die Unwahrheit so wenig gelernt, wie die Berechnung; sonst würdest Du mir nicht so gegenübertreten. Ich zürne Dir deshalb nicht; den Trotz kann ich verzeihen; die planmäßige Berechnung und Heuchelei hätte ich Dir bei Deinen siebenzehn Jahren nie verziehen. Gott sei Dank, die Erziehung hat noch nicht so viel verdorben, wie ich fürchtete.“
Er nahm ruhig, als wäre nichts vorgefallen, ihre Hand, zog sie auf die Bank nieder und setzte sich neben sie. Gabriele machte einen Versuch, seitwärts zu rücken.
„Nun, Du wirst mir doch gestatten, Deine Kriegserklärung in aller Form entgegen zu nehmen?“ sagte der Freiherr. „Deine Mutter wird sich ihr freilich nicht anschließen, wenigstens nicht in so offener Weise. Sie hat Dir jedenfalls größere Liebenswürdigkeit gegen den ‚Emporkömmling‘ zur Pflicht gemacht.“
„Wie meinst Du?“ fragte das junge Mädchen betreten.
„Nun, das kann Dir doch unmöglich fremd sein. So viel ich weiß, war es die specielle Bezeichnung meiner Persönlichkeit in Deinem Elternhause.“
Diesmal hielt Gabriele tapfer den scharfen Blick aus, der auf ihrem Gesichte ruhte. „Ich weiß, meine Eltern liebten Dich nicht,“ entgegnete sie. „Du hast ihnen aber auch von jeher feindlich gegenüber gestanden.“
[208] „Ich ihnen? Oder sie mir? Doch das kommt schließlich auf eins heraus. Das sind Dinge, die Du noch nicht beurtheilen kannst, Gabriele. Du hast keine Ahnung davon, was es heißt, mit einer Lebensstellung, wie die meinige war, in eine hocharistokratische Familie und in deren Gesellschaftskreise zu treten. Ich habe dort stets nur einen Freund gehabt, Deinen Großvater; bei allen Anderen habe ich mir meinen Platz erst erobern müssen, und dazu giebt es nur zwei Wege. Entweder man beugt sich geduldig all den Demüthigungen, die auf das Haupt des Emporkömmlings gehäuft werden, man zeigt sich tief durchdrungen von der hohen Ehre, deren man gewürdigt ist, und begnügt sich damit, geduldet zu sein – darnach war meine Natur nicht geartet. Oder man wirft sich zum Herrn der ganzen Gesellschaft auf, man läßt sie fühlen, daß es noch eine andere Macht giebt, als die ihrer Stammbäume, und setzt bei jeder Gelegenheit ihrer Ueberhebung und ihren Vorurtheilen den Fuß auf den Nacken; dann lernen sie sich beugen. Es ist im Allgemeinen viel leichter die Menschen zu unterdrücken, als man glaubt; man muß es nur verstehen, ihnen zu imponiren, darin liegt das ganze Geheimniß des Erfolges.“
Gabriele schüttelte leise den Kopf. „Das sind harte Grundsätze.“
„Das sind die Erfahrungen der dreißig Jahre, die ich vor Dir voraus habe. Denkst Du, ich habe nicht auch meine Ideale gehabt, meine Träume und meine Begeisterung? Denkst Du, es hat hier nicht auch geflammt mit all den heißen Empfindungen der Jugend? Aber das nimmt ein Ende, wenn man im Leben vorwärtsschreitet. In eine Laufbahn wie die meinige konnte ich die Träume nicht mit hinübernehmen. Sie halten am Boden fest, und ich wollte emporsteigen und bin emporgestiegen. Ich habe freilich einen hohen Preis dafür gezahlt, zu hoch vielleicht – gleichviel, ich habe es erreicht.“
„Und bist Du glücklich dadurch geworden?“ Die Frage kam fast unwillkürlich von den Lippen des jungen Mädchens.
Raven zuckte die Achseln. „Glücklich! Das Leben ist ein Kampf, keine Glückseligkeit. Man wirft den Gegner oder wird geworfen; ein Drittes giebt es nicht. Du freilich siehst das alles noch mit anderen Angen an. Dir ist das Leben noch ein Sommertag, wie er da draußen leuchtet. Du glaubst noch, daß dort in jener schimmernden Ferne, hinter jenen blauen Bergen ein ganzes Eden voll Glück und Seligkeit liegt – Du täuschest Dich, Kind. Die goldene Sonne scheint über unendlich viel Jammer und Erbärmlichkeit, und hinter den blauen Bergen ist auch nichts weiter, als der mühselige Weg von der Wiege zum Grabe, den wir uns noch mit so viel Haß und Streit würzen. Das Leben ist nur dazu da, um jeden Tag neu überwunden zu werden, und die Menschen – um sie zu verachten.“
Es lag eine unbeschreibliche Härte und Herbheit in diesen Worten, aber auch die ganze Entschiedenheit des Mannes, der einen ihm unerschütterlich gewordenen Glaubenssatz ausspricht. Die tiefe Bitterkeit freilich, welche hindurchwehte, entging dem jungen Mädchen, das halb beklommen und halb empört zuhörte.
„Aber schließlich kommt doch die Zeit, wo man dieses ewigen Kampfes überdrüssig wird,“ fuhr Raven fort, „wo man sich fragt, ob die einst erträumte Höhe es denn werth war, sein Alles dafür einzusetzen, wo man die Summe all dieses ruhelosen Jagens und Ringens, all dieser Erfolge zieht und des ganzen Spiels herzlich müde wird. Ich bin oft müde – recht müde.“
Er lehnte sich zurück und sah in die Ferne hinaus, es lag ein finsterer Schmerz in diesem Blicke, und die tiefe Müdigkeit, von der er sprach, verrieth sich auch in seiner Stimme. Gabriele schwieg, auf’s Höchste betroffen von der tiefernsten Wendung, die das Gespräch genommen hatte, das auch sie auf ganz unbekannte Bahnen führte. Sie hatte bisher nur den eisernen, unzugänglichen Mann gekannt, mit seiner kalten Ruhe und seinen Gebietertone. Selbst sein Benehmen gegen sie war immer nur die Herablassung zu dem Ideenkreise eines Kindes gewesen; er hatte nie anders zu ihr gesprochen, als in jener halb gütigen, halb spottenden Weise, in der auch heute ihr Gespräch begann. Zum ersten Male öffnete sich diese sonst so streng verschlossene Natur in einem Augenblick der Selbstvergessenheit, Gabriele sah in eine Tiefe, die sie nicht geahnt hatte, und die sich auch wohl keinen Anderen aufthat, aber sie fühlte instinctmäßig, daß sie nicht daran rühren und nicht heraufbeschwören durfte, was sich da unten regte.
Es folgte eine lange Pause. Beide blickten schweigend in die weite Landschaft hinaus, die in dem heißen Lichte eines der letzten Augusttage vor ihnen lag. Der Sommer schien vor seinem Scheiden noch einmal all seine Gluth und Pracht über die Erde auszuschütten. Der hellste Sonnenschein umfloß die alterthümliche Stadt, die mit ihren Häusern und Thürmen sich am Fuß des Schloßberges ausbreitete; er lag über all den Wiesen und Feldern, über all den Ortschaften, die sich bald näher, bald ferner dem Auge zeigten, und blitzte in den Wellen des Flusses, der in mächtigen Windungen durch das Thal zog. Um dasselbe schlossen sich die Berge, wie zu einem Kranze, bald in weichgeschwungenen Linien, bald in zackig kühnen Formen aufstrebend, mit grünen Triften und dunklen Wäldern, aus denen hier und da eine weiße Wallfahrtskirche hervorleuchtete, oder eine altersgraue Bergveste sich erhob. Ganz in der Ferne stieg in blauen Dust verloren das Hochgebirge auf, das als erhabener Hintergrund den Horizont begrenzte, und über dem Allen lächelte ein tiefblauer Himmel und schwebte goldiger Sonnenduft, der den ganzen Aether zu erfüllen schien. Es war einer jener Tage, wo Alles wie in Licht und Glanz getaucht, Alles davon überfluthet ist, als gäbe es auf der ganzen Welt nichts weiter, als nur Sonnenschein.
Es konnte keinen schärferen Gegensatz geben, als diese sonnige Landschaft und den tiefen, kühlen Schatten des Schloßgartens mit seiner düstern Einsamkeit. Die riesigen Kronen der Linden, mit ihren dicht verschlungenen Aesten, hielten den ganzen Raum wie mit einer grünen Dämmerung umsponnen und unter den hohen Baumwipfeln rauschte einförmig die Fontaine. In ewigem Wechsel stieg der helle Strahl empor, um dann tausendfach zersprüht wieder niederzusinken. Bisweilen, wenn ein Sonnenstrahl, der sich hier unten verlor, die fallenden Tropfen streifte, funkelte und glänzte es, wie mit Diamantenpracht, aber sie erlosch schon im nächsten Moment. Alles lag wieder im kühlen Schatten, und durch den nebelhaften Wasserschleier blickten die grauen Gestalten der Nixen mit den langen Haaren und den steinernen Häuptern gespenstig hindurch.
Die stille, schwüle Mittagsstunde schien Alles in träumerische Ruhe zu wiegen; kein Vogel flatterte auf; kein Blatt regte sich mehr, nur der Nixenbrunnen rauschte geheimnißvoll durch die tiefe Stille. Es war die Sprache des Quelles, der seit undenklichen Zeiten hier auf dem Schloßberge rieselte, und seit länger als einem Jahrhundert in diesem Steingewand, in das man ihn gezwungen, der treue Gefährte des Schloßgartens gewesen war. Auch an ihm waren jene Zeiten vorübergehuscht, die einst die alte Bergveste geschaut hatte, die ursprünglich an der Stelle des Schlosses stand, wilde, gewaltthätige Zeiten, voll Kampf und Streit, voll Sieg und Niederlage und dann wieder Jahre des Glanzes und der Pracht, als der Fürstensitz sich hier erhob. Weltereignisse waren vorübergezogen; Geschlechter waren gekommen und gegangen, bis endlich die neue Zeit kam, die Allem eine andere Gestalt gab. Allen, nur dem Quelle des Schloßberges nicht, um den Sage und Aberglauben eine heilige Schutzmauer gewoben hatten. Aber jetzt war auch seine Zeit gekommen; die alten Steinbilder, welche ihn so lange schützend umgaben, sollten fallen, und er selbst sollte niedersteigen aus dem hellen Tageslichte in die dunkle Erde, um dort auf immer gebannt zu bleiben.
Ob es Klagen oder Erinnerungen waren, die der Quell flüsterte, sein träumerisches Rauschen übte eine seltsame Macht auf den ernsten, finsteren Mann, der nie das einsame Träumen und seine Poesie gekannt hatte, wie auf das junge, blühende Mädchen an seiner Seite, das bisher lachend und spielend durch das Leben geflattert war, ohne seinen Ernst auch nur zu ahnen. Es löste all jenes heiße Ringen und Streben, all diese frohen Kinderträume in eine einzige räthselhafte Empfindung, welche die Beiden halb süß und halb beängstigend umspann. Unter diesem einförmigen und doch so melodischen Rieseln und Rauschen wich die Welt da draußen mit ihrer schimmernden Ferne und ihrem leuchtenden Sonnengold weit und weiter zurück, und endlich versank sie ganz. Dann legte es sich um die beiden Zurückgebliebenen wie düstere Schatten, wie kühle Wasserschleier, und [209] sie wurden fortgezogen, weit fort in geheimnißvoll dämmernde Tiefen, wohin kein Laut des Lebens mehr drang, wo alles Ringen und Sehnen, alles Glück und Weh erstarb in einem tiefen, tiefen Traum, und mitten in dem Traume vernahmen sie wieder das leise, geisterhafte Singen des Quelles, das wie aus endloser Ferne zu ihnen niedertönte. –
Unten in der Stadt setzten die Glocken zum Mittagsgeläut ein. Die weichen, hellen Klänge schwebten herauf zu dem Schloßberge, und vor diesem Laut zerrannen die seltsamen Gebilde, welche jenes Rauschen gesponnen. Raven sah auf, als sei er unangenehm geweckt worden, während Gabriele sich rasch erhob und mit einer Bewegung, die fast der Flucht glich, an die epheuumrankte Mauerbrüstung trat, um dort vorgebeugt den Klängen zu lauschen. Sie zogen weithin durch die stille Luft, wie damals am Seeufer, als sie mit Georg – Gabriele vollendete den Gedanken nicht. Warum drängte sich auf einmal Georg’s Name wie mit einem Vorwurf in ihr Gedächtniß? Warum stand sein Bild plötzlich so deutlich vor ihr, als wolle es seine Rechte wahren und behaupten? Damals, als sie unter Scherz und Lachen von ihm Abschied nahm, hatten ihr die Glockenklänge gar nichts gesagt, heute durchzuckte es sie bei der Erinnerung jäh und schmerzlich, wie eine Mahnung, sich nicht wieder fortziehen zu lassen aus dem goldenen Sonnenlicht in unbekannte Tiefen, wie eine Warnung vor irgend einer dunkel geahnten Gefahr, die ihre Kreise um sie zog. Ihr war unbeschreiblich bang zu Muthe.
Auch der Freiherr hatte sich erhoben und trat jetzt zu ihr. „Du flüchtest ja förmlich,“ sagte er langsam. „Wovor denn? Vor mir vielleicht?“
Gabriele versuchte mit einem Lächeln ihrer Bangigkeit Herr zu werden, als sie erwiderte: „Vor dem Rauschen des Nixenbrunnens, es klingt so gespenstig in der stillen Mittagsstunde.“
„Und doch hast Du gerade ihn zum Lieblingsplatze gewählt?“
„Er ist ja die längste Zeit gewesen. Vielleicht verwandelt Dein Befehl ihn morgen schon in ein wüstes Chaos von Erde und Steinen, und –“
„Und ich frage nicht danach, ob meine Befehle Jemanden wehe thun,“ vollendete Raven, als sie inne hielt. „Das mag sein, aber – liebst Du den Quell wirklich so sehr, Gabriele? Würde es Dir im Ernst wehe thun, ihn vernichtet zu sehen?“
„Ja,“ sagte Gabriele leise und hob das Auge empor, ihr Mund sprach keine Bitte aus, aber die Augen, in denen eine Thräne schimmerte, baten heiß und innig für den bedrohten Quell.
Raven schwieg und wandte sich ab; einige Minuten lang stand er wortlos an ihrer Seite, dann begann er von Neuem:
„Ich habe Dich vorhin erschreckt mit meinen herben Lebensansichten. Wer sagt denn aber, daß Du sie theilen sollst? Ich vergaß, daß die Jugend ein Recht auf Träume hat, und daß es grausam ist, sie ihr zu nehmen. Glaube Du immerhin noch an die goldene Zukunftsferne, an die Verheißung jener blauen Berge! Du darfst noch der Welt und den Menschen vertrauen, und Du wirst auch schwerlich je ihren Haß erfahren.“
Seine Stimme klang eigenthümlich weich und verschleiert, und aus dem Blicke, der so düster auf dem jungen Mädchen ruhte, war alle Härte und Strenge gewichen, aber Arno Raven war nicht lange solchen Regungen zugänglich, und es schien auch, als dürfe er sich ihnen überhaupt nicht hingeben, denn gerade jetzt ertönten Schritte hinter ihnen, und als sie sich umwendeten, trat der Castellan des Schlosses mit einem älteren Manne, der dem Handwerkerstand anzugehören schien, in den Garten. Beide blieben stehen, als sie den Gouverneur gewahrten, und grüßten ehrerbietig.
Raven hatte schnell die ungewohnte Weichheit abgeschüttelt. „Was giebt es?“ fragte er, wieder ganz in dem kurzen, gebieterischen Tone, der ihm eigen war.
„Excellenz haben befohlen, den Nixenbrunnen abzubrechen und den Quell zu verstopfen,“ nahm der Handwerker das Wort. „Es sollte heute noch geschehen; meine Leute kommen in einer halben Stunde; ich wollte nur zuvor nachsehen, ob die Arbeit viel Zeit und Mühe kosten wird.“
Der Freiherr sah auf den Brunnen und dann auf Gabriele, die noch an seiner Seite stand; es war, ein kaum merkliches, sekundenlanges Zögern.
„Schicken Sie die Leute zurück!“ befahl er dann, „die Arbeit ist nicht mehr nöthig.“
„Wie meinen Excellenz?“ fragte der Handwerker erstaunt.
„Die Wegnahme des Brunnens würde den Garten schädigen; er bleibt stehen. Ich werde andere Bestimmungen treffen.“
Ein Wink mit der Hand verabschiedete die beiden Männer; sie wagten natürlich keinen Widerspruch, aber die Verwunderung prägte sich deutlich auf ihren Gesichtern aus, als sie den Garten verließen. Es war das erste Mal, daß ein mit so großer Bestimmtheit gegebener Befehl des Gouverneurs zurückgezogen wurde.
Raven war an den Rand der Fontaine getreten und blickte in den fallenden Tropfenregen. Gabriele stand noch drüben an der Mauerbrüstung; jetzt kam sie langsam, zögernd näher und streckte ihm dann plötzlich beide Hände hin.
„Ich danke Dir.“
Er lächelte, aber nicht mit dem gewohnten Sarkasmus – diesmal flog es wie Sonnenschein über seine Züge, als er die dargebotene Hand ergriff und zugleich mit der Linken sanft Gabrielens Haupt emporhob, um ihre Stirn zu küssen. Das war durchaus nichts Außergewöhnliches. Er pflegte es stets zu thun, wenn sie ihm beim Frühstücke den Morgengruß brachte, und sie hatte es bisher ebenso unbefangen hingenommen, wie der Vormund kühl und ernst von seinem väterlichen Rechte Gebrauch machte. Heute zum ersten Male wich das junge Mädchen unwillkürlich zurück, und Raven fühlte, wie die Hand, die er in der seinigen hielt, leise bebte. Er richtete sich plötzlich empor, ohne daß seine Lippen ihre Stirn berührt hatten, und ließ die Hand fallen.
„Du hast Recht,“ sagte er gepreßt. „Das Rauschen des Nixenbrunnens hat etwas Geisterhaftes – laß uns gehen!“
Sie wandten sich zum Gehen. Hinter ihnen rauschte und rieselte der Quell und warf unermüdlich seine weißen Wasserschleier empor. Die drohende Vernichtung war ja nun abgewendet; die Bitte jener braunen Augen und die Thräne darin hatte ihn gerettet, und der ernste, kalte Mann, der die Höhe des Lebens längst überschritten hatte, fühlte es vielleicht in diesem Augenblicke, daß er auch nicht gefeit war gegen den „Nixenzauber“.
Georg Winterfeld saß in seiner Wohnung am Schreibtische. Er sah angegriffen, fast leidend aus; die kurze Frische, welche die Reise seinem Aeußeren gegeben, war längst wieder geschwunden, und die Blässe, welche selbst damals die feinen, durchgeistigten Züge des jungen Mannes deckte, war noch um einen Schein tiefer geworden. Er muthete sich in der That bisweilen allzu viel in der Arbeit zu – die Pflichten seiner Stellung nahmen ihn schon hinreichend in Anspruch, aber trotzdem benutzte er jede freie Stunde, um sich mit rastlosem Eifer allen möglichen Studien hinzugeben, die ihm in seiner Laufbahn förderlich sein konnten. Georg arbeitete oft genug auf Kosten seiner Gesundheit; ihn trieb ein edlerer Sporn, als der Ehrgeiz, mit jedem Schritte, den er vorwärts that, minderte sich ja die Kluft, die ihn von der Geliebten trennte, und er war sich trotz aller persönlichen Bescheidenheit doch zu sehr seiner Kraft und seines Werthes bewußt, um nicht die zuversichtliche Hoffnung zu hegen, daß diese Kluft sich einst ganz ausfüllen werde. Seine Collegen, die sich meist auf ihre pflichtmäßigen Leistungen in den Bureaustunden beschränkten, wußten kaum von dieser stillen, angestrengten Thätigkeit des Assessors, der nie darüber sprach; nur das durchdringende Auge seines Chefs hatte herausgefunden, welch eine Summe von Arbeitskraft und Begabung in dem jungen Beamten lag, so wenig dieser auch bisher Gelegenheit gefunden hatte, sie nach außen hin zu bethätigen.
Georg benutzte mit Vorliebe die Morgenstunden zum Arbeiten; auch heute saß er über ein juristisches Werk gebeugt und hatte sich so darin vertieft, daß er das Oeffnen der Thür im vorderen Zimmer vollständig überhörte. Erst als eine bekannte Stimme sagte: „Bemühen Sie sich nicht! Ich finde schon allein den Weg zu dem Herrn Assessor,“ fuhr er auf. In dem gleichen Augenblicke trat der Ankömmling auch schon ein.
„Guten Morgen, Georg! Da bin ich.“
„Max! Ist es möglich? Wie kommst Du nach R.?“ rief Georg freudig überrascht, dem Freunde entgegeneilend.
[210] „Geradeswegs von zu Hause,“ versetzte dieser, die Begrüßung ebenso herzlich erwidernd. „Ich bin erst vor einer halben Stunde im Gasthofe angelangt und habe mich sogleich auf den Weg zu Dir gemacht.“
„Aber weshalb schriebst Du mir denn nicht einige Zeilen? Wolltest Du mich überraschen?“
„Das nicht, die Reise war vielmehr eine Art Ueberraschung für mich, denn es sind durchaus keine idealen Freundschaftsgefühle, die mich herführen, wie Du Dir vielleicht schmeichelst, sondern eine höchst reale Erbschaftsangelegenheit. Aber vor allen Dingen – wie geht es Dir? Du siehst blaß aus – natürlich, wenn man schon am frühen Morgen über den Büchern sitzt – Georg, Du bist unverbesserlich.“
Georg wehrte lachend die Hand des Freundes ab, der nach seinem Pulse greifen wollte, und zog ihn auf das Sopha. „Laß’ nur den Doctor bei Seite! Ich befinde mich vortrefflich. Also eine Erbschaftsangelegenheit führt Dich her? Sind Euch Reichthümer zugefallen?“
„Das gerade nicht,“ sagte Max. „Nur ein sehr bescheidenes Vermögen, der Nachlaß eines alten Vetters, der hier in der Umgegend von R. ein kleines Gut besitzt. Ich habe ihn gekannt. Er war mit meinem Vater wegen dessen politischer Vergangenheit vollständig zerfallen. Jetzt ist er ohne Testament und ohne directe Erben gestorben, und Papa erhielt, als der nächste lebende Verwandte, vom hiesigen Gericht die Aufforderung, seine Rechte geltend zu machen. Er persönlich kann das nun freilich nicht; Du weißt ja, daß er sein Vaterland nicht betreten darf, ohne sofort wieder in die Festung zu wandern, die er einst auf dem etwas ungewöhnlichen Wege der Strickleiter verlassen hat; das damalige Urtheil hängt ja noch immer über seinem Haupte. Also hat er mich als seinen Vertreter geschickt.“
„Du hast doch hinreichende Vollmacht?“ warf der Assessor ein.
„Die ausgedehnteste, aber trotzdem wird es Weitläufigkeiten und Formalitäten genug geben. Papas damalige Flucht und dauernde Entfernung verwickeln die Sache einigermaßen, und mein berüchtigter Demagogenname wird die Herren vom Gericht auch gerade nicht zu besonders liebenswürdigem Entgegenkommen veranlassen. Ich habe in dieser Voraussicht einen längeren Urlaub genommen und denke bis zur Erledigung der Sache in R. zu bleiben. Ich rechne sehr auf Deinen juristischen Rath und Beistand.“
„Ich stehe Dir ganz zur Verfügung. Vor allen Dingen aber gieb Dein Quartier im Gasthofe auf und komme zu mir! Ich habe Raum genug.“
„Das werde ich mit Deiner Erlaubniß nicht thun,“ sagte Max trocken.
„Weshalb nicht?“
„Weil ich Dir keine Unannehmlichkeiten mit Deinen Vorgesetzten zuziehen will. Oder kannst Du mir versichern, daß Dein Besuch bei uns ganz unbemerkt und ungerügt vorüber gegangen ist?“
Georg sah zu Boden. „Ich habe allerdings einige scharfe Worte von meinem Chef hinnehmen müssen, aber die Bevormundung und die Rücksicht auf meine Stellung hat ihre Grenzen. Meine Freundschaftsbeziehungen opfere ich ihr nicht.“
„Das brauchst Du auch nicht,“ erklärte der junge Arzt, „aber Du brauchst den Conflict auch nicht herauszufordern. Du weißt, ich halte gar nichts von den nutzlosen Aufopferungen, und Deine Einladung ist eine solche. Keine Einwendung, Georg! Ich bleibe unbedingt im Gasthofe. Du compromittirst Dich schon genug in den Augen aller loyalen Gemüther, wenn Du mich nicht als Freund verleugnest.“
Die Weigerung wurde in so bestimmtem Tone ausgesprochen, daß Georg einsah, wie nutzlos jeder fernere Versuch sein würde, er fügte sich also.
„Nun, so laß mich Dir wenigstens zu der Erbschaft gratuliren,“ nahm er wieder das Wort. „Sie ist, wenn auch nicht bedeutend, doch immer von Wichtigkeit für Euch.“
„Gewiß, und das hauptsächlich um meines Vaters willen. Er kann sich nun ungestört seiner geliebten Wissenschaft hingeben, ohne daß die Existenzfrage ewig für ihn im Vordergrunde steht. Auch ich gewinne dadurch eine langgewünschte Selbstständigkeit. Ich hätte längst schon meine Stellung am Hospital aufgegeben, wäre es nicht nothwendig gewesen, unserem Haushalt ein festes Einkommen zu sichern, das er nun entbehren kann. Ich werde mir jetzt eine Praxis gründen und mich verheirathen.“
„Du willst heiraten?“ fragte Georg erstaunt.
„Natürlich will ich das. Eine Frau muß der Mensch doch haben – das gehört zur Bequemlichkeit.“
„Aber wen willst Du denn heiraten?“
„Das weiß ich noch nicht. Sobald ich einen eigenen Herd habe, halte ich Umschau und führe die Braut heim.“
„Doch wohl eine von den Töchtern des Schweizerlandes?“
„Gewiß! Ich schätze die tüchtige praktische Natur dieses Volkes sehr hoch, wenn auch bisweilen einige Derbheiten mit unterlaufen. Zartheit kann ich bei meiner Frau ohnehin nicht brauchen; Eheleute müssen zu einander passen.“
„Da gehst ja sehr gründlich zu Werke,“ spottete Georg. „Du hast Dir wohl ein förmliches Programm zurecht gemacht, mit all den Eigenschaften, die Deine zukünftige Frau besitzen muß? Also, Paragraph eins –?“
„Vermögen!“ sagte Max lakonisch. „Ja, da empören sich nun wieder Deine idealistischen Gefühle. Vermögen ist unerläßlich. Zweitens: praktische Hausfrauenerziehung – das ist ebenso wichtig, wenn man ein bequemes Leben führen will. Drittens: blühende Gesundheit; ein Arzt, der sich mit allen möglichen Krankheiten herumschlägt, will nicht auch in seinem Hause den Doctor spielen. Viertens: –“
„Um Gottes willen, höre auf!“ unterbrach ihn der Freund. „Ich glaube, Du hast ein Dutzend Paragraphen für Dein Eheglück nöthig. Die Liebe steht wohl in keinem derselben?“
„Die Liebe kommt nach der Hochzeit,“ versetzte der junge Arzt zuversichtlich. „Bei vernünftigen Leuten wenigstens, und die besten Ehen sind die, welche mit genauer Berechnung der Charaktere und Verhältnisse geschlossen werden. Sobald das Programm stimmt, mache ich meinen Antrag und heirathe. Punctum!“