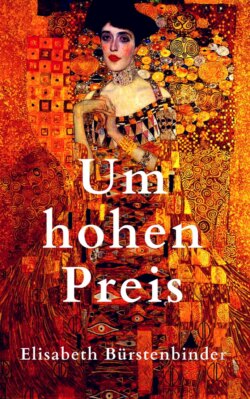Читать книгу Um hohen Preis - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление[175] Als der Freiherr auf den wichtigen und verantwortungsreichen Posten in R. berufen wurde, fand er dort sehr schwierige Verhältnisse vor. Der Sturm, der vor einigen Jahren das ganze Land erschütterte, hatte zwar ausgetobt, aber verschiedene Anzeichen verriethen, daß er nur zurückgedrängt, nicht bewältigt worden war. In der -schen Provinz besonders gährte es noch überall, und die Provinzialhauptstadt, das große und volkreiche R., stand an der Spitze der Opposition, die sich gegen die Regierung richtete. Verschiedene hohe Beamte, die rasch auf einander gefolgt waren, hatten es vergebens versucht, diesen Zuständen ein Ende zu machen; es fehlte ihnen entweder die nöthige Entschiedenheit oder die nöthige Vollmacht, und sie beschränkten sich auf Vermittelungen, welche die augenblicklichen Differenzen zwar beilegten, den Zwiespalt selbst aber in seiner vollen Schärfe bestehen ließen. Da wurde Raven zum Chef der Verwaltung ernannt, und Stadt und Provinz mußten es bald genug empfinden in wessen Hand die Zügel jetzt lagen. Der neue Gouverneur ging mit einer Energie, aber auch mit einer Rücksichtslosigkeit vor, die einen wahren Sturm gegen ihn entfesselte. Widerspruch, Proteste, Klagen bei der Regierung jagten einander förmlich, aber die letztere wußte zu gut, was sie an ihrem Vertreter hatte, um ihn nicht mit voller Macht zu stützen. Ein Anderer hätte wahrscheinlich die grenzenlose Unpopularität gescheut, die ihm aus diesem Vorgehen erwuchs, oder wäre den endlosen Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten gewichen, die man ihm in Folge dessen bereitete – Raven blieb auf seinem Posten. Er war ein Mann, der in jeder Lebenslage den Kampf eher aufsuchte, als daß er ihn mied, und seine im Grunde despotisch angelegte Natur fand gerade hier volle Gelegenheit zu ihrer Entfaltung. Er kümmerte sich nicht viel darum, ob seine Maßregeln in den gesetzlichen Schranken blieben, und setzte all den gegen ihn geschleuderten Vorwürfen von Willkür und Gewalt sein unerschütterliches „Es bleibt dabei!“ entgegen. Damit erzwang er denn auch in der That die Unterwerfung der widerstrebenden Elemente. Stadt und Provinz sahen endlich ein, daß sie den Kampf mit einem Manne nicht durchführen konnten der nicht ihre Rechte, sondern seine Macht zur Richtschnur seines Handelns nahm; zum offenen Widerstand war die Zeit nicht angethan. Die eben mit voller Macht hereinbrechende Reactionsperiode unterdrückte ihn im Keime, man fügte sich also, zwar grollend und widerwillig, aber man fügte sich doch, und der Gouverneur, dem seine Aufgabe so vorzüglich gelungen war, wurde mit Auszeichnungen überhäuft.
Seitdem waren Jahre vergangen; man hatte sich schließlich an das despotische Regiment des Freiherrn gewöhnt, und Dieser hatte sich die Achtung erzwungen, die einem energischen, consequenten Charakter nie versagt wird, selbst wo man ihn als Feind betrachtet. Ueberdies verdankte man ihm eine ganze Reihe von Verbesserungen und Reformen, denen selbst seine Gegner den Beifall nicht vorenthalten konnten. Der in politischer Hinsicht so viel gehaßte und angefeindete Mann wurde auf anderem Gebiete der Wohltäter der ihm anvertrauten Provinz, ihr unermüdlicher Vertreter, wo es galt, gemeinnützige Einrichtungen in’s Leben zu rufen oder durchzuführen. Seine mächtige Thatkraft, so verderblich auf der einen Seite, wirkte auf der andern entschieden segensreich. Er trat überall ein, wo es galt, die Industrie, den Landbau, den Wohlstand überhaupt zu heben, und knüpfte dadurch eine Menge von Interessen an seine Person, die in ihm ihren eifrigsten Förderer sahen und ihn mit der Zeit einen Anhang schufen, der fast so groß war, wie die Zahl seiner Gegner. Seine Verwaltung war ein Muster von Ordnung, Unbestechlichkeit und strenger Disciplin, und seine neue Schöpfungen, mit praktischem Scharfblick entworfen und mit fester Hand durchgeführt, blühten überall mächtig empor.
Der Gouverneur lebte auf großem Fuße, da ihm außer seinem Einkommen noch ein bedeutendes Vermögen zur Seite stand. Sein verstorbener Schwiegervater war sehr reich gewesen und nach dessen Tode fiel das Vermögen an seine beiden Töchter, Frau von Raven und die Baronin Harder. Die Ehe des Freiherrn war eines jener Convenienzverhältnisse, wie man sie oft in der großen Welt findet. Raven hatte sich bei seiner Wahl einzig und allein von der Berechnung leiten lassen, aber er vergaß es nicht, daß diese Verbindung ihm seine Laufbahn geöffnet, und seine Gemahlin hatte sich nie über einen Mangel an Artigkeit und Rücksicht von seiner Seite zu beklagen; die Neigung, welche so vollständig fehlte, vermißte sie nicht. Frau von Raven war eine geistig sehr untergeordnete Natur, die wohl überhaupt keine Neigung einflößen konnte; sie hatte dem Günstling ihres Vaters, von dem sie täglich hörte, daß ihm eine bedeutende Zukunft bevorstehe, ihre Hand nicht versagt, und da sich diese Vorhersagung erfüllte, so blieb ihr nichts zu wünschen übrig. Der Gemahl erfüllte freigebig all ihre Ansprüche an einen glänzenden Haushalt, prachtvolle Toilette und hohe Lebensstellung, also kam es auch niemals zu einer Differenz zwischen ihnen, und im Uebrigen lebten sie auf vornehmen Fuße, so getrennt und fremd wie nur
[176] möglich. Die in den Augen der Welt musterhafte, aber kinderlose Ehe hatte vor sieben Jahren mit dem Tode der Frau von Raven ihr Ende gefunden, und der Freiherr, dem laut Testament das ganze Vermögen zufiel, schritt zu keiner zweiten Vermählung. Der stolze, immer nur mit seinen ehrgeizigen Plänen beschäftigte Mann hatte niemals Empfänglichkeit für die Liebe und die Freuden der Häuslichkeit gehabt und hätte wahrscheinlich nie geheirathet, wäre die Heirath ihm nicht eine Staffel zum Emporsteigen gewesen. Da dieser Grund nun fortfiel, dachte er nicht daran, sich von Neuem zu fesseln, und jetzt, wo er am Ende der Vierzig stand, war ja überhaupt keine Rede mehr davon.
Es war am Morgen nach der Ankunft der Baronin Harder und ihrer Tochter, als die Erstere sich mit ihrem Schwager in dem kleinen Salon ihrer Wohnung befand. Die Baronin zeigte noch Spuren einstiger Schönheit, war aber bereits vollständig verblüht. Die Menge der aufgewendeten Toilettenkünste mochte vielleicht noch Abends beim Kerzenschein ihre trügerische Wirkung thun, das helle Tageslicht aber enthüllte die Wahrheit unbarmherzig dem Auge des Freiherrn, der ihr gegenüber saß.
„Ich kann Ihnen die Auseinandersetzung nicht ersparen, Mathilde,“ sagte er, „wenn ich auch begreife, wie peinlich sie Ihnen ist, aber einmal wenigstens muß die Sache zwischen uns erörtert werden. Auf Ihren Wunsch habe ich es unternommen, den Nachlaß des Barons zu ordnen, so weit sich das von hier aus thun ließ. Es war ein Chaos, das ich kaum mit Hülfe Ihres Rechtsanwaltes bewältigen konnte; jetzt endlich ist es geschehen. Ich habe Ihnen das Resultat bereits nach der Schweiz gemeldet.“
Die Baronin drückte ihr Taschentuch an die Augen. „Ein trostloses Resultat!“
„Aber kein unerwartetes! Es ist leider nicht möglich gewesen, Ihnen auch nur einen geringen Theil des Vermögens zu retten. Ich gab Ihnen den Rath, auf einige Zeit in’s Ausland zu gehen, denn es wäre für Sie doch zu demüthigend gewesen, den Verkauf Ihres Hotels und die Auflösung Ihres ganzen Haushaltes in der Residenz mit ansehen zu müssen. Ihre Entfernung ließ diesen Act der Nothwendigkeit mehr als freien Entschluß erscheinen, und ich habe dafür gesorgt, daß man in der Gesellschaft so wenig wie möglich von der Lage der Dinge erfuhr. Jedenfalls ist die Ehre des Namens gewahrt, den Sie und Gabriele tragen, und Sie brauchen nicht zu fürchten, daß er von einem der Gläubiger an den Pranger gestellt wird.“
„Ich weiß, welche große persönliche Opfer Sie gebracht haben,“ sagte Frau von Harder. „Mein Rechtsanwalt hat mir ausführlich geschrieben – Arno, ich danke Ihnen.“
Es war wohl eine Aufwallung wirklichen Gefühls, mit dem sie ihm die Hand hinstreckte, aber die abwehrende Bewegung des Freiherrn war so eisig, daß jede wärmere Empfindung davor erstarb.
„Ich that nur, was das Andenken meines Schwiegervaters mir zur Pflicht machte,“ entgegnete er. „Seine Tochter und seine Enkelin haben unter allen Umständen Anspruch auf meinen Schutz, und ihr Name mußte um jeden Preis rein gehalten werden. Diesen Rücksichten habe ich die Opfer gebracht, nicht Gefühlsregungen, zu denen ich keine Ursache hatte, denn Sie wissen, der verstorbene Baron und ich waren alles Andere, nur nicht Freunde.“
„Ich habe diese Entfremdung stets tief beklagt,“ versicherte die Baronin. „Mein Gatte suchte in den letzten Jahren vergebens eine Annäherung. Sie waren es, der sich völlig unzugänglich zeigte. Konnte er Ihnen einen höheren Beweis seiner Achtung, seines Vertrauens geben, als den, sein Theuerstes Ihren Händen anzuvertrauen? Er ernannte Sie auf seinem Sterbebette zum Vormunde Gabrielens.“
„Das heißt, nachdem er sich ruinirt hatte, überließ er die Sorge für Weib und Kind mir, den er im Leben bei jeder Gelegenheit angefeindet. Ich weiß, wie hoch ich diesen Beweis des Vertrauens zu schätzen habe.“
Die Baronin nahm wieder ihre Zuflucht zu dem Taschentuche. „Arno, Sie wissen nicht, wie grausam Ihre Worte sind. Haben Sie denn keine Schonung für die Gefühle einer schwergebeugten Wittwe?“
Statt aller Antwort glitt der Blick des Freiherrn langsam über das elegante graue Seidenkleid der Dame hin. Sie hatte pünktlich mit Ablauf des Wittwenjahres die Trauer abgelegt, da sie wußte, daß Schwarz sie sehr unvorteilhaft kleidete. Der unverkennbare Spott, der in dem Blicke ihres Schwagers lag, rief aber doch eine leichte Röthe des Aergers oder der Verlegenheit auf ihrem Antlitz hervor, als sie fortfuhr:
„Ich fange jetzt erst an nach der furchtbaren Katastrophe wieder aufzuathmen. Wenn Sie ahnten, welche Sorgen und Demüthigungen ihr vorangingen, welche Verluste von allen Seiten auf uns einstürmten – es war entsetzlich.“
Um die Lippen des Freiherrn zuckte es wie bitterer Sarkasmus. Er wußte sehr gut, daß die Verluste des Barons am Spieltisch entstanden waren und daß die Sorgen seiner Gemahlin darin bestanden, mit ihrer Toilette und ihren Equipagen alle übrigen Damen der Residenz zu verdunkeln. Die Baronin hatte bei dem Tode des Ministers das gleiche Vermögen empfangen, wie ihre Schwester; es war bis auf den letzten Rest verschwendet worden, während das der Frau von Raven sich noch unangetastet in den Händen ihres Gatten befand.
„Genug!“ sagte er abbrechend. „Lassen wir diesen unerquicklichen Gegenstand fallen! Ich habe Ihnen mein Haus angeboten und freue mich, daß Sie den Vorschlag annahmen. Seit dem Tode meiner Frau habe ich mich mit Freunden behelfen müssen, die wohl dem Haushalte vorstehen, aber doch nicht den Ansprüchen genügen konnten, die man an die Dame des Hauses stellt. Sie verstehen und lieben die Repräsentation, Mathilde, und ich habe gerade in dieser Beziehung viel vermißt. Unsere beiderseitigen Interessen begegnen sich also, und ich denke, wir werden mit einander zufrieden sein.“
Seine Worte klangen sehr kalt und gemessen. Freiherr von Raven schien durchaus nicht geneigt, in der Rolle eines Retters und Wohlthäters seiner Verwandten, der er in der That war, zu glänzen, er behandelte die Sache durchaus geschäftsmäßig.
„Ich werde mich bemühen, Ihren Wünschen nachzukommen,“ versicherte Frau von Harder, indem sie dem Beispiele ihres Schwagers folgte, der sich erhob und an das Fenster trat. Er richtete noch einige gleichgültige Fragen an sie, ob die Einrichtung, die Bedienung nach ihren Wünschen sei, ob sie irgend etwas vermisse, aber er hörte kaum auf den Schwall von Worten, mit denen die Dame beteuerte, daß sie alles entzückend finde … seine Aufmerksamkeit war auf etwas ganz Anderes gerichtet.
Unmittelbar unter dem Fenster befand sich ein Gärtchen, das zur Wohnung des Castellans gehörte, dort promenirte Fräulein Gabriele, oder vielmehr, sie jagte sich mit den beiden Kindern des Castellans umher, denn diese Wendung hatte die Promenade schließlich genommen. Als die junge Dame dann den Morgenspaziergang unternahm, um sich mit den neuen Umgebungen vertraut zu machen, wie sie ihrer Mutter sagte, interessirte sie sich zunächst nur für einen gewissen Theil dieser Umgebungen. Sie wußte, daß Georg Winterfeld täglich das Regierungsgebäude betrat; es galt also die Möglichkeit einer öfteren Begegnung ausfindig zu machen, von der Georg behauptete, daß sie äußerst schwierig sei. Gabriele theilte diese Ansicht durchaus nicht, und ihre Recognoscirung war daher vorläufig nur auf die Entdeckung gerichtet, wo die Kanzlei des Freiherrn, in welcher der junge Beamte arbeitete, denn eigentlich liege. Dabei kamen ihr aber der kleine siebenjährige Knabe des Castellans und dessen Schwesterchen in den Weg, mit denen sie sofort Bekanntschaft machte. Die lebhaften, munteren Kinder erwiderten die Freundlichkeit der jungen Dame mit großer Zutraulichkeit, und bei der letzteren drängte die neue Bekanntschaft bald jeden Gedanken an ihren Entdeckungszug, und leider auch an den, dem er galt, in den Hintergrund. Sie ließ sich von den Kleinen in das Gärtchen ziehen, das hinter der Castellanswohnung, getrennt vom eigentlichen Schloßgarten, lag, sie bewunderte mit den Kindern die Gesträuche und Blumenbeete und wurde immer vertrauter mit ihnen; nach kaum einer Viertelstunde war bereits ein mit dem nöthigen Lärm versehenes Spiel im Gange, bei dem Fräulein Gabriele genau ebenso viel leistete, wie ihre kleinen Spielgefährten. Sie sprang ihnen nach über die Beete und neckte sie auf alle nur mögliche Weise. So unpassend das nun auch für ein siebenzehnjähriges Fräulein und für die Nichte des Gouverneurs sein mochte, so reizend war der Anblick für einen unbefangenen Beobachter. Jede Bewegung des jungen [177] Mädchens war von einer unbewußten, natürlichen Grazie; die schlanke Gestalt in dem weißen Morgenkleide gaukelte wie ein Lichtstrahl zwischen den dunklen Bäumen auf und nieder. Die eine der schweren, blonden Flechten hatte sich bei dem übermüthigen Spiel gelöst und sank in ihrer ganzen reichen Fülle über die Schulter, während das frohe Lachen und der Jubel der Kinder bis hinauf zu den Fenstern des Schlosses drang.
Die dort stehende Baronin entsetzte sich freilich über diese Formlosigkeit, und das um so mehr, als sie sah, daß der Freiherr die Scene dort unten unverwandt beobachtete. Was mußte der stolze, etiquettenstrenge Raven von der Erziehung einer jungen Dame denken, die sich vor seinen Augen solche Freiheiten herausnahm! Die Baronin fürchtete jeden Augenblick eine der gewohnten scharfen Aeußerungen ihres Schwagers vernehmen zu müssen und bemühte sich, den üblen Eindruck so viel wie möglich zu verwischen.
„Gabriele ist bisweilen noch unglaublich kindisch,“ klagte sie. „Es ist ganz unmöglich, ihr begreiflich zu machen, daß sich dergleichen Kindereien für eine junge Dame ihres Alters nicht schicken. Ich fürchte beinahe ihren Eintritt in die Gesellschaft, der durch den Tod des Vaters noch um ein Jahr hinausgeschoben wurde. Sie ist im Stande, dergleichen Zwanglosigkeiten auch auf das Salonleben zu übertragen.“
„Lassen Sie doch dem Kinde seine Unbefangenheit!“ sagte der Freiherr, ohne den Blick von der Gruppe abzuwenden. „Sie wird noch früh genug lernen, Weltdame zu sein; jetzt wäre es wirklich schade darum – das Mädchen ist ja der verkörperte Sonnenstrahl.“
Die Baronin horchte auf. Es war das erste Mal, daß sie einen wärmeren Ton von den Lippen ihres Schwagers hörte und in seinem Auge etwas Anderes sah, als eisige Zurückhaltung. Er fand offenbar Wohlgefallen an dem Uebermuthe Gabrielens, und die lange Frau beschloß, das sofort zu benutzen, um über einen Punkt in’s Klare zu kommen, der ihr sehr am Herzen lag.
„Mein armes Kind!“ seufzte sie mit gut gespielter Rührung. „Es eilt noch so sorglos durch das Leben und ahnt nicht, welche ernste, vielleicht traurige Zukunft ihm aufbehalten ist. Ein armes Fräulein! Das ist ein bitteres Loos, doppelt bitter, wenn man, wie Gabriele, mit Hoffnungen und Ansprüchen an das Leben erzogen ist. Sie wird es bald genug empfinden lernen.“
Das Manöver glückte wider alles Erwarten. Der sonst so unzugängliche Raven schien augenblicklich in ungewöhnlich nachgiebiger Stimmung zu sein, denn er wandte sich um und sagte rasch und bestimmt:
„Was sprechen Sie denn von einer traurigen Zukunft, Mathilde? Sie wissen ja, daß ich kinderlos und ohne eigene Verwandte bin. Gabriele ist meine Erbin, und da kann von Armuth füglich nicht die Rede sein.“
Ein Blitz des Triumphes leuchtete in den Augen der Baronin, als sie endlich die so lang ersehnte Gewißheit erhielt.
„Sie haben sich bisher noch nie über diesen Punkt ausgesprochen,“ bemerkte sie, mühsam ihre Freude verbergend, „und ich wagte ihn begreiflicher Weise nicht zu berühren. Die ganze Sache lag mir überhaupt so fern – “
„Sollten Sie wirklich noch niemals den Fall meines Todes und mein Testament in den Kreis Ihrer Erwägungen gezogen haben?“ unterbrach sie der Freiherr – er ließ seinen vorhin unterdrückten Sarkasmus jetzt vollständig den Zügel schießen.
„Aber, bester Schwager, wie können Sie so etwas nur glauben!“ rief die Dame mit beleidigter Miene.
Er beachtete den Empörungsschrei nicht im Geringsten, sondern fuhr ruhig fort:
„Hoffentlich haben Sie nicht mit Gabriele darüber gesprochen“ – er wußte nicht, daß dies beinahe täglich geschah – „ich wünsche nicht, daß ihr jetzt schon gelehrt wird, sich als reiche Erbin zu betrachten, und noch weniger wünsche ich, daß das siebenzehnjährige Mädchen mein Testament und mein Vermögen zum Gegenstand von Berechnungen macht, die ich von – anderer Seite sehr natürlich finde.“
Die Baronin stieß einen Seufzer aus. „Immer und ewig finde ich bei Ihnen Mißdeutungen. Sie verdächtigen sogar die Regungen der Mutterliebe, die ohne eigenen Wunsch nur für die Zukunft ihres einzigen Kindes bangt.“
„Durchaus nicht,“ sagte Raven ungeduldig und offenbar gelangweilt von dem Gespräche. „Sie hören ja, daß ich diese Regungen für sehr natürlich halte, und deshalb wiederhole ich Ihnen meine Zusicherung. Da das gesammte Vermögen von meinem Schwiegervater stammt, so soll es auch dereinst an seine Enkelin fallen. Wenn sich Gabriele, wie es wahrscheinlich ist, noch bei meinen Lebzeiten vermählt, so werde ich für die Mitgift Sorge tragen; nach meinem Tode – sie ist, wie gesagt, meine alleinige Erbin.“
Der Nachdruck, mit dem er das Wort hervorhob, zeigte der Baronin, daß sie für ihre Person nichts zu hoffen habe; indessen war mit der Zukunft der Tochter ja auch die ihrige gesichert und damit ihr Hauptzweck erreicht. Die kaum durch äußere Höflichkeitsformen verschleierte Verachtung, mit welcher der Freiherr sie behandelte und die der feine Instinct Gabrielens sogleich beim ersten Empfange herausgefunden, wurde von der Mutter entweder nicht gefühlt oder nicht beachtet. Sie war sich bewußt, ihrem Schwager ebensowenig Sympathie entgegen zu bringen, wie er ihr, und sie beugte sich nur der Nothwendigkeit, wenn sie seine Schroffheit mit der äußersten Liebenswürdigkeit vergalt, aber die Aussicht, an der Spitze eines so glänzenden Haushaltes zu stehen, wie der Gouverneur ihn führte, als seine Verwandte hier in R. die erste Rolle zu spielen und in allen Cirkeln den Vortritt zu haben, söhnte sie einigermaßen mit dieser Nothwendigkeit aus.
Als Raven einige Minuten später durch das Vorzimmer schritt, dessen Fenster nach derselben Seite hin lagen, hielt er noch einen Augenblick inne und warf einen flüchtigen Blick hinab.
„Daß das Kind auch solchen Eltern und solcher Erziehung anheimfallen mußte! sagte er halblaut. Wie lange wird es dauern, so ist Gabriele eine Kokette, wie ihre Mutter, die nichts weiter kennt, als Toilette, Intriguen und Salonklatschereien – schade um das Kind!“
Die Regierungskanzlei, nach welcher der Gouverneur sich jetzt begab, lag, wie schon erwähnt, im unteren Stockwerke des Schlosses. Er pflegte die meisten Sachen zwar in seinem eigenen Arbeitszimmer zu erledigen, betrat aber sehr oft die Kanzlei und die übrigen Verwaltungsbureaux. Die dort arbeitenden Beamten waren nie sicher vor dem stets plötzlichen und unerwartete Erscheinen ihres Chefs, dessen scharfen Augen nie die geringste Unregelmäßigkeit entging. Wer sich auf einer solchen betreffen ließ, mußte, gleichviel, ob seine Stellung hervorragend oder untergeordnet war, die schärfste Zurechtweisung von Seiten des Chefs hinnehmen, der Alles so viel wie möglich persönlich leitete und die eiserne Disciplin, welche seine Verwaltung auszeichnete, auch auf seine Bureaux übertrug.
Die Bureaustunden hatten längst begonnen, und die Beamten waren sämmtlich auf ihren Plätzen, als der Freiherr eintrat und mit leichtem Grüßen durch die Räume schritt. Einzelne der Abtheilungen überflog er nur mit einem kurzen, prüfenden Blicke; bei anderen blieb er stehen, warf hier eine Frage, dort eine Bemerkung hin und ließ sich hin und wieder ein Schriftstück reichen. Sein Verkehr mit den Untergebenen war gemessen, aber höflich, und doch sah man es den Gesichtern der Herren an, wie sehr sie das Stirnrunzeln des Chefs fürchteten. Als dieser das letzte Zimmer betrat, erhob sich ein älterer Herr, der dort allein arbeitete, ehrfurchtsvoll von seinem Pulte.
Es war eine lange, hagere Gestalt mit steifer Haltung und einem faltenreichen, sehr würdevollen Gesichte. Das graue Haar war mit größter Sorgfalt geordnet, und dieselbe peinliche Sorgfalt verrieth sich auch in dem feinem schwarzen Anzuge, der nicht das geringste Fältchen oder Stäubchen zeigte, während eine hohe weiße Halsbinde von ganz ungewöhnlichen Dimensionen ihrem Träger etwas ungemein Feierliches gab.
„Guten Morgen, lieber Hofrath!“ sagte der Freiherr mit mehr Freundlichkeit, als sonst in seiner Art lag, während er zugleich mit einer Handbewegung den Genannten aufforderte, ihn in das seitwärts liegende Cabinet zu folgen, wo er gewöhnlich die einzelnen Beamten empfing. „Ich bin froh, daß Sie wieder zurück sind; ich habe Sie in den wenigen Tagen Ihrer Abwesenheit recht vermißt.“
Hofrath Moser, der Chef der Bureauverwaltung, nahm mit sichtlicher Genugthuung dieses Zeugniß seiner Unentbehrlichkeit hin.
[178] „Ich habe die Rückkehr so viel wie möglich beeilt,“ entgegnete er. „Excellenz wissen ja, daß ich den Urlaub nur erbat, um meine Tochter aus dem Kloster abzuholen. Ich hatte bereits die Ehre, sie vorzustellen, als wir Excellenz gestern in der Gallerie begegneten.“
„Mir scheint, Sie haben das junge Mädchen zu lange in der geistlichen Obhut gelassen,“ warf Raven hin, „sie macht ja jetzt schon den Eindruck einer Nonne. Ich fürchte, die Klostererziehung hat sie vollständig verdorben.“
Der Hofrath zog die Augenbrauen in die Höhe und blickte mit dem Ausdrucke starren Entsetzens seinen Chef an. „Wie meinen Excellenz?“
„Ich meine, für die Welt verdorben,“ verbesserte der Freiherr, auf dessen Lippen ein kaum bemerkbares Spottlächeln erschien, als er dieses Entsetzen gewahrte.
„Ah so! Ja freilich, da haben Excellenz Recht –“ der Hofrath ließ nie eine Gelegenheit vorbei, den Titel seines Chefs zu nennen, und wenn er ihn dreimal in einem Satze hätte wiederholen sollen. „Aber der Sinn meiner Agnes war von jeher dem Weltlichen abgewendet, und in Kurzem wird sie sich vollständig davon lossagen. Sie hat sich entschlossen, den Schleier zu nehmen.“
Der Freiherr hatte einige Papiere zur Hand genommen und durchflog dieselben, während er zugleich ruhig das Gespräch mit dem Beamten fortsetzte, der sich allein von allen übrigen einer größern Vertraulichkeit bei ihm zu erfreuen schien.
„Nun, das ist gerade nicht überraschend, bemerkte er. Wenn man ein junges Mädchen vom vierzehnten bis zum siebenzehnten Jahre im Kloster läßt, muß man auf solche Entschlüsse gefaßt sein. Sind Sie denn damit einverstanden?“
„Es wird mir schwer, mein einziges Kind für immer zu entbehren,“ sagte der Hofrath feierlich, „aber fern sei es von mir, einer so heiligen Bestimmung hindernd in den Weg zu treten. Ich habe eingewilligt, meine Tochter wird noch auf einige Monate in mein Haus und in die Welt zurückkehren, um dann ihr Noviziat in dem Kloster anzutreten, wo sie bisher Pensionärin gewesen ist. Die hochwürdigste Frau Aebtissin wünscht, daß auch der geringste Schein des Zwanges vermieden wird.“
„Die Frau Aebtissin wird ihres Zöglings wohl sicher sein,“ meinte der Freiherr, mit einer Ironie, die seinem Zuhörer zum Glück entging. „Wenn es übrigens der eigene Wunsch und Wille des jungen Mädchens ist, so läßt sich nichts dagegen einwenden. Ich bedauere nur Sie, der Sie in der Tochter eine Stütze Ihres Alters zu finden hofften und sie nun den Nonnen abtreten müssen.“
„Dem Himmel!“ berichtigte der alte Herr mit einem frommen Aufblick, „und davor müssen die Rechte des Vaters natürlich zurücktreten.“
„Natürlich! – Und jetzt zu den Geschäften! Liegt irgend etwas von Bedeutung vor?“
„Die Meldung des Polizeidirectors –“
„Ich weiß. Man erhebt in der Stadt unglaublichen Lärm über die neuen Maßregeln. Man wird sich fügen. Was giebt es noch?“
„Den bereits besprochenen ausführlichen Bericht an das Ministerium. Wen bestimmen Excellenz dazu?“
Raven dachte einen Augenblick nach. „Den Assessor Winterfeld.“
„Assessor Winterfeld?“ wiederholte der Hofrath in sehr gedehntem Tone.
„Ja, ich wünsche ihm Gelegenheit zu geben, sich auszuzeichnen oder doch wenigstens bemerkbar zu machen. Er ist trotz seiner Jugend einer der fähigsten und tüchtigsten Beamten.“
„Aber nicht loyal, Excellenz, durchaus nicht loyal genug! Er hat eine ausgesprochen liberale Richtung und neigt sich der Opposition zu, die jetzt –“
„Das thun die jüngeren Beamten alle,“ fiel der Freiherr ein. „Die Herren sind sämmtlich Weltverbesserer und halten es für charaktervoll, hin und wieder zu opponiren, aber das giebt sich mit der Beförderung. Schon mit dem Rath pflegt es gewöhnlich aufzuhören, und Assessor Winterfeld wird darin keine Ausnahme sein.“