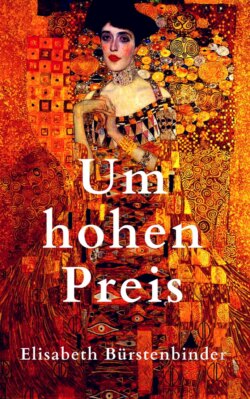Читать книгу Um hohen Preis - Elisabeth Bürstenbinder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление[191] Der Hofrath schüttelte bedenklich den Kopf. „Was seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit betrifft, so theile ich vollkommen die schmeichelhafte Meinung Euer Excellenz über ihn, aber es sind mir Dinge über den Assessor zu Ohren gekommen – Dinge, die von der höchsten Illoyalität zeugen. Es steht leider fest, daß er bei Gelegenheit seines jüngsten Urlaubs in der Schweiz die verdächtigsten Beziehungen angeknüpft und den intimsten Umgang mit allerlei Demagogen und Revolutionären gehabt hat.“
„Daran glaube ich nicht,“ sagte der Freiherr mit Entschiedenheit. „Winterfeld ist nicht der Mann, der seine Zukunft so nutzlos und zwecklos auf’s Spiel setzt: er ist überhaupt keine extravagante Natur, für die solche Versuchungen gefährlich werden könnten. Die Sache hängt vermuthlich anders zusammen; ich werde sie untersuchen. Hinsichtlich des Berichtes bleibt es bei meiner Bestimmung. Bitte, rufen Sie den Assessor zu mir!“
Der Hofrath ging, und wenige Minuten später trat Georg Winterfeld ein. Der junge Beamte wußte, daß ihm mit dem Auftrage, den er jetzt empfing, eine Auszeichnung vor seinen Collegen zu Theil wurde, aber diese offenbare Bevorzugung schien ihn eher zu drücken, als zu erfreuen. Er nahm mit ruhiger Aufmerksamkeit die Weisungen seines Chefs hin. Die kurzen, fachlichen Andeutungen desselben fanden bei ihm das vollste Verständniß, einzelne Winke, die er zu geben für nöthig fand, die schnellste Auffassung, und die wenigen, aber treffenden Bemerkungen des jungen Mannes zeigten, wie vollständig er mit der ihm
[192] übertragenen Sache vertraut war. Raven hatte zu oft mit der Schwerfälligkeit und Unfähigkeit seiner Beamten zu kämpfen, um nicht die Annehmlichkeit zu empfinden, in wenigen Worten verstanden zu werden, wo er sich sonst zu ausführlichen Auseinandersetzungen herbeilassen mußte; er war sichtlich zufrieden. Die Angelegenheit war in verhältnißmäßig kurzer Zeit erledigt, und Georg, der bereits ein Papier mit verschiedenen Notizen seines Chefs in der Hand hielt, wartete auf ein Zeichen der Entlassung.
„Noch Eins!“ sagte der Freiherr, ohne den ruhigen Geschäftston zu ändern, in welchem er bisher gesprochen. „Sie haben den Urlaub, den Sie vor einigen Wochen nahmen, in der Schweiz zugebracht?“
„Ja, Excellenz.“
„Man behauptet, Sie hätten dort gewisse Verbindungen aufgesucht oder doch wenigstens angeknüpft, die mit Ihrer Stellung als Beamter unvereinbar sind. Was ist an der Sache?“
Der Blick des Freiherrn ruhte mit seiner ganzen, von den Untergebenen so sehr gefürchteten Schärfe auf dem jungen Beamten, aber dieser zeigte weder Bestürzung noch Verlegenheit.
„Ich habe einen Universitätsfreund in Z. aufgesucht,“ erwiderte er ruhig, „und bin auf dessen wiederholte, herzliche Einladung im Hause seines Vaters geblieben, der allerdings politischer Flüchtling ist.“
Raven runzelte die Stirn. „Das war eine Unvorsichtigkeit, die ich bei Ihnen am wenigsten vorausgesetzt hätte. Sie mußten sich sagen, daß ein solcher Besuch nothwendig bemerkt und verdächtigt werden mußte.“
„Es war ein Freundschaftsbesuch, nichts weiter. Ich kann mein Wort darauf geben, daß er auch nicht die entfernteste politische Beziehung hatte; es handelte sich um reine Privatverhältnisse.“
„Gleichviel, Sie haben Rücksicht auf Ihre Stellung zu nehmen. Die Freundschaft mit dem Sohne eines politisch Compromittirten könnte allenfalls noch als unverfänglich gelten, wenn sie Ihnen auch schwerlich als Empfehlung für Ihre Carrière dienen dürfte, den Verkehr mit dem Vater aber und den Aufenthalt in seinem Hause mußten Sie unter allen Umständen vermeiden. – Wie ist der Name jenes Mannes?“
„Doctor Rudolf Brunnow.“ Der Name kam fest und klar von den Lippen Georg’s, und jetzt war er es, der das Antlitz seines Chefs unverwandt beobachtete. Er sah, wie etwas darin aufzuckte, unheimlich und gewaltsam, wie eine jähe Blässe die ehernen Züge überflog und die Lippen sich fest auf einander preßten, aber das alles kam und ging mit Blitzesschnelle. Schon in der nächsten Minute siegte die Selbstbeherrschung des Mannes, der gewohnt war, seiner Umgebung stets ein unbewegtes Gesicht zu zeigen und für sie undurchdringlich zu sein.
„Rudolf Brunnow – so?“ wiederholte er langsam.
„Ich weiß nicht, ob Excellenz den Namen kennen?“ wagte Georg zu fragen, aber er bereute sofort seine Uebereilung. Die Augen des Freiherrn begegneten den seinigen, oder vielmehr, wie Gabriele zu sagen pflegte, sie bohrten sich so tief ein, als wollten sie die geheimsten Gedanken aus der Seele lesen. Es lag ein finsteres, drohendes Forschen in diesem Blicke, welcher den jungen Mann warnte, auch nur einen einzigen Schritt weiter zu gehen; er hatte das Gefühl, als stände er an einem Abgrunde.
„Sie sind mit dem Sohne des Doctor Brunnow eng befreundet?“ begann der Freiherr nach einer secundenlangen Pause, ohne die letzte Frage zu beachten, „also auch wohl mit dem Vater?“
„Ich habe ihn erst jetzt kennen gelernt und in ihm einen trotz mancher Schroffheit und Bitterkeit doch durchaus verehrungswürdigen Charakter gefunden, dem meine volle Sympathie gehört.“
„Sie thäten besser, das nicht so offen auszusprechen,“ sagte Raven in eisigem Tone. „Sie sind Beamter eines Staates, der über solche Persönlichkeiten ein für alle Mal den Stab gebrochen hat und sie noch jetzt unnachsichtlich verdammt. Sie können und dürfen nicht in vertraulicher Weise mit denen verkehren, die sich offen zu seinen Feinden bekennen. Ihre Stellung legt Ihnen Pflichten auf, vor denen derartige Freundschafts- und Gefühlsregungen zurücktreten müssen. Merken Sie sich das, Herr Assessor!“
Georg schwieg; er verstand die Drohung, die sich hinter dieser eisigen Ruhe barg; sie galt nicht dem Beamten, sondern dem Mitwisser einer Vergangenheit, die Freiherr von Raven wahrscheinlich längst begraben und vergessen wähnte und die sich jetzt so urplötzlich vor seinen Augen erhob. Jedenfalls vermochte die Erinnerung daran den Freiherrn nicht länger als einen Augenblick zu erschüttern, und als er sich jetzt erhob und entlassend mit der Hand winkte, lag wieder der alte unnahbare Stolz in seiner Haltung.
„Sie sind jetzt gewarnt. Was bisher vorgefallen ist, mag als eine Uebereilung gelten; was Sie in Zukunft thun, geschieht auf Ihre Gefahr.“ –
Georg verbeugte sich schweigend und verließ das Gemach. Er fühlte wieder, wie so oft schon, daß Doctor Brunnow Recht gehabt, als er ihn vor der dämonischen Macht des einstigen Freundes warnte. Der junge Mann mit seinem hohen Ehrgefühl und seinen reinen Grundsätzen hatte sich nach jener inhaltschweren Eröffnung berechtigt geglaubt, den Verräther seiner Freunde und seiner Ueberzeugung aus tiefster Seele zu verachten, aber das wollte ihm nicht mehr gelingen, seit er wieder in den Bannkreis jener mächtigen Persönlichkeit getreten war. Die Verachtung wollte nicht Stand halten vor jenen Augen; die so gebieterisch Gehorsam und Ehrfurcht heischten; sie schien abzugleiten an dem Manne, der das schuldige Haupt so hoch und stolz trug, als erkenne er überhaupt keinen Richter über sich. So wenig sich Georg von der hohen Stellung und dem herrischen Wesen seines Vorgesetzten imponiren ließ, so wenig vermochte er sich dessen geistiger Ueberlegenheit zu entziehen. Und doch wußte er, daß ihm früher oder später ein erbitterter Kampf mit dem Freiherrn bevorstand, der mit der Entscheidung über die Zukunft Gabrielens auch sein Lebensglück in der Hand hielt. Auf die Dauer konnte das Geheimniß ja doch nicht bewahrt bleiben – und was dann? Vor den Augen des jungen Mannes tauchte das Bild der Geliebten auf, die seit gestern mit ihm unter demselben Dache weilte, ohne daß es ihm möglich gewesen war, sie auch nur zu sehen, und daneben das eiserne, unerbittliche Antlitz dessen, den er soeben verlassen – er ahnte erst jetzt, wie schwer der Kampf war, mit dem er sich seine Liebe und sein Glück erobern mußte.
Einige Wochen waren vergangen. Die Baronin Harder und ihre Tochter hatten die nöthigen Besuche zur Anknüpfung des gesellschaftlichen Verkehrs gemacht und empfangen, und Erstere bemerkte mit Befriedigung die große Rücksicht und Aufmerksamkeit, die man ihr um des Gouverneurs willen überall erwies. Noch mehr befriedigte sie die Entdeckung, daß ihr Schwager in der That nichts weiter von ihr verlangte, als die Repräsentation seines Hauses; es wurden ihr keinerlei lästige und unbequeme Pflichten zugemuthet, wie sie im Anfange gefürchtet. Die Sorge und Verantwortlichkeit für das große, streng geregelte Hauswesen lag nach wie vor in den Händen eines alten Haushofmeisters, der schon seit langen Jahren dieses Amt verwaltete und Alles ordnete und leitete, während er nur seinem Herrn selbst Rechenschaft darüber ablegte. Der Freiherr mochte zu tiefe Einblicke in den Residenzhaushalt seiner Schwägerin gethan haben, um ihr in dieser Hinsicht irgend eine Selbstständigkeit zu gestatten. Sie vertrat der Gesellschaft gegenüber die Dame des Hauses, war aber eigentlich nur Gast in demselben. Eine andere Frau hätte die Stellung, in die sie dadurch gedrängt wurde, als eine Demüthigung empfunden, der Baronin aber lag eigentliche Herrschsucht ebenso fern, wie der Begriff von Pflichten; sie war viel zu oberflächlich, um beides zu kennen. Ihre Lage gestaltete sich weit angenehmer, als sie nach der Katastrophe, die dem Tode des Barons folgte, hoffen durfte; sie lebte mit ihrer Tochter in glänzenden Umgebungen; der Freiherr hatte ihr eine ziemlich bedeutende Summe für ihre persönlichen Ausgaben zugesichert; Gabriele war seine anerkannte Erbin – da ließ sich schon der Zwang ertragen, den das Zusammenleben nun einmal unvermeidlich mit sich brachte.
Auch Gabriele hatte sich schnell mit der neuen Umgebung vertraut gemacht. Der vornehme, großartige Zuschnitt des [193] Raven’schen Hauses, die peinliche Pünktlichkeit und die strengen Formen, welche überall vorherrschten, die unbedingte Ehrfurcht der Dienerschaft, für die jeder Wink des Herrn ein Befehl war, das alles imponirte der jungen Dame ebenso sehr, wie es sie befremdete. Es stand im schärfsten Gegensatze zu dem elterlichen Haushalte in der Residenz, wo neben dem größten Glanze auch die größte Unordnung herrschte, wo die Diener sich Unzuverlässigkeiten und Respectwidrigkeiten aller Art erlaubten und das Familienleben in der Jagd nach Zerstreuungen unterging. Dazu kamen später, als die Schuldenlast sich häufte und die Verlegenheiten dringender wurden, die heftigsten und unzartesten Scenen zwischen dem Baron und seiner Gemahlin, wo jeder dem Andern Verschwendung vorwarf, ohne daß dieser jemals gesteuert werde. Die halberwachsene Tochter war nur zu oft Zeuge solcher Scenen gewesen; gleichzeitig verzogen und vernachlässigt von den Eltern, die gern mit dem hübschen Kinde Staat machten, sich aber sonst so gut wie gar nicht um dasselbe kümmerten, fehlte ihr jede ernstere Lebensrichtung. Selbst die Ereignisse des letzten Jahres, der Tod des Vaters und die bald darauf hereinbrechende Vermögenskatastrophe, waren fast spurlos an dem jungen Mädchen vorübergegangen, das in seinem sorglosen Leichtsinn gar keine Empfänglichkeit für den Schmerz hatte. Aber so viel Urtheilskraft besaß Gabriele doch, zu sehen, daß es in dem Hause des „Emporkömmlings“ sehr viel vornehmer und aristokratischer zuging, als in dem ihrer Eltern, und sie ärgerte die Mutter oft genug mit Bemerkungen über diesen Punkt. –
Die Baronin saß auf dem kleinen Sopha ihres Wohnzimmers und blätterte in den Modejournalen. In den nächsten Tagen sollte eine größere Festlichkeit bei dem Gouverneur stattfinden; die höchst wichtige Toilettenfrage harrte also der Entscheidung, und Mutter und Tochter gaben sich mit dem größten Eifer dem für sie so interessanten Studium hin.
„Mama,“ sagte Gabriele, die neben der Mutter saß und gleichfalls einige der Modeblätter in der Hand hielt, „Onkel Arno erklärte gestern diese großen Gesellschaften für eine lästige Pflicht, die seine Stellung ihm auferlege. Er findet nicht das mindeste Vergnügen daran.“
Die Baronin zuckte die Achseln. „Er findet an nichts Vergnügen, als an der Arbeit. Ich habe nie einen Mann gesehen, der sich so wenig Ruhe und Erholung gönnt, wie mein Schwager.“
„Ruhe?“ wiederholte Gabriele. „Als ob er die Ruhe überhaupt kennte oder auch nur ertrüge! In den frühesten Morgenstunden sitzt er schon an seinem Schreibtisch, und Abends sehe ich oft noch um Mitternacht Licht in seinem Arbeitszimmer. Bald ist er in der Kanzlei, bald in den Bureaus; dann wieder fährt er aus, nimmt Besichtigungen vor und inspicirt Gott weiß was für Dinge; dazwischen empfängt er alle möglichen Leute, hört Vorträge an, giebt Befehle – ich glaube, er allein leistet so viel, wie all seine übrigen Beamten zusammengenommen.“
„Ja, er war stets eine rastlose Natur,“ bestätigte die Baronin. „Meine Schwester erklärte oft, es mache sie schon nervös, an diese unausgesetzte, ruhelose Thätigkeit ihres Mannes auch nur zu denken.“
Gabriele stützte den Kopf in die Hand und sah nachdenkend vor sich hin. „Mama,“ begann sie plötzlich wieder, „die Ehe Deiner Schwester muß recht langweilig gewesen sein.“
„Langweilig? Wie kommst Du darauf?“
„Nun, ich meine nur: nach allem, was man hier im Schlosse davon hört. Die Tante bewohnte den rechten Flügel und der Onkel den linken; er kam oft wochenlang nicht in ihre Zimmer und sie niemals in die seinigen; ich glaube, sie speisten nicht einmal zusammen. Jedes hatte seine eigene Equipage und Dienerschaft. Jedes ging und fuhr auf eigene Hand aus, ohne nach dem Andern auch nur zu fragen – es muß ein ganz seltsames Leben gewesen sein.“
„Du bist im Irrthum,“ entgegnete die Mutter, für welche diese Art zu leben offenbar gar nichts Abschreckendes hatte. „Es war eine durchaus glückliche Ehe. Meine Schwester hatte sich nie über ihren Gemahl zu beklagen, der jeden ihrer Wünsche erfüllte. Die Glückliche hat niemals die Bitterkeiten und Scenen kennen gelernt, die ich in den letzten Jahren nur allzu oft ertragen mußte.“
„Ja, Du hast Dich freilich sehr oft mit dem Papa gezankt,“ sagte Gabriele naiv. „Onkel Arno hat das sicher nie gethan, aber er hat sich auch nie um seine Frau gekümmert. Und er kümmert sich doch sonst um alles Mögliche, sogar um meine frühere Erziehung. Es war sehr unartig von ihm, neulich in Deiner Gegenwart zu sagen, er finde meine Bildung sehr lückenhaft und vernachlässigt, und man sähe es auf den ersten Blick, daß ich stets nur den Nonnen und Gouvernanten überlassen worden sei.“
„Ich bin leider an solche Rücksichtslosigkeiten von seiner Seite gewöhnt,“ erklärte die Baronin mit einem Seufzer, der sie aber durchaus nicht hinderte, das Modell einer Robe sehr genau zu betrachten. „Daß ich sie ertrage, ist ein Opfer, das ich einzig und allein Deiner Zukunft bringe, mein Kind.“
Die Tochter schien nicht besonders gerührt von dieser mütterlichen Fürsorge. „Wie ein kleines Schulmädchen bin ich examinirt worden,“ schmollte sie weiter. „Er hat mich mit seinen Kreuz- und Querfragen so in die Enge getrieben, daß ich nicht mehr aus noch ein wußte, und dann zuckte er die Achseln und decretirte mir noch alle möglichen Unterrichtsstunden. Mit siebenzehn Jahren noch Unterricht nehmen! Er will mir Lehrer aus der Stadt kommen lassen, aber ich werde ihm gerade heraus erklären, daß das ganz und gar nicht nothwendig ist.“
Die Mutter sah erschrocken von ihren Modejournalen auf. „Um des Himmels willen, laß das bleiben! Du stehst ja schon in fortwährender Opposition gegen Deinen Vormund, und ich schwebe oft genug in Todesangst, daß Dein Eigensinn und Uebermuth ihn endlich einmal reizen wird. Bis jetzt hat er Dein Benehmen freilich mit einer mir unbegreiflichen Geduld hingenommen, er, der sonst nie einen Widerspruch duldet.“
„Ich sähe es weit lieber, wenn er einmal zornig würde,“ rief Gabriele in gereiztem Tone. „Ich ertrage es nicht, wenn er so von seiner Höhe auf mich herablächelt, als wäre ich ein viel zu unbedeutendes Kind, um ihn reizen oder ärgern zu können, und er lächelt immer, wenn ich das versuche. Und wenn er mir vollends die Gnade erweist, mich auf die Stirn zu küssen, möchte ich am liebsten davonlaufen.“
„Gabriele, ich bitte Dich –“
„Ja, Mama, ich kann mir nicht helfen. So oft ich in Onkel Arno’s Nähe komme, ist es mir, als müsse ich mich wehren, mit allen Kräften wehren, gegen irgend etwas, das von ihm ausgeht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es peinigt und quält mich. Ich kann mit ihm nicht verkehren wie mit anderen Menschen, und – ich will es auch nicht.“
Es klang ein ganz entschiedener Trotz aus den letzten Worten der jungen Dame; sie nahm Hut und Sonnenschirm vom Tische und machte sich zum Gehen fertig.
„Wo willst Du denn hin?“ fragte die Mutter.
„Nur auf eine halbe Stunde in den Garten; es ist zu heiß in den Zimmern.“
Die Baronin protestirte und wollte vor allen Dingen die Toilettenfrage entschieden wissen, aber Gabriele schien heute alles Interesse daran verloren zu haben und war überhaupt viel zu sehr gewohnt, ihren Launen zu folgen, um den Einwand zu beachten. In der nächsten Minute eilte sie davon. –
Der Garten lag an der Rückseite des Schlosses, dessen Mauern ihn auf der einen Seite begrenzten, während er sich auf der anderen bis an den Rand des hier steil abfallenden Schloßberges erstreckte. Die hohe Befestigungsmauer, welche ihn einst auch nach dieser Richtung hin abschloß, war niedergelegt worden, und über diese niedrige Brüstung, die ein dichtes Epheugeflecht umzogen hielt, schweifte der Blick ungehindert in’s Freie. Das Thal that sich dort in seiner ganzen Weite auf und entfaltete, von hier aus gesehen, seine eigenthümlich malerischen Reize; der Schloßberg war weithin berühmt wegen dieser Aussicht. Der Garten selbst verrieth noch überall den ehemaligen Burggarten. Etwas eng, etwas düster und sehr beschränkt im Raume, hatte er weder viel Sonnenschein, noch viel Blumenpracht, besaß aber dafür einen anderen selteneren Reiz: herrliche, uralte Linden beschatteten ihn und wehrten jeden Einblick, selbst vom Schlosse aus. Sie sahen ernst nieder auf die jüngere Generation, die, aus den ehemaligen Wällen und Befestigungen aufgewachsen, mit ihren schlanken Stämmen und ihrem frischen Grün den Schloßberg schmückte. Jene alten Baumriesen freilich wurzelten schon länger als ein Jahrhundert in diesem Boden; die riesigen Stämme [194] hatten schon manchen Sturm ausgehalten, und die mächtigen Aeste der Kronen flochten sich in einander zu einem einzigen, dichten Laubdache, das nur selten einen Sonnenstrahl hindurch ließ. Es breitete tiefen, kühlen Schatten über den ganzen Raum, dem die Blumen fast vollständig fehlten. Nur einzelne Gebüschgruppen erhoben sich auf dem grünen Rasen, und inmitten desselben rauschte ein Brunnen. Es war eine Fontaine im Geschmacke des vorigen Jahrhunderts, mit alten, halbverwitterten Steinfiguren, die in seltsam phantastischer Auffassung Nixen und Wassergeister darstellten. Dunkles, feuchtes Moos bedeckte die steinernen Häupter und Arme, die eine Muschelschale stützten, aus welcher der Wasserstrahl emporstieg, um dann in tausend einzelnen Strahlen und Tropfen in das mächtige Bassin niederzurieseln. Auch hier überwucherte eine dichte, grüne Moosdecke das graue Gestein und gab dem sonst so krystallhellen Wasser eine eigenthümlich dunkle Färbung. Der „Nixenbrunnen“, wie er nach den Steingruppen hieß, die ihn schmückten, stammte aus der frühesten Zeit des Schlosses und spielte noch jetzt eine gewisse Rolle in der Umgegend. Es knüpfte sich irgend eine alte Sage daran, die dem Quell eine heilbringende Kraft lieh, und trotz Neuzeit und Aufklärung und obgleich das alte Bergschloß längst ein modernes Regierungsgebäude geworden war, behauptete sich jene Kraft in dem Aberglauben des Volkes.
Man schöpfte an gewissen Tagen des Jahres das Wasser; man gebrauchte es als Mittel gegen Krankheit, als Arznei für allerlei Leiden, zum großen Mißvergnügen des Gouverneurs, der schon mehrere Male diesem Unfuge energisch entgegengetreten war. Er hatte sogar den Schloßgarten schließen lassen, der früher Jedermann zugänglich war, und verboten, irgend einem Fremden den Zutritt zu gestatten, aber dieses Verbot hatte die entgegengesetzte Wirkung. Das Volk hielt eigensinnig fest an seinem Aberglauben und klammerte sich nur um so zäher an den Gegenstand desselben. Die Schloßdienerschaft wurde bald mit Bitten, bald mit Geschenken bestochen, um heimlich zu dulden, was sie nicht offen durfte geschehen lassen, und das Wasser des Schloßbrunnens galt nach wie vor als so heilkräftig, wie nur irgend ein Weihwasser, wiewohl es doch offenbar unter dem Schutze der heidnischen Nixengottheiten stand.
Gabriele hatte gleichfalls von diesen Dingen gehört, durch den Freiherrn selbst, der sich oft mit heftigen Unwillen darüber äußerte, und vielleicht war es die von der Mutter so gefürchtete fortwährende Opposition gegen den Vormund, welche die junge Dame bestimmte, gerade hier ihren Lieblingsplatz zu wählen. Auch heute hatte sie ihn aufgesucht, aber weder der Nixenbrunnen selbst, noch die weite Aussicht, welche sich drüben an der freien Seite des Gartens aufthat, vermochte sie zu fesseln. Gabriele war übler Laune, und sie hatte allen Grund dazu. Nach der schrankenlosen Freiheit, die sie in Z. genossen, konnte sie sich durchaus nicht mit den strengen Formen des Raven’schen Hauses befreunden, um so weniger, als diese Formen die gehofften öfteren Begegnungen mit Georg Winterfeld unmöglich machten. Das junge Paar war in R. fast vollständig getrennt und mußte sich, ein zufälliges Zusammentreffen vor Zeugen abgerechnet, mit einem flüchtigen Sehen aus der Ferne oder einem Gruße begnügen, den Georg verstohlen zu den Fenstern hinaufsandte. Er hatte freilich eine Annäherung versucht und den Damen einen kurzen Besuch gemacht, zu dem die frühere Bekanntschaft ihn berechtigte. Die Baronin hätte auch nichts dagegen gehabt, den liebenswürdigen jungen Mann auch hier öfter zu empfangen, aber Raven gab seiner Schwägerin einen sehr deutlichen Wink, daß er keinen näheren Verkehr zwischen den Damen seines Hauses und einem seiner jungen Beamten wünsche, der noch gar keinen Anspruch auf eine solche Auszeichnung habe. In Folge dessen wurde der Besuch zwar angenommen, aber es erfolgte keine Einladung, ihn zu wiederholen, und damit war der Versuch gescheitert.
Es war freilich mehr Ungeduld als Schmerz, womit Gabriele den Zwang ertrug, der sie hier von allen Seiten umgab. Seit der Freiherr sie so vollständig zu der Kinderrolle verurtheilte, vermißte sie sehr die zarte und doch leidenschaftliche Huldigung Georg’s, die sie früher als selbstverständlich hingenommen hatte. Er fand ihre Bildung nicht „lückenhaft und vernachlässigt“; er examinirte sie nicht und muthete ihr keine Unterrichtsstunden zu, wie der Vormund, der so gar nicht wußte, wie man junge Damen ihres Alters eigentlich zu behandeln habe. Für Georg war sie die Geliebte, das angebetete Ideal; ihn beglückte schon ein Gruß, den sie ihm aus der Ferne zuwarf – trotzdem war sie auch auf ihn böse. Warum versuchte er nicht energischer, die Schranken zu durchbrechen, die sie von einander trennten? warum hielt er sich in so ehrerbietiger Entfernung? warum schrieb er ihr nicht wenigstens? Das junge Mädchen war noch viel zu kindlich und unerfahren, um die zarte Rücksicht zu würdigen, mit der Georg Alles vermied, was nur den geringsten Schatten auf sie werfen konnte, mit der er Trennung und Entfernung ertrug, ehe er irgend etwas unternahm, was ihren Ruf gefährdete.
„Nun, Gabriele, suchst Du die Geheimnisse des Nixenbrunnens zu ergründen?“ sagte plötzlich eine Stimme. Sie wandte sich rasch um. Freiherr von Raven stand vor ihr. Er mußte soeben erst aus dem Gebüsche hervorgetreten sein; es geschah überhaupt nur höchst selten, daß er den Garten betrat. Ihm fehlte sowohl die Zeit, wie die Lust zu einsamen Spaziergängen. Auch heute mußte ihn irgend etwas Besonderes herführen, denn er schritt sofort auf die Fontaine zu und begann sie aufmerksam von allen Seiten zu besichtigen.
„Nun, Onkel Arno, mit den Geheimnissen mußt Du ja besser vertraut sein, als ich,“ gab Gabriele lachend zur Antwort. „Ich bin noch fremd hier, und Du wohnst schon lange im Schlosse.“
„Glaubst Du, daß ich Zeit habe, mich um Kindermärchen zu kümmern?“
Der verächtliche Ton der Worte reizte die junge Dame unwillkürlich. „Du hast wohl niemals die Kindermärchen geliebt?“ fragte sie. „Auch als Knabe nicht?“
„Auch als Knabe nicht! Ich hatte schon damals Besseres zu denken.“
Gabriele sah zu ihm auf; dieses stolze, strenge Antlitz mit dem Ausdrucke finsteren Ernstes sah freilich nicht aus, als hätte es je die Märchenpoesie der Kindheit gekannt oder geliebt.
„Trotzdem gilt mein Besuch heut dem Nixenbrunnen,“ fuhr er fort. „Ich habe Befehl gegeben, ihn abzubrechen und den Quell zu verstopfen, will mich aber zuvor überzeugen, ob die Anlagen nicht etwa darunter leiden, und ob deswegen Vorkehrungen getroffen werden müssen.“
Gabriele fuhr erschrocken und empört auf. „Der Brunnen soll vernichtet werden? Weshalb denn?“
„Weil ich endlich des Unfuges müde bin, der damit getrieben wird. Der lächerliche Aberglaube ist nicht auszurotten. Trotz meines strengen Verbotes wird fortwährend heimlich Wasser aus dem Brunnen geschöpft und damit dem Unsinn immer wieder neue Nahrung gegeben. Es ist die höchste Zeit, der Sache ein Ende zu machen, und das kann nur geschehen, wenn dem Aberglauben der Gegenstand genommen wird, an den er sich klammert. Es thut mir leid, daß eine alte Merkwürdigkeit des Schlosses dabei zum Opfer fallen muß, aber gleichviel – sie muß fallen.“
„Aber dann wird dem Garten seine schönste Zierde geraubt,“ rief Gabriele. „Gerade dieses einsame Sprühen und Rauschen der Fontaine gab ihm den höchsten Reiz. Und das silberhelle Wasser soll auf immer in die dunkle Erde gebannt werden? Das ist abscheulich, Onkel Arno; das leide ich nicht.“
Raven, der noch immer mit der Besichtigung des Brunnens beschäftigt war, wandte langsam den Kopf nach ihr.
„Du leidest es nicht?“ fragte er, sie scharf fixirend, aber es war nicht jener drohende, gebieterische Blick, mit dem er sonst jeden Widerspruch zu Boden schmetterte. Es dämmerte sogar ein leises Lächeln in seinem Gesichte auf. „Dann wird freilich nichts übrig bleiben, als daß ich meinen Befehl zurückziehe; es wäre freilich das erste Mal, daß so etwas geschieht. – Glaubst Du denn wirklich, Kind, ich werde Deinen romantischen Bedenken einen meiner Entschlüsse opfern?“
Das war wieder das überlegene, halb spöttische, halb mitleidige Lächeln, das Gabriele stets zur Verzweiflung brachte, und der Ausdruck „Kind“ that es nicht minder. Tief verletzt in ihrer siebzehnjährigen Würde, zog sie es vor, gar nicht zu antworten, und begnügte sich, ihrem Vormund einen entrüsteten Blick zuzuwerfen.
„Du thust ja, als ob Dir mit der Wegnahme des Brunnens eine persönliche Beleidigung geschähe,“ sagte der Freiherr. „Mir scheint, Du hegst noch den ganzen Respect der Kinderstube vor [196] den Ammenmärchen und fürchtest Dich im vollen Ernste vor dem gespenstischen Nixenvolk.“
„Ich wollte, die Nixen rächten sich für den Spott und für die angedrohte Vernichtung,“ rief Gabriele mit einem Tone, der muthwillig sein sollte, aber sehr gereizt klang. „Mich freilich würde ihre Rache nicht treffen.“
„Aber mich, meinst Du?“ ergänzte Raven sarkastisch. „Sei ruhig, Kind! Dergleichen droht nur poetischen Mondscheinnaturen. An mir möchte sich dieser Nixenzauber doch wohl umsonst versuchen.“
Sie standen unmittelbar am Rande der Fontaine; das Wasser rauschte und rieselte eintönig aus der Muschelschale nieder, plötzlich aber gab ein Windhauch dem Strahle eine andere Richtung; er sprühte seitwärts, und ein funkelnder Tropfenregen ergoß sich gleichzeitig über den Freiherrn und Gabriele. Sie sprang mit einem leichten Aufschrei zurück. Raven blieb gelassen stehen.
„Das traf uns Beide,“ sagte er. „Deine Nixen scheinen sehr unparteiischer Natur zu sein. Sie strecken nach Feind und Freund ihre nassen Arme.“
Die junge Dame war nach der Bank geflüchtet und trocknete mit dem Taschentuche die Tropfen von ihrem Kleide. Der Spott ärgerte sie unbeschreiblich, gleichwohl wußte sie ihm nichts entgegen zu setzen. Jedem Anderen gegenüber wäre sie auf den Scherz eingegangen und hätte aus dem Zufall eine Neckerei gemacht – hier konnte sie es nicht. Der Scherz des Freiherrn war immer Sarkasmus; sein Lächeln schloß nie eine Spur von Heiterkeit in sich, und es war höchstens Ironie, die auf Augenblicke den gewohnten Ernst seiner Züge verdrängte. Er schüttelte mit einer raschen Bewegung die Tropfen ab, die auch ihn überschüttet hatten, und trat dann gleichfalls zur Bank, während er fortfuhr:
„Es thut mir leid, daß ich Dir Deinen Lieblingsplatz nehmen muß, aber das Urtheil über den Brunnen ist nun einmal gesprochen. Du wirst Dich darein finden müssen.“
Gabriele warf einen Blick auf die Fontaine, deren träumerisches Rauschen vom ersten Tage an einen geheimnißvollen Reiz auf sie geübt hatte. Sie kämpfte fast mit dem Weinen, als sie antwortete:
„Ich weiß es ja, daß Du nicht darnach fragst, ob Deine Befehle Jemanden wehe thun, und daß es ganz umsonst ist, Dich zu bitten. Du hörst ja niemals auf eine Bitte.“
Raven kreuzte ruhig die Arme. „So? Weißt Du das bereits?“
„Ja, und es bittet Dich auch Niemand. Sie fürchten sich ja Alle vor Dir, die Dienerschaft, Deine Beamten, die Mama sogar, nur ich –“
„Du fürchtest Dich nicht?“
„Nein!“