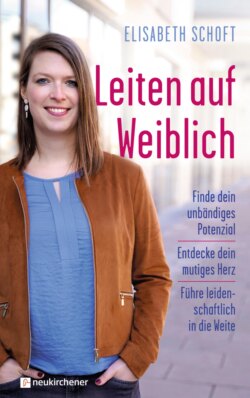Читать книгу Leiten auf Weiblich - Elisabeth Schoft - Страница 7
Оглавление1
Dürfen die das?
Eine Frage, die Frauen in Leiterschaft im (konservativ)-christlichen Kontext immer wieder begegnet, lautet: »Dürfen die das eigentlich?« Meist unausgesprochen bleibt die zweite Frage: »Können die das überhaupt?«
Diese Unsicherheit taucht vor allem in Kulturen mit einem eher traditionellen Frauenbild auf – leider ist das oft im christlichen bzw. freikirchlichen Kontext der Fall. In Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die keine Einigung in der Frage der Frauenordination finden, gibt es logischerweise weniger Frauen in Führungspositionen, zu deren Verantwortungsbereich weder Kindergottesdienste, Frauenarbeit noch Dekoration zählen. Ausnahme ist hier die Evangelische Kirche, in der leitende Positionen schon seit Längerem mit Frauen besetzt werden – von der Pfarrerin hin zu Präses und Ratsvorsitzender.
Eine Folge des weiblichen Führungsmangels in christlichen Gemeinschaften: Frauen, die sich normalerweise (auch beruflich) für ihre Kirchen investieren würden, weichen in die freie Wirtschaft aus, um dort ihre Begabungen auszuüben. Allerdings gibt es auch außerhalb der Kirchenmauern noch viel zu tun: Während bis zu einem gewissen Führungslevel Frauen durchaus Leitungspositionen bekleiden (laut Statistischem Bundesamt war 2019 mit 29,4 Prozent knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland weiblich8), zeigen Initiativen wie #ichwill und #jetztreichts (Oktober 2020) rund um Janina Kugel, ehemaliges Vorstandsmitglied und Personalchefin bei Siemens, dass die viel besprochene »Gläserne Decke« noch immer existiert. In der Wirtschaft mag die Frage nach der Legitimation von Frauen in Führung besser beantwortet sein, doch nur wenige Unternehmen lassen zu, dass Frauen auch im gehobenen Management leiten. Ein kleiner Zahlen-Exkurs verdeutlicht das: Der durchschnittliche Frauenanteil in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen in der Schweiz beträgt 14 Prozent9, in Deutschland 10,1 Prozent10. Besonders in Schweizer Verwaltungsräten von Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden gilt der »Thomas-Kreislauf«11: Es sitzen mehr Männer, die Thomas heißen, in einem Verwaltungsrat als Frauen generell: »Bei jedem dritten deutschen Börsenunternehmen ist ‚Null Frauen im Vorstand‘ (…) nicht nur der aktuelle Ist-Zustand, sondern auch explizit das Ambitionsniveau für die absehbare Zukunft«, heißt es im Bericht der deutsch-schwedischen AllBright-Stiftung. Daran ändert auch die im Januar 2021 in Kraft getretene Frauenquote für Vorstände börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern nichts.12
Was sagt die Bibel dazu?
Es mag in der heutigen Zeit, in der die Frauenemanzipation hier im Westen schon einen weiten Weg gegangen ist, merkwürdig anmuten, diese Fragestellung überhaupt zu erwähnen. Fakt ist, dass viel unentdecktes Leitungspotenzial innerhalb und außerhalb unserer Kirchen brachliegt, weil die Frage, ob Frauen biblisch gesehen leiten dürfen, oft nur auf eine Art und Weise beantwortet wird. Als junge Frau, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist, klingeln mir bei einer Handvoll Bibelstellen immer die Ohren – denn sie werden zuverlässig angeführt, um die aufkommende Diskussion schnell in ihre gewohnten Schranken zu weisen: »Die Frauen sollen in den Gemeinden schweigen (…), sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt« (1. Korinther 14,34). Oder: »Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter« (Epheser 5,22). So aus dem Kontext gerissen klingen diese Verse eindeutig. Doch in mir rebelliert es: Was ist an Frauen falsch und ungenügend, dass man ihnen nicht erlaubt zu leiten oder zu predigen? Wurden wir tatsächlich nicht dafür erschaffen, auch außerhalb der eigenen Familie Verantwortung zu übernehmen? Woher kommen aber dann die sogenannten »Ambitionen«, wenn sie nicht gottgewollt wären? Ist es etwa meine Bestimmung, sie zu unterdrücken?
Auch Sabine Fürbringer hat sich diesen Fragen gestellt. Im folgenden Artikel, der ursprünglich im christlichen Frauenmagazin JOYCE13 erschien, kam sie zu einem Schluss, der mir Frieden über diese Fragestellung geschenkt hat.
Sabine Fürbringer (55) ist Psychologin und Paartherapeutin mit eigener Praxis. Sie leitet den Bereich »Campus We«, ein Netzwerk von »Campus für Christus« für Frauen, die leiten und Leben gestalten. Die vertiefte Auseinandersetzung mit einschlägigen biblischen Passagen hat sie überzeugt, dass es durchaus biblisch ist, wenn Frauen gemeinsam mit Männern auf Augenhöhe leiten.
Das Weib schweige
Seit ich ein Ministry leite, das Frauen in Leiterschaft anspricht, gerate ich immer mal wieder in Gespräche bezüglich der Rolle der Frau im gemeindlichen Kontext. Im Wesentlichen geht es dabei um die beiden Fragestellungen, ob eine Frau lehren und ob sie leiten darf, wenn zu den Angesprochenen auch Männer gehören. Einige Gesprächspartner vertreten die Ansicht, dass das nicht nur möglich, sondern sogar notwendig sei. Andere ringen mit der Frage. Sie sehen zwar gewisse Widersprüche zwischen theologischer Lehrmeinung und gelebter Praxis, aber die Grundaussage, dass der Mann eben doch mehr Verantwortung trägt, kann das irgendwie nicht entschärfen. Und natürlich gibt es auch die ganz Überzeugten, die uns völlig auf dem Holzweg wähnen, wenn wir Frauen in Leitung zulassen. Glücklicherweise begegne ich dieser Meinung nur selten.
Selbst bin ich schon mein ganzes Erwachsenenleben mit dieser Frage unterwegs. Dabei ist eine tiefe Überzeugung gewachsen, dass Frauen gleichwertige Gegenüber der Männer sind. Gott rüstet sie mit Begabungen aus und spricht Berufungen über ihrem Leben aus, unabhängig vom Geschlecht, so, wie es ihm gefällt. Dazu können auch das Lehren und Leiten gehören.
Frauen, die sich an die biblischen Grundlagen halten wollen, kommen nicht umhin, diese Fragen für sich zu klären. In unserer westlichen Welt ist es mittlerweile selbstverständlich, dass Frauen dieselben Führungspositionen einnehmen können wie Männer. Findet diese Leiterschaft außerhalb der gemeindlichen Strukturen statt, in der Wirtschaft, der Gesellschaft oder Politik, gibt es dagegen auch kaum Widerspruch. Anders sieht es aus, wenn eine Frau ihre Qualitäten innerhalb einer geistlichen Gemeinschaft einbringen möchte.
Als Frau persönlich betroffen
Statements zur Stellung der Frau innerhalb des christlich geprägten Kontextes sagen indirekt immer auch etwas über die Frau als Person aus. Falls also Gott tatsächlich verbietet, dass Frauen auf Augenhöhe mit den Männern seinen Auftrag in dieser Welt wahrnehmen, dann hat das zwangsläufig eine entwertende Nuance.
Natürlich kenne ich das beschwichtigende Argument, gleichwertig bedeute eben nicht gleichartig, sondern gleichwürdig. Jeder habe seine Verantwortungen zugeteilt bekommen. Leiten und Lehren sei eben in größerem Umfang eine Aufgabe, die Männer aufgrund ihrer schöpfungsgemäßen Voraussetzungen und Verteilungen anvertraut bekommen hätten. Das mache sie nicht wertvoller oder besser. Zudem seien Demut, Unterordnung oder Dienen viel ehrenhafter als das Leiten. Wenn eine Frau ambitioniert ist und Verantwortung übernehmen will, wird das eher negativ aufgefasst im Sinn von Machtgier und Geltungsdrang. Bei einem Mann aber gilt dasselbe Verhalten als verantwortungsbewusst oder führungsstark.
Solche Aussagen wirken, egal, in welchem Kontext ich meine Leitungsgabe einsetzen möchte. Sie prägen mein Denken über mich selbst und stehen wie eine Hürde im Raum, die mich zweifeln und zögern lässt. Darum lohnt es sich auch für Frauen, die in einem säkularen Umfeld Verantwortung tragen, sich auf ein sicheres biblisches Fundament zu stellen. Denn als Christinnen wollen wir die Bibel ernst nehmen und unser Leben nach ihr ausrichten.
Entwertung und Entmündigung
Wenn wir Frauen von geistlicher Leiterschaft ausschließen oder den verbreiteten Kniff anwenden, es sei in Ordnung, wenn ein hierarchisch übergeordneter Mann da ist und die Rolle autorisiert, dann legen wir damit nahe, dass Männer in ihrer Gotteserkenntnis ein Stück näher an den Wahrheiten des Himmels dran sind als die Frauen. Vielleicht verstehen sie Gott besser, weil er ihnen ein wenig ähnlicher ist? Wenn wir Frauen einen ganz begrenzten Rahmen stecken, in dem sie ihre Lehrbegabung einsetzen dürfen, nämlich unter anderen Frauen oder bei Kindern, klingt das sehr danach, als wäre ihre Kapazität gerade ausreichend für diese nicht ganz mündigen Menschen. Ganz konsequent sind wir allerdings nicht. Im missionarischen Kontext war es Frauen schon lange erlaubt, alle Ämter und Aufgaben auszufüllen, wohl aus Mangel an bereitwilligen Menschen, die diese Strapazen auf sich nehmen wollten. Manchmal wird sogar unterschieden zwischen einer Leitungsaufgabe, die wir im außerkirchlichen Setting zwar akzeptieren, die in der Gemeinde aber undenkbar wäre. Ich empfinde diese Unterteilung in geistliche und weniger geistliche Aufgaben künstlich. Gott interessiert sich für alle Lebensbereiche und in jedem Beruf kann und soll ich gemäß meiner gottgegebenen Berufung sein Reich hineintragen.
Beim Argument, dass Männer in einer geistlichen Hierarchie mehr Autorität hätten, bewegen wir uns biblisch als auch in der Praxis auf dünnem Eis. Manchmal wird die Vorherrschaft des Mannes auch mit der Reihenfolge in der Schöpfungsgeschichte belegt, wobei hier Reihenfolge mit Rangordnung gleichgesetzt wird. Entsprechend wären dann wohl die Tiere ranghöher als die Menschen? Und was ist mit all den Erstgeborenen, die in ihrer Erwählung übergangen wurden, weil eben ein David oder ein Joseph Gottes Absichten mehr entsprach? Die Liste von Argumenten ließe sich fortsetzen, die Gegenargumente ebenso. Davon bin ich müde. Zurück bleibt das schale Gefühl, als Frau nicht für voll genommen zu werden, und das macht etwas mit dem Selbstbild der Frauen.
Die eine Hälfte fehlt
Parallel dazu und mindestens so gravierend sind der Reichtum und die Vielfalt, die uns durch diese Einseitigkeit entgehen. Der weibliche Blick auf die Bibel in unseren Gemeinden fehlt weitgehend, zumindest von der Kanzel und auch von den theologischen Büchern her, die uns prägen. Themen, die wir anders angehen, Themen, die uns interessieren, Lebenserfahrungen, die wir einbringen. Aber auch in puncto Leiterschaft entgeht uns der weibliche Blick auf die Welt. Wie anstrengend, Dinge für die Gesamtheit entscheiden zu müssen und die eine Hälfte der Betroffenen nicht oder höchstens konsultativ mit am Tisch zu haben. Das ist nicht nur ungerecht, sondern wir lassen uns so auch eine Quelle der Weisheit entgehen. Die Wirtschaft hat das erfasst und viele Unternehmen bemühen sich mittlerweile, Frauen in Entscheidungsgremien mit einzubinden. Das geschieht nicht ganz selbstlos. Vielmehr belegen viele Studien, dass die Performance einer Firma signifikant besser wird, wenn in den Führungsgremien mindestens dreißig Prozent der Beteiligten Frauen sind. Es scheint, dass sich ab dieser Schwelle die Kultur so verändert, dass Frauen sowohl ihr Potenzial ausleben können als auch Gehör finden.
Gottes wunderbare Startbedingungen
Dass diese Zusammenarbeit bessere Resultate hervorbringt, ist nicht weiter erstaunlich. Die Schöpfungsgeschichte malt uns vor Augen, wie Gott Mann und Frau als sein Ebenbild geschaffen hat – und das sind sie erst in ihrer Gemeinschaft. Einander zugewandt nehmen sie den gleichen göttlichen Auftrag, die Verantwortung und auch den Segen in Empfang. In der wechselseitigen, gleichberechtigten Abhängigkeit voneinander sind sie auf Augenhöhe an der Startlinie. Doch wir wissen, was dann passierte – der verhängnisvolle Biss in die Frucht hat das zunichtegemacht. Krankheit, Schuld, Streit und Leid sind die Konsequenzen. Aber nicht nur. Das Gleichgewicht zwischen den beiden gerät in Schieflage, der Mann übernimmt die dominante Rolle und die Frau sehnt sich in ihrer Abhängigkeit nach seiner Gnade. Die beiden marschieren aus dem Paradies und ab sofort ist das die natürliche Ordnung. Mehr noch, diese Verzerrung wird zur göttlichen Ordnung erhoben. In der christlichen Version wird mittlerweile das Unterdrückungssystem verurteilt, an der Hierarchie halten aber viele fest.
Erlösung wäre greifbar
Im Leben von Jesus können wir beobachten, wie die Erlösung in diese Welt hineinkommt. Er vergibt Sünden, er heilt Kranke, er nimmt sich der Ausgestoßenen an – mit diesen Aspekten sind wir bestens vertraut. Aber sehen wir auch, wie in seinem Umgang mit Frauen die sündige Ordnung umgestoßen wird? Exemplarisch dafür steht die Begebenheit im Hause der Schwestern Maria und Martha, von der in Lukas 10 berichtet wird. Martha beklagt sich über Marias Benehmen, die, statt in der Gästebetreuung zu helfen, Jesus zu Füßen sitzt. In unzähligen Predigten habe ich gehört, Jesus lobe Maria für ihre gute Wahl, weil sie anstelle der Geschäftigkeit die Kontemplation sucht. Das steckt bestimmt auch in dieser Geschichte. Doch der gesellschaftliche und theologische Zündstoff liegt an einer anderen Stelle. Maria erdreistet sich, die traditionell dienende, untergeordnete Frauenrolle im Haushalt zu tauschen mit der den Männern vorbehaltenen Auseinandersetzung mit geistlichen Inhalten. Sie sitzt dem Rabbi, dem Lehrer zu Füßen und ist damit genau an dem Ort, an den Jünger, Lernende gehören. Dieser Ort ist explizit für Männer und keinesfalls für Frauen gedacht. Statt diese Ungeheuerlichkeit zu maßregeln, lobt Jesus sie dafür. In seiner Nähe ist weder Mann noch Frau das ausschlaggebende Kriterium, sondern das zugewandte Herz eines Menschen.
Paulus ist für die Frauen
Folgerichtig nimmt Paulus in Galater 3,28 diesen Faden auf, wenn er betont, in Christus gebe es weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freien. Entlang der gesellschaftlichen Diskriminierungslinien, die einen Teil der Menschen aufgrund willkürlicher Merkmale in entrechtete oder geistlich unwürdige Kategorien einteilt, postuliert er ihre Gleichwertigkeit in Gottes Reich. Frauen gehören explizit dazu. Das Christentum war in seinen Anfängen als die Religion der Sklaven und Frauen bekannt. In diesem Licht müssen wir die anderen Aussagen von Paulus, die gerne ins Feld geführt werden, ansehen.
Die Lebensumstände zur Zeit der ersten Gemeinden unterschieden sich stark von unseren heutigen Voraussetzungen. Gerade die Briefe sprachen in spezifische Situationen hinein, waren Wegweisung in konkreten Herausforderungen. Lassen wir die Fragestellung weg und schauen die Antwort isoliert an, entsteht ein verzerrtes Bild.
Frauen waren mehrheitlich ungebildet und bei gesellschaftlichen oder religiösen Themen ohne Einfluss. Letzteres veränderte sich, sobald eine Frau sich dem Evangelium zuwandte und zur Gemeinde stieß. Leider machte das den bildungsmäßigen Rückstand nicht wett. Zwar wurden Frauen vom Heiligen Geist mit den gleichen Gaben ausgestattet, aber gerade im griechischen Umfeld war die junge Gemeinde mit Lehren konfrontiert, deren Einordnung theologisches Wissen erfordete. Ohne diesen Rückhalt standen den Irrlehren Tür und Tor offen – doch dieses Wissen fehlte den Frauen. So ist es durchaus einleuchtend, dass Paulus in 1. Timotheus 2 den Frauen untersagt zu lehren. Sie müssen zuerst noch lernen und das sollen sie zu Hause tun, indem sie ihre Männer befragen, statt in der Versammlung lauthals störend ihrem Unverständnis Ausdruck zu geben. Im gleichen Atemzug ruft er sie auch in ihrem Übermut zurück, sich über die Männer zu erheben und über sie zu herrschen. Das Wort, das Paulus hier verwendet, steht nur an genau dieser Stelle in der Bibel und hat die Konnotation von dominieren und kontrollieren. Dass er das verurteilt, ist nachvollziehbar. Umgekehrt sagt er damit nicht, es wäre in Ordnung, wenn Männer das tun.
Die Praxis trägt gute Früchte
Zu den einschlägigen Paulusstellen, die gerne ins Feld geführt werden, um Frauen ihren untergeordneten Platz zuzuweisen, gibt es mittlerweile viele gute Arbeiten. Theologen und Theologinnen kommen zum Schluss, dass es auch paulinisch gesehen absolut vertretbar ist, Frauen die gleichen Rechte zuzusprechen. Was, wenn sie recht haben? Dann gingen wir das Risiko ein, mit der Unterordnungstheologie falsch zu liegen.
Darum wäre ein abschließendes Kriterium der Blick in die Praxis: Welche Früchte wachsen, wenn Frauen Zugang zu allen Ämtern und Möglichkeiten haben? Schon Paulus lobt Gemeindeverantwortliche wie Priscilla, Lydia, Phoebe oder Junia. Bewegungen wie die Heilsarmee praktizieren die Gleichstellung seit über hundertfünfzig Jahren. Die Missionsgeschichte spricht Bände vom vollwertigen Beitrag der Frauen. Viele gute Früchte sind daraus gewachsen. Ich für meinen Teil habe meine Schlüsse gezogen und möchte mich fortan der Umsetzung dieser Gleichwertigkeit widmen: Frauen zu befähigen und den Zugang zu Leitungsfunktionen zu eröffnen, sei das in einem kirchlichen oder säkularen Umfeld – das ist herausfordernd genug.
Ist es nicht erfrischend von Sabine Fürbringer, einen solchen Standpunkt zur Fragestellung zu hören, ob es Frauen – biblisch gesehen – erlaubt ist zu leiten? Viele der Bibelkommentare, die ich diesbezüglich konsultiert habe, argumentieren mit der gottgegebenen Reihenfolge der Schöpfungsordnung: Der Mann steht über der Frau, weil er zuerst erschaffen wurde. Für mich ist die Antwort auf diese Frage nicht nur eine rein theologische – sie spiegelt gleichzeitig mein Gottesverständnis wider. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Gott schon zu biblischen Zeiten Frauen wie Debora (Richterin und Prophetin im Alten Testament), Hanna (Prophetin im Neuen Testament) oder Lydia (die erste Christin Europas, die eine Gemeinde baute) berief und befähigte – nur um die nachfolgenden Generationen dann doch daran zu hindern, ihren Begabungen und Berufungen nachzugehen.
8 Destatis: »Frauen in Führungspositionen«, Statistisches Bundesamt, 2020. www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/frauen-fuehrungspositionen.html (letzter Zugriff am 29.01.2021).
9 GetDiversity: Diversity Report Schweiz 2020. www.diversityreport.ch/wp-content/uploads/2020/09/Sep_2020_GD_LadiesDrive_Diversity_ONLINE.pdf (zuletzt aufgerufen am 29.01.2021).
10 AllBright Stiftung: Deutscher Sonderweg – Frauenanteil in DAX-Vorständen sinkt in der Krise. Berlin 2002. www.allbright-stiftung.de/berichte (letzter Zugriff am 29.01.2021).
11 GetDiversity (2020) und NZZ am Sonntag/Albert Steck (2020): »Warum der Chef meistens Thomas heißt – und fast nie Maria«. https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/thomas-prinzip-rangliste-der-namen-von-verwaltungsraeten-ld.1579876 (letzter Zugriff am 29.01.2021).
12 Im Falle einer Neubesetzung des Vorstands ohne Frau ist lediglich eine schriftliche Begründung ausreichend, um als Zielgröße weiterhin »Null Frauen« anzugeben.
13 Der Text wurde für dieses Buch gekürzt und angepasst. Sabine Fürbringer: »Das Weib schweige?«, in: JOYCE 1/2020, SCM Bundes-Verlag, S. 48–51. Infos: www.joyce-magazin.net.