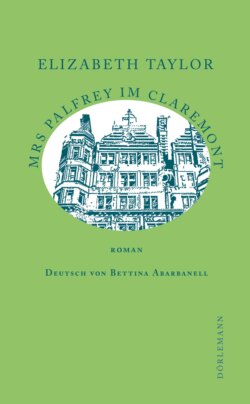Читать книгу Mrs Palfrey im Claremont - Elizabeth Taylor - Страница 8
ОглавлениеKapitel Drei
Desmond kam nicht. Der Pullover, den Mrs Palfrey für ihn strickte, würde bald fertig sein, und alle wussten, dass er nicht erschienen war, um ihn sich zu holen. Im Fernen Osten hatte es wesentlich zum Leben dazugehört, das Gesicht zu wahren, und Mrs Palfrey wahrte jetzt, so gut es ging, ihres. Für gewöhnlich führt das zu Schwierigkeiten, und so war es auch bei Mrs Palfrey, denn es bedeutete, dass sie lügen musste und gezwungen war, sich hinterher an ihre Lügen zu erinnern. Sie musste Krankheiten für Desmond erfinden und Auslandsreisen im Rahmen seiner Arbeit – die, wie sie sehr wohl wusste, keinerlei Auslandsreisen mit sich brachte. Das empfand sie als äußerst anstrengend, und hinzu kam ihr heimlicher Kummer, dass sie in London letztlich doch niemanden hatte, der zu ihr gehörte, und dass der strebsame, recht untadelige junge Mann, auf den sie immer so stolz gewesen war, sich kein bisschen für sie interessierte. Noch nicht einmal ihre Briefe hatte er beantwortet, ihre Einladungen zum Abendessen im Claremont. Junge Männer waren immer hungrig und sehr oft knapp bei Kasse, hatte sie angenommen; nun aber zeigte sich, dass ihr Enkel weder hungrig noch knapp bei Kasse genug war, um in dieser Hinsicht irgendwelche Unterstützung ihrerseits zu benötigen. Das kränkte sie nicht nur, es empörte sie. Nicht zuletzt war es eine Frage der Erziehung. Briefe sollten beantwortet werden. Sie konnte nicht umhin, diesen Fehltritt ihrer Tochter gegenüber zu erwähnen, und schrieb ihr in ihrer unnachahmlichen Art, »sie meine ja bloß«. Es kam häufig vor, dass sie etwas »bloß meinte« oder »lediglich erwähnen« oder »nur mal gesagt haben« wollte. Ihre Tochter ging ganz beiläufig auf dieses »Meinen« ein, und zwar in ihrer gewohnt forschen Art, ohne Entschuldigung oder Erstaunen. »Sie sind alle gleich. Ich habe einen Brass auf die Jugend.« Solche landschaftlichen Wörter übernahm sie gern; ihren schottischen Ehemann ließen sie zusammenzucken. Er konnte sie nicht »verknusen«, wie sie es ausgedrückt hätte.
Ob sie sich ihren Sohn zur Brust nahm oder nicht, fand Mrs Palfrey nicht heraus. Weder kam er noch schrieb er ihr, und sie wünschte von Herzen, sie hätte im Claremont nie von ihm gesprochen. Sie hatte zunehmend das Gefühl, bemitleidet zu werden. Alle anderen Bewohner bekamen Besuch – selbst einigermaßen ferne Verwandte taten von Zeit zu Zeit ihre Pflicht; sie blieben eine Weile, lobten die Annehmlichkeiten des Hotels in den höchsten Tönen und zogen erleichtert wieder von dannen. Es war Mrs Palfrey schleierhaft, wie ihr einziges Enkelkind – noch dazu ihr Erbe – sie derart vernachlässigen konnte.
An einem ihrer schlimmsten Arthritis-Tage sprach Mrs Arbuthnot ihr gehässig ihre Anteilnahme aus, und in der darauffolgenden Nacht konnte Mrs Palfrey nicht schlafen. Von panischer Angst vor Einsamkeit heimgesucht, quälte sie sich durch die Stunden nach Mitternacht.
Ich darf mich nicht nervös machen lassen, warnte sie sich. Nervosität war schlecht für ihr Herz. Sie knipste das Licht an und fragte sich, ob es je Morgen werden würde. Sie versuchte zu lesen, doch ihr Herz ruckelte so zögerlich, dass jedes Pochen in ihrem Kopf widerhallte. Wenn ihr so zumute war, schien ihr alles besser, als allein zu sein – ein Pflegeheim, wo auch andere nachts wach liegen würden, ja sogar bei ihrer Tochter zu wohnen, vorausgesetzt, so etwas wäre je vorgeschlagen worden. Am Morgen – wie sie sich jetzt schwor – wäre ihr Lebensmut, die Gewissheit, dass sie nicht aufgeben würde, wiederhergestellt. Sie würde im Claremont bleiben, solange sie konnte, und von hier aus schließlich ins Krankenhaus gebracht werden, wo sie so schnell wie möglich zu sterben hoffte, ohne irgendwem zur Last zu fallen als denen, die dafür bezahlt wurden, sich um sie zu kümmern.
»Die jungen Leute sind sehr herzlos«, hatte Mrs Arbuthnot zu sagen gewagt.
»Er würde kommen, wenn er könnte«, hatte Mrs Palfrey erwidert und die Lippen zusammengepresst, denn sie hatten gezittert.
»Wir armen alten Frauen leben zu lange«, hatte Mrs Arbuthnot mit einem Lächeln gesagt.
Wenn sie von ihrem Ehemann sprach, hatte Mrs Palfrey bemerkt, war der bloße Ton ihrer Stimme ein Vorwurf an ihn, gestorben zu sein, sie sitzen gelassen zu haben. Unter den gegebenen Umständen wäre er ihr von so großem Nutzen gewesen, hätte ihr helfen können herumzukommen, abgeholt und gestützt zu werden: Vielleicht würde sie sogar immer noch in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Aber sie war nicht so allein wie Mrs Palfrey. Sie hatte Schwestern, die kamen und gingen, manchmal sogar mit dem Wagen, um Ausfahrten mit ihr zu unternehmen oder ihre alte Freundin Miss Benson im Krankenhaus zu besuchen. Miss Benson hatte im Claremont gewohnt, bevor sie krank wurde.
»Sie hatte niemanden«, sagte Mrs Arbuthnot, was heißen sollte, niemanden außer Mrs Arbuthnot. »Keine Menschenseele. Sie war vollkommen allein.« Ihre Augen ruhten auf Mrs Palfrey. »Nie kam irgendjemand sie besuchen. In all unseren gemeinsamen Jahren hier. Dabei war sie zu ihrer Zeit eine stadtbekannte Frau.«
»Ich bin viel im Ausland gewesen«, sagte Mrs Palfrey. »Da verliert man den Kontakt.«
»So ist es wohl. Wir müssen unsere Freundschaften instand halten. Das hat, glaube ich, Doktor Johnson gesagt. Aber Sie, Sie haben natürlich Ihren Enkel.«
»Ja, ich habe Desmond.« Ich bin wirklich nicht mit dieser armen Miss Benson zu vergleichen, beruhigte sie sich. Zu Mrs Arbuthnot sagte sie: »Meine Tochter lebt so weit weg, in Schottland.«
»Und Sie würden nicht gern im Norden leben?«, bohrte Mrs Arbuthnot nach.
Mrs Palfrey war nicht dazu eingeladen worden, und sie kam auch nicht gut mit ihrer Tochter aus, die laut und burschikos war und den größten Teil ihrer Zeit damit verbrachte, Golf zu spielen oder darüber zu reden. »Ich weiß nicht, ob mir das Klima dort zuträglich wäre«, antwortete sie. In London schüttete es; in Schottland kam der Regen gleichmäßiger vom Himmel: als Schnee. Sie hatten es am Abend im Fernsehen gesehen.
»Nein, natürlich nicht«, sagte Mrs Arbuthnot leise, die Augen erneut auf Mrs Palfrey gerichtet. Es waren so blassblaue Augen, dass Mrs Palfrey mulmig wurde. Sie fand, dass blaue Augen mit den Jahren immer blasser und irrer wurden. Braune Augen dagegen bleiben gleich, dachte sie mit etwas Stolz.
Mäßig verzweifelt (denn sie hatte noch nicht herausgefunden, dass ihre Mitbewohner sich wesentlich mehr als nötig über Besucher unterhielten) schrieb Mrs Palfrey einer ihrer alten Schulfreundinnen, die in Hampstead wohnte. Sie kannte ihre Adresse, weil sie seit sechzig Jahren Weihnachtskarten austauschten, obwohl es wahrscheinlich kaum das war, was Mrs Arbuthnot oder Doktor Johnson darunter verstanden, eine Freundschaft instand zu halten.
Mrs Palfrey lud Lilian Kibble zum Mittagessen ins Claremont ein, und Lilian Kibble, die eine Taxifahrt von Hampstead zur Cromwell Road für zu teuer befand, antwortete, sie freue sich sehr und werde ihr bald Bescheid geben, wann es ihr passe – was sie Mrs Palfreys Meinung nach ebenso gut gleich hätte tun können. Natürlich hörte sie nichts mehr von Mrs Kibble, doch ein, zwei Wochen lang gestattete sie sich, auf einen Brief zu hoffen. Es war schon immer eine unausgewogene Freundschaft gewesen, in der Mrs Palfrey die treue, brave, unaufregende Schulkameradin war, zu der Lilian nach ihren Scharmützeln immer wieder zurückkehrte – den Überfällen auf die »besten Freundinnen« anderer Mädchen, anschließenden Zerwürfnissen, leidenschaftlichen Schwärmereien für Lehrerinnen, Eifersucht und Verrat. Nach der Schule war sie, abgesehen von den Weihnachtskarten, aus Mrs Palfreys Leben verschwunden; aber sie hatte drei Ehemänner gehabt, wie Mrs Palfrey wusste, und einer davon war immer noch da.
Eine weitere alte Bekannte aus der Zeit des Auswärtigen Dienstes lebte in Richmond. Das war ziemlich weit von der Cromwell Road entfernt, doch Mrs Palfrey beschloss, sie trotzdem aufzustöbern. Sie schrieb auch ihr und lud sie zum Mittagessen ein – doch die Arme war noch schlechter dran als Mrs Palfrey, sie lag mit gebrochener Hüfte unbeweglich im Bett. Sie schlug allerdings nicht vor, dass Mrs Palfrey sie doch ihrerseits in Richmond besuchen könne. Mrs Palfrey fand, das hätte sie tun sollen, und wäre auch gekommen.
Danach fiel ihr niemand mehr ein, den sie hätte einladen können. Sie hatte im Claremont ein wenig dazugelernt und beging nicht den Fehler, Mrs Arbuthnot zu erzählen, dass ihre Freundin Lilian vielleicht irgendwann zum Mittagessen kommen würde. Sie fühlte sich mehr und mehr wie die arme Miss Benson.
Die Zeit verging. Das ließ sich beweisen, obwohl so wenig geschah.
Im Claremont verbrachte man die Tage einzeln. Man saß an Einzeltischen und ging einzeln spazieren. Der Nachmittagsausflug zur Leihbücherei wurde stets allein unternommen. Mrs Arbuthnot konnte nicht so weit laufen, also ging Mrs Post für sie und brachte fast jedes Mal das falsche Buch mit: Sie verwechselte Elizabeth Bowen mit Marjorie Bowen und konnte sich nie merken, dass es zwei Mannings, zwei Durrells und mehrere Flemings gab. »Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben«, dankte ihr Mrs Arbuthnot dann und legte das Buch beiseite.
Mrs Palfreys Herz schlug ein wenig höher, als Mrs Arbuthnot – deren übliche Sklavin erkältet war – sie bat, ein Buch für sie zurückzugeben und ihr ein neues mitzubringen. Es war, als wäre sie wieder in der Schule und würde von der Schulsprecherin gebeten, etwas für sie zu erledigen. Sie hatte bloß einen ihrer ziellosen Spaziergänge machen wollen, um den Nachmittag zu verkürzen, und freute sich nun, einen richtigen Anlass dafür zu haben.
»Irgendetwas von Lord Snow vielleicht«, sagte Mrs Arbuthnot. »Ich ertrage keinen Schund.«
»Aber wenn Sie es schon gelesen haben …«, setzte Mrs Palfrey nervös an.
»Ein gutes Buch kann man ruhig zweimal lesen«, gab Mrs Arbuthnot spitz zurück. »Vielmehr sollte man ein gutes Buch sogar zweimal lesen.«
Mrs Palfrey nahm die Zurechtweisung einigermaßen gefasst hin. Schließlich war Mrs Arbuthnot diejenige, die ihr einen Gefallen tat. Sie brach auf, entschlossen, einen solchen Schatz mitzubringen – den allerneuesten Snow vielleicht –, dass Mrs Post ihre Aufgabe für immer los wäre. Sie wusste, dass sie sich, indem sie so dachte, wie ihre frühere Freundin Lilian benahm, ließ sich aber nicht beirren. (Lilian wäre trotzig gewesen.) Das Claremont war im Grunde wie eine eingeschränkte und ausgetrocknete Schulwelt. Zwar war das Essen besser; allerdings wäre es sonst für Erwachsene auch ungenießbar gewesen.
Es dämmerte schon, als Mrs Palfrey, triumphierend den neuesten Snow in der Hand, aus der Leihbücherei kam und den Rückweg antrat, von einer ruhigen, inzwischen vertrauten Straße zur anderen. Nieselregen trübte die Lichter und verschlammte die Bürgersteige. Sie war müde und ging langsam dicht an den Grundstückszäunen entlang. Einige Souterrainfenster waren erleuchtet und manche Vorhänge noch nicht zugezogen, sodass sie – auch wenn sie sich ein wenig dafür schämte – in die Zimmer hineinschauen konnte: hier eine triste Küche, dort ein gemütliches Wohnzimmer mit aufgelegter Tischdecke und einem Vogel im Käfig.
Wie entsetzlich die Venen in ihrem Bein schmerzten; jeder Schritt tat ihr weh. Doch den Nachmittag hatte sie gut genutzt, und nun konnte sie sich bald hinsetzen, einen langen Abend nur noch dasitzen und ausruhen. Den ganzen Tag hätte sie so nicht verbringen können. Durch den Spaziergang war sie aus sich heraus und aus dem Haus gekommen.
Plötzlich – sie konnte sich später nicht mehr erinnern, wie; ob ihr Fuß umgeknickt oder ob sie auf dem glitschigen Boden ausgerutscht war – stolperte sie, versuchte, sich zu halten, und fiel mit dem grässlichen Geräusch eines schweren, älteren Menschen hin.
Zuerst empfand sie nur Scham. Sie bot all ihre Kraft auf, um sich zu berappeln, ihre Würde wiederzuerlangen, obwohl die Straße leer war; keine Passanten in der Nähe, die sie dort hätten liegen sehen können. Sie war ganz außer sich – außer Atem – und voller Angst. Jeder Herzschlag mochte ihr letzter sein. Sie zog sich an den Zaunpfählen hoch, lehnte dort und versuchte, sich zu beruhigen. Ich werde nie nach Hause kommen, dachte sie, und vor Schreck und Bestürzung war sie den Tränen nah.
Nur undeutlich nahm sie wahr, dass sich auf dem Grundstück jenseits des Zauns eine Tür öffnete. Licht strömte über die nassen Steine, die Farne und eine Mülltonne, und ein junger Mann kam eilig die Treppe herauf. Er nahm sie in die Arme und drückte sie an sich, wie ein Liebhaber und ohne ein Wort, und eine wunderbare Ergebenheit breitete sich über ihren Schmerz, und sie überließ sich ihm mit williger Dankbarkeit.
Sie spürte Blut an ihrem Bein hinunterrinnen, wagte aber nicht hinzuschauen.
Nach einer Weile lehnte der junge Mann sie an den Zaun, um ihre Handtasche, das Buch aus der Leihbücherei und ihren Spazierstock vom Boden aufzuheben; dann legte er ihr den Arm um die Schultern – sie war größer als er – und half ihr langsam die Stufen hinunter. Sie ging mit, ohne zu protestieren, denn ihr blieb ja nichts anderes übrig, und sie war froh, von der Straße weggebracht und nicht womöglich am Zaun zusammengesackt, ganz aufgelöst und durcheinander von irgendwem gesehen zu werden. Wenn er ihr ein Glas Wasser geben würde, könnte sie eine ihrer Pillen aus der Handtasche nehmen, sich sammeln und einen Plan fassen.
»Entschuldigen Sie!«, keuchte sie, als sie sich drinnen hingesetzt hatte. Ihre Lippen, ihr ganzes Gesicht fühlten sich taub und blutleer an.
»Sprechen Sie lieber noch nicht«, sagte er. Er ging weg und kam mit einer Tasse Wasser wieder, und es war, als wären keine Worte nötig. Sie zeigte auf ihre Handtasche, und er brachte sie ihr, öffnete sie und hielt sie, vor ihr kniend, für sie auf. Als er ihren zerrissenen Strumpf und das blutende Bein sah, ging er erneut weg und kam mit einer Schüssel warmen Wassers und einem schmutzigen Handtuch zurück. Beim Anblick des Handtuchs erschrak sie, doch dieser Schreck kam zu kurz nach dem anderen, um ihr viel auszumachen, und so ergab sie sich. Sie war jetzt ganz in den Händen des jungen Mannes und unterwarf sich ihm gern. Deshalb fand sie es auch gar nicht empörend, als er den Gummibund ihrer Unterhose über dem Strumpfband anhob und den Strumpf löste. Überaus sanft säuberte er ihr das Knie und betupfte es mit dem schmutzigen Handtuch. Sie spürte keinen Schmerz. Ihr Knie schien nicht zu ihr zu gehören. Er nahm ein Taschentuch aus einer Schublade und band es ihr ums Knie, zog den zerrissenen Strumpf wieder hoch, hockte sich dann hin und sah lächelnd zu ihr hoch.
»Ich könnte Ihnen eine Tasse Tee machen«, sagte er.
»Ich kann Ihnen unmöglich so viel Mühe bereiten.«
Er schien darüber nachzudenken und sagte dann: »Viel Mühe wäre es nicht.«
»Sie waren so liebenswürdig.«
»Ja, ich mache Tee«, sagte er, plötzlich entschlossen. »Ich heiße übrigens Ludo. Ludovic Myers. Unglaublich, finden Sie nicht?«
»Und ich heiße Palfrey – Laura Palfrey«, sagte sie; sie fühlte sich schon um einiges besser.
»Dann haben wir ja beide lächerliche Namen«, sagte er und stand auf, um den Kessel zu füllen.
Noch nie im Leben hatte sie Laura Palfrey für einen lächerlichen Namen gehalten, und doch war sie kein bisschen verärgert. Sie lächelte sogar.
»Wie weit haben Sie es noch?«, fragte er.
»Bis zur Cromwell Road, dem Claremont Hotel. Kennen Sie es?«
»Nein.« Der Gedanke, er könnte das Claremont Hotel kennen, schien ihn zu belustigen. »Ich kann Ihnen ein Taxi rufen, wenn Sie möchten«, sagte er. »Es dürfte von hier aus nicht allzu viel kosten.«
»Da wäre ich Ihnen sehr dankbar«, sagte sie; sie fühlte sich erschöpft.
Erst jetzt war sie in der Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen – ein nackter Tisch mit Büchern, ein auf kleiner Flamme brennender Gasofen, ein an der Rückseite der Tür hängender dunkler Anzug. Die Vorhänge vor dem Fenster trafen nicht genau aufeinander und wurden von zwei großen Sicherheitsnadeln zusammengehalten.
»Es ist ein Glück, dass ich zu Hause war«, sagte der junge Mann – Ludo. »Ich war eben von der Arbeit zurückgekommen. Zog gerade die Vorhänge zu.«
»Wo arbeiten Sie denn?«, fragte sie, bemüht darum, Konversation zu machen.
»Bei Harrods.«
Auf der Gaskochstelle begann der Kessel zu pfeifen, und Ludo holte einen Zinnbecher hervor, mit einem Union Jack darauf. Die jungen Leute heutzutage hatten eine Leidenschaft für den Union Jack, stellte Mrs Palfrey immer wieder voller Erstaunen fest. All die Mädchen mit den langen Haaren und langen Röcken schienen Union-Jack-Tragetaschen zu haben. Sie fragte sich, ob das angemessen war – selbst wenn sie es vielleicht ernst meinten.
»In welcher Abteilung von Harrods denn?«, fragte sie.
»Nein, nein, ich arbeite nicht für Harrods, sondern bei Harrods. In der Kassenhalle. Ich nehme mein Schreibzeug und ein paar Sandwiches mit. Es ist schön warm dort, und die Sessel sind so gemütlich. Außerdem muss ich dann diesen Gasofen nicht anzünden, der ein Geldfresser ist. Milch?« Er hielt eine Flasche hoch, und sie nickte. Die Flasche war halb voll und hatte geronnene Ablagerungen am Hals.
»Sind Sie Schriftsteller?«, fragte sie.
»Na ja, ich versuche zur Zeit, einer zu sein, auch wenn ich durchaus schon andere Jobs gehabt habe.« Höflich, aber auch widerstrebend, wie sie merkte, drehte er das Feuer höher und blickte, die Hände um seinen Becher gelegt, in die Flammen. Was für Wimpern!, dachte Mrs Palfrey – sie warfen lange Schatten auf seine Wangenknochen, und als er sich zu ihr wandte und sie anlächelte, kam ihr seine Miene spitzbübisch vor, sein Lächeln etwas spöttisch; seine Augen verengten sich, als er sie so musterte, fast als wäre ihm gerade ein Streich eingefallen, den er ihr spielen könnte. Der Ausdruck »diebische Freude« kam ihr in den Sinn. Ja, er hatte etwas Diebisches an sich, und sie registrierte es zugleich fasziniert und beklommen.
»Ich halte Sie vom Schreiben ab«, sagte sie und stellte ihren Becher auf den Tisch. Ihr Knie begann zu schmerzen, und sie machte sich nun doch Sorgen wegen des schmutzigen Handtuchs.
»Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Das habe ich Ihnen doch erzählt, Mrs Palfrey, Ma’am«, sagte er. »Jetzt werde ich nur noch ein bisschen lesen und mir eine Dose Irgendwas aufmachen.«
Anscheinend war er so knapp bei Kasse und so hungrig, wie sie es sich von ihrem Enkelsohn ersehnt hatte.
»Sie waren so freundlich zu mir«, sagte sie. »Aber ich denke, ich sollte mich jetzt auf den Weg machen.« Steif bewegte sie ihr Bein.
»Dann laufe ich schnell um die Ecke und pfeife ein Taxi heran.«
Er trank seinen Becher aus und verschwand. Sie hörte ihn die Stufen hinauf und den Weg vor dem Haus entlangrennen. Seine leiser werdenden Schritte noch im Ohr, lehnte sie sich zurück, dachte an ihr Abenteuer zurück und stellte sich dann vor, wie er, nachdem sie gegangen wäre, das Feuer herunterdrehen und sich eine Dose Irgendwas aufmachen würde.
Nicht viel später hörte sie draußen das Taxi vorfahren und Ludo die Treppe herunterkommen. Sie hatte sich ihre Worte schon zurechtgelegt. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einmal im Claremont mit mir zu Abend essen würden. Ich möchte Ihnen Ihre Freundlichkeit gern auf irgendeine Weise vergelten.«
Der Vorschlag schien ihn einigermaßen zu erstaunen, ja zu erschrecken; dann kehrte der Ausdruck von diebischer Freude in seine Augen zurück.
»Das wäre ganz großartig«, sagte er.
»Würde es Ihnen am Samstag passen? Samstags ist das Essen meist um einiges besser.«
»Samstag wäre wunderbar.«
Er half ihr die Stufen hinauf und setzte sie ins Taxi, und als es abgefahren war, ging er in sein Zimmer zurück und schrieb, über den Tisch gebeugt, in sein Notizbuch: »flauschige graue Unterhosen … Gummiband … traubenfarbene Venen am Bein … Geruch nach Lavendelwasser (irg!) … große Flecken auf glänzenden Handrücken und auch da Venen – waagerechte Falten auf den Händen.«
Dann drehte er das Feuer herunter und machte sich eine Dose Spaghetti auf.
Mrs Palfrey gelangte zum Fahrstuhl, ohne jemandem zu begegnen. Sie fühlte sich elend und schwach. In ihrem Zimmer zog sie das Taschentuch von ihrem Knie ab und besah sich zum ersten Mal den Schaden. Sie brauchte lange, um sich in Ordnung zu bringen. Ihr Bein pochte und begann, steif zu werden.
Als sie schließlich in den Aufenthaltsraum kam, hatte Mrs Burton bereits die Glocke geläutet, und Mrs Arbuthnot wartete ungeduldig auf ihr Buch aus der Leihbücherei.
»Ich dachte schon, Sie wären verlorengegangen«, sagte sie.
»Ich bin leider auf dem Rückweg gestürzt und musste mein Bein säubern.«
»Es sieht so aus, als wäre mein Buch ebenfalls gestürzt.«
»Verzeihen Sie. Ich habe es fallen lassen. Aber ich habe versucht, den Schmutz abzuwischen.«
»Nun, es war trotzdem sehr freundlich von Ihnen. Sind Sie denn jetzt wiederhergestellt?« Mrs Arbuthnot fragte es beiläufig, während sie in dem Buch zu blättern begann.
»Nur ein wenig steif. Ich denke, ich werde mir dennoch ein Glas Sherry vor dem Essen genehmigen.«
Sie humpelte zur Bar, und für Mrs Arbuthnot sah es aus, als ginge sie zu ihrer selbstgewählten Verdammnis.
Als er die Spaghetti aufgegessen hatte, nahm Ludo seinen Anzug von der Rückseite der Tür und machte sich auf den Weg zum Waschsalon. Dort angekommen, setzte er sich und beschrieb in dem harschen Licht einen jungen Mann, der abends allein im Waschsalon sitzt. Manchmal blickte er finster zu seinem Anzug, der sich in der Trockenreinigungsmaschine langsam im Kreis drehte, sodass es schien, als ob sie ihn zu verdauen versuchte und, wäre es möglich gewesen, wieder ausgespuckt hätte.