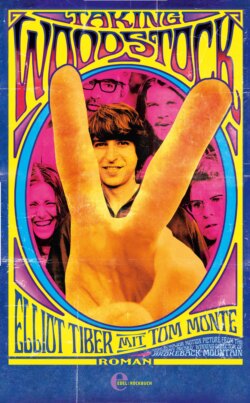Читать книгу Taking Woodstock - Elliot Tiber - Страница 8
2. Der Teichberg-Fluch
ОглавлениеIch wurde in Bensonhurst geboren, einem Teil von Brooklyn, New York, der hauptsächlich für Rassismus und die Mafia bekannt war – denn zumindest während meiner Zeit dort wohnten in Bensonhurst überwiegend schuldgeplagte Italiener und Juden. Eine Menge berühmter Leute aus beiden Bevölkerungsgruppen kamen aus diesem Umfeld, darunter Danny DeVito, Elliott Gould, Larry King und die Three Stooges. Verglichen mit ihnen waren wir Teichbergs die Six Stooges – also doppelt so verrückt. Meine Mutter war tatsächlich in einem Treck durch das verschneite Russland geflüchtet und 1912 in New York gelandet; die Eltern meines Vaters waren schon zehn Jahre vor meiner Mutter aus Österreich in die Stadt gekommen. Sie ließen sich in Borough Park nieder, wo mein Großvater einen Dachdeckerbetrieb gründete. Mein Vater hatte bereits als Junge in Salzburg im Betrieb meines Großvaters gearbeitet. Als er dann alt genug war, in der neuen Heimat selbst einen Beruf zu wählen, war Pops Laufbahn schon so gut wie in Teer vorgezeichnet. Aber nicht alle seine Entscheidungen waren eine direkte Nachahmung seiner Eltern. Als sich mein Vater und meine Mutter kennenlernten, gab meine Großmutter – die nicht gerade für ihre Feinsinnigkeit bekannt war – meinem Vater einen weisen Rat. Ziemlich frei aus dem Jiddischen übersetzt, sagte sie zu ihm: »Sieh zu, dass du diese dumme russische Schlampe loswirst.« Als jemand, der einen guten Rat nicht zu würdigen weiß, heiratete er sie stattdessen.
Wie so viele Immigranten misstrauten auch meine Eltern den Banken und stopften ihr Geld lieber in die Matratze. Als die Depression kam und die Banken zusammenbrachen, konnten sie über ein paar Tausend Dollar verfügen – genug, um in der 73. Straße ein dreistöckiges Haus mit vier Zimmern und einem Bad zu kaufen. Außerdem erwarben sie ein vierstöckiges Haus ohne Fahrstuhl an der Ecke 70. Straße und Twentieth Avenue. Im Erdgeschoss dieses Hauses eröffneten sie einen Eisen- und Haushaltswarenladen, in dem die Gier meiner Mutter zum ersten Mal ihr gigantisches giftgrünes Haupt erhob.
Im Geschäft meiner Eltern gab es keine Preisschilder an den Artikeln – eine flexible Strategie, die es meiner Mutter erlaubte, die Preise entsprechend ihrer Einschätzung dessen zu veranschlagen, was die jeweilige Person zahlen konnte. Manchmal fragte ein Kunde quer durch den Laden nach dem Preis eines Artikels. Dann raste meine Mutter zu ihm hin, nutzte ihre übernatürliche Gabe, augenblicklich seinen finanziellen Status zu ermitteln, und nannte ihm einen Preis. »Für dich, Schätzchen, neunzehn Dollar und neunundneunzig Cent und keinen Penny mehr! Sonderpreis, weil ich heute sehr großzügig gestimmt bin.« Mamas Laden war die Urform der TV-Sendung Glücksrad.
Jeden Abend um sechs Uhr – außer samstags, dem einzigen Tag, an dem der Laden geschlossen war – fuhr meine Mutter mit ihrem Fahrrad nach Hause in die 73. Straße. Wenn sie die Straße hinuntergefahren kam, sah sie wie ein kleiner Football-Verteidiger aus, der auf einem durchgebogenen Rahmen und fast platten Reifen wie wild in die Pedale tritt. Man konnte die Zahlenkolonnen in ihrem Kopf förmlich sehen, während sie die Tageseinnahmen ausrechnete.
Zu Hause machte sich Mama sofort an die Zubereitung des Abendessens. Es dauerte nicht lange, bis Dampf und übel riechender Dunst die Luft erfüllten; im Zentrum der aufsteigenden Schwaden waren die vagen Umrisse der zylindrischen Statur meiner Mutter zu erkennen. Ihre Spezialität war Fett – gewürzt mit Knoblauch. In dem Fett waren ein paar Krümel Fleisch und Gemüse versteckt, aber der Hauptbestandteil war immer eine klumpige Pampe, die sie mit mütterlichem Stolz und kaum verhohlenem Grimm – um mögliche Kritiker abzuschrecken – auf die Teller schaufelte.
Meine zwölf Jahre ältere Schwester Goldie verschlang das Essen meiner Mutter genauso wie ich – auch ein Grund dafür, dass wir beide übergewichtig waren. Es ist erstaunlich, wie gut Fett schmecken kann, wenn man keinen Vergleich hat. Meine anderen beiden Schwestern – Rachelle, neun Jahre älter, und Renee, vier Jahre jünger als ich – pickten nur am Tellerrand herum, als handle es sich um eine Art Giftmüll. Folglich blieben sie beide immer dünn. Das Einzige, was uns vor Mamas gefährlichem Essen rettete, war der Vorrat an Schokoriegeln, Bonbons und Donuts, den wir alle in unseren Zimmern gebunkert hatten. Aber die Süßigkeiten – gekauft von meinem Vater, der eine Schwäche für Süßes hatte – dienten auch als Selbstmedikation gegen die scharfe Zunge meiner Mutter.
»Du bist fett und dumm, Eliyahu«, sagte sie regelmäßig zu mir und nannte mich bei meinem richtigen hebräischen Namen, um sicherzugehen, dass ich ihr auch zuhörte.
»Dumm, hast du gehört? Was soll bloß aus deiner armen Mutter werden?«, jammerte sie. »Wie werde ich es nur mit dir aushalten? Warum sollte ich es überhaupt mit dir aushalten? Du wirst mich noch umbringen, hörst du?« An diesem Punkt ergriff ich regelmäßig die Flucht und rannte nach oben in mein Zimmer, um mich meinem Vorrat an Donuts und Schokoriegeln zu widmen.
Nach dem Abendessen kehrten meine Mutter und mein Vater in den Laden zurück und arbeiteten bis elf Uhr, wenn schon lange kein Mensch mehr auf der Straße war. Später, als Jugendlicher, ging ich dann mit ihnen zurück in den Laden und arbeitete manchmal bis Mitternacht. Wenn ich nicht im Laden stand, half ich meinem Vater in seinem Dachdeckerbetrieb. Meine Eltern gaben mir nie einen Cent für meine Arbeit. So wuchs ich in dem Glauben auf, dies sei mein Schicksal.
Der durchschnittliche Arbeitstag meines Vaters hatte zwischen zwölf und sechzehn Stunden. Nachdem er den ganzen Tag lang Dächer mit Teerpappe gedeckt hatte, ging er nach Hause, aß zu Abend, machte ein kurzes Nickerchen – wenn er Glück hatte – und machte sich dann in den Eisen- und Haushaltswarenzirkus auf. Dort kümmerte er sich um alles, was anfiel, reparierte Bügeleisen und Toaster und bearbeitete Schlüssel hinter einer überladenen Theke, die genauso aussah wie später die im El Monaco Motel.
Mein Vater – ein einfacher und bescheidener Mann – bewältigte sein Leben, indem er ihm so oft wie möglich entfloh. Er hörte Radio, vornübergebeugt und äußerst konzentriert, als komme die Stimme Gottes aus diesem Kasten, rauchte Kette und hielt so oft wie möglich ein Schläfchen – immer so lange, bis meine Mutter verlangte, er solle mich für irgendwas bestrafen. Ihre schrille Stimme durchschnitt sein lautes Schnarchen wie eine Kreissäge einen dicken Holzklotz.
»Jaaaaaaaack!«, kreischte sie. »Komm sofort runter. Vielleicht benehmen sie sich in deiner Gegenwart!« Wenn mein Vater dann die Treppe hinunterstürmte, löste er unterwegs schon seinen Gürtel. Er hatte die Statur und Kraft eines Mannes, der sein ganzes Leben mit den Händen gearbeitet hat; wenn er einen schlug, vibrierte man meist noch ein bis zwei Stunden danach.
Nachdem ich windelweich geschlagen worden war und mir die Seele aus dem Leib geschrien hatte, wurde ich ohne Abendessen in mein Zimmer geschickt – was eigentlich gar nicht so schlimm war, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber später, bevor sie wieder in den Laden ging, schmuggelte Mama trotzdem etwas Essen hinauf zu mir. Sie setzte sich auf die Bettkante, während ich aß, und ließ mich versprechen – flüsternd, damit mein Vater uns nicht hörte –, dass ich für den Rest meines Lebens ein braver Junge sein würde.
Das war das Äußerste, was ich je an Mutterliebe erfuhr: jene vertraulichen Augenblicke nach der Bestrafung. Die Striemen auf meinem Körper waren noch frisch, wenn sie mir ihren Eintopf brachte. Damit schaffte sie es, meine Schuld auf eine Weise zu verdoppeln, wie wirklich nur sie es konnte. Einerseits machte sie klar, dass ich ihr Unrecht getan hatte – ein schweres Verbrechen gegen die Natur und gegen Gott; andererseits verwickelte sie mich in eine bizarre Verschwörung gegen meinen Vater. Er hatte mich bestraft – auf ihr Geheiß hin, wohlgemerkt –, aber jetzt waren Mama und ich Freunde und Pop war der Außenseiter, der Böse. Er wurde von unserem vertraulichen Moment ausgeschlossen. Tief in mir drin wusste ich, dass hier etwas nicht stimmte, und war mir einer vagen Schuld sogar bewusst. Aber was sollte ich tun? Ich war doch nur ein kleines Kind, hungrig nach Liebe und Essen – und in unserem Haus schmeckte keins von beidem gut.
Die übersinnlichen Kräfte meiner Mutter beschränkten sich nicht nur darauf, die Geldsumme eines Kunden in seiner Brieftasche zu erahnen, sie erhielt auch regelmäßig Botschaften von den Toten – oder zumindest von einem Toten, ihrem Vater, dem Rabbi. Als ich vier Jahre alt war, bekam meine Mutter die telepathische Anweisung von ihm, mich in die Jeschiwa, die Talmudschule, zu schicken. Der Rabbi erklärte, es sei meine Bestimmung, ebenfalls Rabbi zu werden, damit ich meiner leidgeprüften Mutter nochas (Jiddisch für »Freude«) schenken könne. Und so steckte man mich im zarten Alter von vier Jahren – sie musste wegen meines Alters lügen, um mich überhaupt in die Schule zu bekommen – in die Jeschiwa.
Es war die Hölle auf Erden – acht Stunden täglich eine alte Sprache und Talmudgesetze über Kühe lernen, die sich in deinen Vorgarten verirren. Natürlich waren herumirrende Kühe nicht wirklich ein Problem in Brooklyn, aber trotzdem musste ich wissen, was zu tun war, falls sich tatsächlich mal eine verirrte. Alles war von Angst durchsetzt – Angst vor Mose und seinen unzähligen Gesetzen, die man unwillkürlich brechen musste, und Angst vor diesem »eifersüchtigen« und »rachsüchtigen« Gott, der regelmäßig stinksauer war und Plagen über fette kleine Jeschiwa-Schüler schickte, die Seine Existenz anzweifelten. Im Alter von fünf Jahren verkündete ich, und zwar sehr zum Leidwesen der Rabbis, die mich unterrichteten, ich sei Atheist.
Aber Mose lachte zuletzt, denn die Jeschiwa erwies sich auch in sozialer Hinsicht als Albtraum. Statt dafür zu sorgen, dass ich mich als Teil von etwas fühlte, das größer war als ich selbst, verstärkte die Schule nur meine Isolation. Schließlich war ich aus meiner Nachbarschaft herausgerissen und in eine private jüdische Institution gesteckt worden, deren reiche Schüler morgens von ihren Eltern im Cadillac gebracht wurden, während mich mein Vater mit seinem grünen Ford Pick-up vor der Schule ablieferte. Natürlich wurde ich gehänselt, weil ich fett, hässlich und arm war – und auch dafür, dass mein Vater immer mit Teer beschmiert erschien, wenn er mich nach dem Unterricht abholte.
Zu Hause war es auch nicht besser. Da ich keine öffentliche Schule besuchte, hatte ich auch keine Verbindung zu den Kindern aus der Nachbarschaft, von denen mich manche auslachten, weil ich in die Jeschiwa ging. Zu allem Übel mochte ich auch noch klassische Musik, womit ich vom Rest meiner Generation vollkommen abwich. Ich war ein »Nerd«, noch bevor das Wort überhaupt existierte.
Meine einzigen Ventile waren Zeichnen und Malen, und ironischerweise bot mir der Eisenwarenladen viele Möglichkeiten, mich in beidem zu betätigen. Hier konnte ich dekorative Auslagen gestalten. Ich räumte die Fenster aus und arrangierte die Artikel in einem ansprechenden Aufbau, malte wilde Hintergründe oder witzige Schilder und baute manchmal auch Figuren aus Pappmaschee. Als ich Mama fragte, ob ich ein paar Luftballons und etwas Krepppapier kaufen dürfe, um meine Arrangements zu krönen, erinnerte sie mich (wieder einmal) an den langen Marsch durch den sechs Meter hohen Schnee in Russland, immer die Soldaten des Zaren im Nacken. »Sehe ich etwa aus wie die Zarin, Eliyahu?«
Nachdem die Luftballons abgelehnt wurden, malte ich Wandbilder und lustige Cartoons in leuchtendem Pink, um dem Schaufenster ein wenig Humor und Stil zu verleihen. Wenn ich malte und Schaufenster gestaltete, konnte ich dem Wahnsinn und der Isolation meines eigenen Lebens in eine Welt entfliehen, die schön, harmonisch und geordnet war. Gewöhnliche Alltagsgegenstände – Töpfe und Pfannen, Lampen und Werkzeuggürtel – verwandelten sich in Bestandteile von Kunstwerken. Objekte, die keine offensichtliche Beziehung zueinander hatten, schienen plötzlich irgendwie miteinander verbunden zu sein und ergaben einen ganz neuen Sinn, wenn man sie in der richtigen Art und Weise arrangierte
Sobald ein Fenster fertig war, bat ich meine Eltern, es sich anzusehen. Pop zuckte die Achseln; Mama, die ständig Verschwendung witterte, inspizierte die Materialien, um sicherzugehen, dass ich nichts Wichtiges aus dem Laden genommen hatte. »Ich will nicht, dass du Nägel verschwendest, Eliyahu. Hast du mich verstanden?« Ich sah sie immer nur dann lächeln, wenn die Tageseinnahmen gut waren.
Im Sommer besserte ich zusammen mit meinem Vater Dächer in Brooklyn aus. Ich schleppte Teerpappe und anderes Zubehör über hohe Leitern auf die Dächer, obwohl mir Leitern und Höhe eine Höllenangst machten. Verzweifelt klammerte ich mich an die Sprossen und versuchte, nicht nach unten zu sehen, wenn ich einen Eimer mit heißem Teer oder eine Rolle Teerpappe trug. Sobald ich auf dem Dach war, verteilten mein Vater und ich die Pappe und den flüssigen Teer und brutzelten dabei in der heißen Sonne. Wir bauten zwar nicht die Pyramiden, mir kam es aber trotzdem wie Sklavenarbeit vor.
Doch welch merkwürdige Bande werden zwischen Vater und Sohn geknüpft, wenn sie zusammen arbeiten, die meiste Zeit schweigend. Als ich meinen Vater in der Sonne und Hitze schuften sah, wollte ich es ihm gleichtun – nicht nur, um seinem Beispiel zu folgen, sondern auch, um seine Liebe zu gewinnen. Ich stellte mir vor, dass er etwas von dem spürte, was ich fühlte – dass wir uns nicht nur zu dem gemeinsamen Ziel vereint hatten, die Arbeit schnell und korrekt zu erledigen, sondern auch im Herzen zueinander gehörten. In unserem gemeinsamen Überlebenskampf gegen die täglichen Attacken meiner Mutter waren wir Kameraden.
Dass ich als Dachdecker arbeitete, ließ mich in den Augen der wenigen Freunde, die ich in der Nachbarschaft hatte, natürlich noch seltsamer erscheinen. Sie verbrachten zumindest einen Teil des Sommers in den Catskills und kamen mit Geschichten vom Angeln, Schwimmen und Wandern in den Wäldern zurück. Wenn sie mich fragten, was ich den Sommer über gemacht hatte, sah ich auf meine schwarzen Hände und sagte: »Oh, nichts Besonderes. Ich habe mit meinem Vater gearbeitet.« Bis zum heutigen Tag liebe ich den Geruch von frischem Teer.
Da ich schon mit vier Jahren ins erste Schuljahr kam, konnte ich mit sechzehn aufs College gehen. Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, das Pratt College zu besuchen, eine Kunst- und Designschule in New York. Das Schulgeld betrug fünfhundert Dollar, die ich von meiner Bar-Mizwa gespart hatte und nur allzu gern bezahlen wollte, um der 73. Straße zu entkommen. Aber das Schicksal – also meine Mutter – hatte andere Pläne. Meine Schwester Goldie wollte heiraten, also mussten Geschenke gemacht werden. Eine grüngelbe, nierenförmige Couchgarnitur, damals der letzte Schrei, kostete um die zweihundert Dollar. Sie musste eine Verlobungsfeier geben, die noch mal zweihundert Dollar kostete, und brauchte natürlich ein Brautkleid für weitere hundert Dollar.
»Ich werde mir die fünfhundert Dollar von dir leihen, Eliyahu«, verriet mir meine Mutter.
»Hab ich eine Wahl?«, fragte ich kraftlos.
»Was ist los mit dir, vertraust du deiner Mutter nicht? Was für ein Sohn bist du bloß? Ich bin durch den russischen Schnee gelaufen, die Soldaten des Zaren auf den Fersen, die mich in Stücke schneiden wollten. Alles nur, damit ich dich zur Welt bringen konnte! Und du willst deiner Mutter die ein zige Freude in ihrem Leben nehmen – ihrer Tochter die Hochzeit auszurichten!«
Das war’s – das Geld war weg. Ich konnte die Tränen nicht aufhalten, die mir in die Augen schossen und über die Wangen liefen. Die einzige Möglichkeit, aus Bensonhurst zu fliehen, wurde mir aus den kleinen Wurstfingern gerissen. »Zahlst du es mir wirklich zurück, Mom?«, fragte ich sie. »Ich brauch das Geld fürs College.«
»Jaaaaaaaack!«, schrie sie. »Komm runter. Dein Sohn bricht seiner Mutter das Herz!« Ich konnte hören, wie mein Vater seinen Gürtel abschnallte, als er die Treppe heruntergerannt kam.
Als der Zeitpunkt kam, meine fünfhundert Dollar Schulgeld an das Pratt College zu überweisen, verkündete Mama, sie könne mir das Geld nicht zurückzahlen, da sie es für die Hypothek brauche und meiner Schwester Rachelle ein paar neue Kleider kaufen müsse. »Wie soll denn Rachelle einen netten jüdischen Ehemann finden, wenn sie Goldies alte Kleider aus Küchengardinen trägt?«, fragte sie und ignorierte meine Tränen. Damit war mein Traum vom Pratt College geplatzt.
Zum Glück bot mir das Schicksal einen anderen Fluchtweg. Die Stadt und der Staat New York übernahmen die Kosten einer College-Ausbildung für Kinder bedürftiger Bürger. Zu dieser Zeit war das Hunter College – lange Zeit eine Mädchenschule – in finanziellen Schwierigkeiten. Um im Geschäft zu bleiben und sich für die notwendigen Subventionen der Stadt und des Bundesstaates zu qualifizieren, hatte die Verwaltung beschlossen, die Schülerzahl zu erhöhen und auch männliche Schüler mit schlechten Noten und ohne finanzielle Mittel aufzunehmen. Diese Anforderungen erfüllte ich perfekt.
Als Ausweichmöglichkeit war das Hunter allerdings nicht meine erste Wahl. Nach dem Pratt wäre ich lieber ans Brooklyn College gegangen, wo die Avantgarde der modernen Kunst unterrichtete, aber Brooklyn stellte hohe Anforderungen und nahm nur Kids mit guten Noten. Also entweder das Hunter College oder gar nichts. Nach meinem ersten Jahr waren meine Noten jedoch gut genug, um ans Brooklyn wechseln zu können, wo ich bei einigen der Meister der modernen Kunst studierte und mich sogar mit ihnen anfreundete – Mark Rothko, Ad Reinhardt, Jimmy Ernst und Kurt Seligman. Sie alle wurden schließlich zu Superstars in der Kunstwelt, aber als ich bei ihnen studierte, waren sie noch unbekannt und pleite.
Rothko, dessen Gemälde heute im Guggenheim, in der National Gallery of Art, dem Metropolitan Museum of Art, dem Museum of Modern Art und in der berühmten Londoner Tate Gallery hängen, wurde mein Mentor und Freund. In gewisser Weise adoptierte er mich als einen seiner Protegés; er arbeitete noch mit mir weiter, wenn die Kurse schon lange zu Ende waren. »Deine Tuschezeichnungen zeigen die Sensibilität eines wahren Künstlers«, sagte er eines Tages zu mir. »Ich werde dir die Sprache der Tinte und später die der Farben beibringen.«
Rothko war für seinen besonderen Umgang mit Farben bekannt, mit denen er seine eigenen elementaren Gefühle ausdrückte – Gefühle, die er auch bei denen hervorrufen wollte, die seine Bilder betrachteten. Die großen Wandbilder und abstrakten Formen brachten Bewunderer häufig zum Weinen. Viele behaupteten, beim Anblick seiner Arbeiten eine religiöse Erfahrung zu erleben, worauf Rothko meinte, dass jeder, der so empfand, seine eigenen Erfahrungen beim Malen teile.
Rothko widersetzte sich jedem Etikett, das ihm die Kunstwelt aufdrücken wollte, sei es »Kolorist« oder »abstrakter Künstler«. »Ich interessiere mich nicht für die Beziehung zwi schen Form und Farbe«, sagte er immer. »Mir geht es nur um den Ausdruck der elementaren Gefühle des Menschen – Tragödie, Ekstase und Bestimmung.«
Zu der Zeit, als wir befreundet waren, war er die meiste Zeit pleite. Ich teilte meine Zigaretten mit ihm und brachte ihm Sandwiches und gelegentlich eine Flasche Wein. Er hatte große runde Augen, gefühlvoll und traurig, und einen kleinen schwarzen Schnurrbart, weswegen er manchmal an den jungen Groucho Marx erinnerte. Eines Tages, nachdem wir zu Mittag gegessen hatten und rauchten, sagte er zu mir: »Vergiss deine russische Mutter. Ich bin auch Russe« – sein richtiger Name war Marcus Rothkowitz – »und weiß also, wovon ich rede. Vergiss alles, was sie dir je gesagt hat. Sie hat in allem unrecht. Zieh in dein eigenes Atelier. Sag ihr, sie soll selbst ein Rabbi werden, nicht du.«
Manchmal erlaubte er mir, in seinem Atelier herumzuhängen und ihm bei der Arbeit zuzusehen. Ich wurde Zeuge seines Kampfes um die passenden Formen und Farben, die seine verborgenen Leidenschaften und den existenziellen Schmerz, das Wesen seines Menschseins ausdrücken konnten. Es war offensichtlich, dass dieser Mann ein Genie war – und ich fühlte mich wirklich sehr geehrt, ihn zu meinen Freunden zu zählen.
»Du hast wahres künstlerisches Talent und die Seele eines Dichters«, sagte er eines Tages zu mir. Ich behielt diese Worte mein Leben lang in Erinnerung. Ich war ein Künstler – so viel wusste ich. Aber dass Mark Rothko meine Arbeit achtete und mich ermutigte, erschien mir wie ein Ritterschlag. Er hatte mich so tief in seine Welt und in die Welt der Kunst hineingezogen, dass ich wusste – wenn auch nur unbewusst – dass ich mich auf der Schwelle zu einer Art Initiation befand. Wie ein endloser Korridor, zu dem sich die Tür jetzt auf eine mysteri öse Art geöffnet hatte, rief mich die Kunst zu sich. Ich schaute diesen Korridor hinunter, sah dann Mark an und fragte mich, ob ich da nicht mein eigenes Schicksal vor mir hatte – arm wie eine Kirchenmaus, unbekannt und meinen dunklen Leidenschaften hilflos unterworfen.
Mark war nicht nur pleite, häufig war er auch verzweifelt und deprimiert. Schließlich beging er Selbstmord, indem er sich die Pulsadern aufschnitt. Andere Künstler, die ich kannte und bewunderte, wurden von der gleichen Armut und Dunkelheit geplagt. Ad Reinhardt, ein weiterer meiner Lehrer und Mentoren, war ein starker Trinker und chronisch depressiv. Ich erinnere mich an einen gemeinsamen Tag in seinem Atelier, an dem er sich die Augen aus dem Kopf weinte, weil er das Schwarz in einem seiner Bilder nicht intensiv genug hinbekam. Er war ein großer Mann und auch ein großer Künstler, aber die meiste Zeit war er ein entsetzliches Wrack. Und mit Kurt Seligman machte ich oft lange Spaziergänge, auf denen er über seine Geldnot und die Abgründe lamentierte, in die sein Leben geraten war. Er wirkte todunglücklich.
Diese Männer waren Hohepriester, die ihr Leben gaben, um dem einzigen Gott zu dienen, den sie kannten und anbeteten – die Kunst. Ihre Belohnung bestand darin, große Werke zu schaffen, die zu der Zeit, als ich sie kannte, noch weitgehend unbeachtet blieben und nicht gewürdigt wurden. Sie mussten einen unfassbar hohen Preis zahlen, um solche Kunst zu schaffen – sie opferten jede Chance auf ein normales Glück und Liebe. Zweifellos war ihre Seelenqual auch eine der Antriebsfedern ihrer Kunst, aber die Intensität ihrer Leidenschaft, ihr Schmerz und ihre Armut erschreckten mich. Da ich sie aus unmittelbarer Nähe miterlebte, war ich gezwungen, die einzig wichtige Frage zu beantworten, die sich jedem jungen Künstler stellt: Bin ich bereit, alles, was ich habe, und alles, was ich bin, in den Dienst der Kunst zu stellen, und zwar ohne eine Garantie von Belohnung und Anerkennung? Für mich wurde die Antwort auf diese Frage noch durch die Tatsache kompliziert, dass ich diesen Männern vom Temperament her sehr ähnlich war. Meine geistige Gesundheit hing an einem seidenen Faden. Und wie sie war auch ich von Dämonen geplagt. Man braucht sich nur anzusehen, wo ich herkam! Wenn ich mich in den langen dunklen Korridor der Kunst hineinlocken ließ, würde ich ebenso unglücklich werden wie sie. Und dazu waren sie auch noch völlig pleite.
Nein, sagte ich mir, ich muss an den wenigen kostbaren Tassen, die ich noch im Schrank habe, festhalten. Außerdem brauche ich ein Einkommen, das sicherer und verlässlicher ist. Ich kann nicht so leben wie sie – arm und unglücklich. In diesem Zustand hatte ich schon meine gesamte Kindheit verbracht, also musste ich all dem entkommen.
In meinem Abschlussjahr wechselte ich wieder zum Hunter College, weil ich erfahren hatte, dass sich ein Abschluss am Hunter auf einer Bewerbung besser auswirkte als einer vom Brooklyn College. Bevor ich es verließ, schenkte mir Mark Rothko fünf Tuschezeichnungen von sich. Es war ein Geschenk, das von Herzen kam, und ich war außer mir vor Freude. Ich packte die Zeichnungen sorgfältig ein und brachte sie zur sicheren Aufbewahrung nach Hause in mein Zimmer.
Jahre später war Rothko natürlich weltweit anerkannt und seine Arbeiten wurden für ein Vermögen verkauft. Eines seiner größten Meisterwerke, »Homage to Matisse«, erzielte einen Preis von 2,2 Millionen Dollar – damals in den Vereinigten Staaten eine Rekordsumme für ein Bild, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden war.
Einige Jahre nachdem mir Rothko seine Tuschezeichnungen geschenkt hatte, ging ich in mein Zimmer, um sie heraus zuholen. Sie waren weg. Verzweifelt fragte ich meine Mutter nach den verschwundenen Bildern. »Oh«, sagte sie, »ich hab sie zusammen mit all dem anderen wertlosen Zeug, das in deinem Zimmer rumlag, weggeworfen.«
Da sie den emotionalen Wert eines Bildes nie begreifen konnte, erklärte ich ihr meinen Verlust mit dem einzigen Argument, das sie verstand: »Diese Blätter waren über fünfzigtausend Dollar wert, Mama.«
»Lüg mich nicht an«, erwiderte sie scharf. »Das Zeug war überhaupt nichts wert – nur das verrückte Geschmiere von irgendwem.«
Ich war außer mir vor Wut, doch ich wusste, dass ich nichts tun konnte: Meine Mutter war blind für die Standpunkte anderer und sah immer nur ihren eigenen. Zurück in meinem Zimmer, stopfte ich mich bis zum Anschlag voll mit Hershey-Schokoriegeln. Milton Hershey war mein Schutzpatron.
Ich machte den Abschluss in Bildender Kunst, Angewandter Kunst und Design am Hunter College mit Auszeichnung. In meinem ersten Job arbeitete ich als Auslagengestalter und Dekorateur im schicken W. & J. Sloane auf der Fifth Avenue in Manhattan, wo ausschließlich edle Möbel an Gutbetuchte verkauft wurden. Wer aber wusste schon, was edle Möbel waren? Ich nicht. Außerdem hätte ich mir nie träumen lassen, dass meine Mappe mit der eines Pratt-Absolventen konkurrieren konnte. Also war ich mehr als verblüfft, als mir Walter Bahno, der Direktor der Dekorationsabteilung von Sloane’s, diesen Job anbot.
In meiner Freizeit malte ich Wandbilder in einigen der teuersten Wohnungen von Manhattan. Meine Gemälde wurden in Galerien ausgestellt und verkauft. Endlich hatte mein Leben begonnen. Ich verdiente sehr gut. Aber vor allem war ich frei und fest entschlossen, alles zu entdecken und auszudrücken, was mich und meine Persönlichkeit ausmachte.
Doch die unerklärliche Verpflichtung, die ich meinen Eltern gegenüber empfand, erwies sich letztlich als stärker als mein Verlangen auszubrechen. Der Teichberg-Fluch war eine mächtige Kraft – vielleicht hatte ich aber auch nur zu viele Teerdämpfe eingeatmet.
Alles begann völlig harmlos. Im Sommer 1955, als ich noch auf dem College war, beschlossen meine Eltern, endlich einmal Ferien in den Catskills zu machen. So landete die ganze Familie in Pauline’s Rooming House in White Lake, New York, und wohnte dort in einer heißen, muffigen Mansarde. Doch wir liebten es alle. Es war, als seien wir im Paradies angekommen – was meine Mutter natürlich zum Nachdenken brachte. Verstohlen schaute sie sich in den zwanzig Zimmern von Paulines vollgestopfter Pension um, die samt und sonders vermietet waren, begann zu rechnen und hatte plötzlich eine Zukunftsvision. »Das ist mal ein Geschäft«, erklärte sie. »Wenn wir hier draußen ein Haus kaufen und den Eisenwarenladen aufgeben, könnten wir ein Vermögen machen und die ganze Zeit so leben!«
Mein Vater schien geradezu zum Leben zu erwachen, so sehr gefiel ihm diese Vorstellung. Im Eifer des Gefechts war sogar ich begeistert.
Ein Stück weiter auf derselben Straße stand eine alte, verfallene viktorianische Pension zum Verkauf. Das Haus drohte zusammenzubrechen, aber meine Mutter nannte es beshert (»Schicksal« – ein Zeichen von dem da oben). Wäre sie einmal um den Block gegangen, hätte sie festgestellt, dass fast der ganze Ort zum Verkauf stand – und der größte Teil davon für wesentlich weniger Geld. Aber leider tat sie das nicht und schließlich ist ein Zeichen ein Zeichen. Sie trennte sich von dem Eisen- und Haushaltswarenladen, kaufte die Pension und machte aus den fünf Zimmern des Hauses acht. Dann zog die ganze Familie nach White Lake und wartete darauf, dass die Saison anfing.
Im ersten Sommer war das Haus jeden Abend ausgebucht. Wir waren begeistert. Die Teichbergs waren auf eine Goldader gestoßen und glaubten, das Geld würde schon bald an den Bäumen wachsen. Das war der Augenblick, in dem Mamas giftgrüner Teufel ihr wieder etwas ins Ohr flüsterte: Warum nicht das Haus nebenan dazukaufen und aus dem Ganzen ein Motel machen? Schon bald hatten wir zwölf weitere Zimmer und bauten sogar noch ein zusätzliches Haus. Natürlich hatten meine Eltern keine Ahnung, was ein Motel war. Sie hatten auch keinen Geschäftsplan und wussten nur, wie man kauft und baut – zu einer Zeit, in der alle anderen Hausbesitzer nur noch verkaufen und abhauen wollten. In der folgenden Saison kauften sie eine Bungalowanlage mit einem Casino und erweiterten das Motel auf über fünfundzwanzig Zimmer und mehrere Cottages.
Wie jeder gute Geschäftsmann weiß, kann man zu schnell wachsen und zu weit gehen. Es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, aber meine Eltern befanden sich schon ungefähr zweihundert Meilen jenseits davon. Plötzlich ging nicht nur der Fremdenverkehr in White Lake so drastisch zurück, dass sie nicht mehr alle Zimmer vermieten konnten, die sie gekauft oder gebaut hatten, auch der Geldfluss reduzierte sich auf ein Rinnsal. Die Hypotheken waren von Monat zu Monat schwieriger zu bezahlen, ebenso wie die meisten anderen Rechnungen. Das Motel geriet immer tiefer in die Schulden. Zu allem Übel verfügten meine Eltern auch nicht über die notwendigen sozialen Fertigkeiten, um die wenigen Touristen anzuziehen, die trotz allem noch immer nach White Lake kamen.
Mein Vater war der Telefonist des Motels. Für gewöhnlich meldete er sich folgendermaßen: »Hallo? Was ist? Warum rufen Sie an? Was wollen Sie? Wenn Sie Kinder haben, kommen Sie nicht. Wir vermieten nicht an Kinder. Sie ruinieren die Matratzen und machen Lärm. Wenn Sie also Kinder haben sollten, haben wir nichts frei!«
Inzwischen hatte ich das College beendet und arbeitete in Manhattan. Mein Leben hatte endlich begonnen, und soweit es mich betraf, gab es keine Grenzen mehr. Doch während mir das Glück hold war, verließ es meine Eltern. Als sich abzeichnete, dass sie alles verlieren würden – ihre gesamten Ersparnisse, ihre einzige Einnahmequelle und die mikroskopisch kleinen Spuren von Vernunft, die sie noch besaßen – baten sie mich, das Motel für sie zu leiten.
Im Nachhinein kann ich mir den Moment deutlich vor Augen rufen, diese gar nicht so subtile Manipulation, die mich in ihren Albtraum hineinzog – mein Vater, der mich mit reuevoll hängenden Schultern und gesenktem Kopf um Hilfe bat; meine Mutter, die plötzlich dankbar meine instinktiven Fähigkeiten als Motelmanager entdeckte – wer hätte je gedacht, dass ich eine solche Gabe besaß? Und dann diese wenigen magischen Worte, die meine unterbewusste Programmierung in Gang setzten – die Schuldgefühle, die Mama jahrelang für einen Augenblick wie diesen kultiviert hatte: »Oy, was soll nur aus uns werden, wenn du uns nicht hilfst, Eliyahu? Wo sollen wir denn hin?«
Es waren jedoch nicht nur Schuldgefühle, die mich packten: Endlich bekam ich eine Chance, mich in den Augen meiner Eltern als würdig zu erweisen. Endlich würde ich zwei Dinge besitzen, nach denen ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt hatte – ihre Liebe und Wertschätzung. Jahrelang, selbst als ich versuchte, ein unabhängiges Leben zu führen und zu tun, was ich am meisten liebte, hatte ich mich nach ihrer Anerkennung gesehnt. Jetzt sah ich die Chance, sie zu gewinnen.
»Okay«, sagte ich. Wir trafen aber eine Vereinbarung: Ich würde die Woche über in New York City bleiben, um mich meiner Malerei zu widmen, und an den Wochenenden käme ich nach White Lake und kümmerte mich um das Motel. Irgendwo da draußen musste sich Mose gerade kaputtlachen.
Als ich meiner Schwester Goldie von meinem Plan erzählte, war sie entsetzt.
»Zieh aus, Elliot«, riet sie mir. »Tu es nicht. Wirf dein Leben nicht für sie und ihr blödes Motel weg. Tu dir das nicht an. Das Motel wird nie laufen.«
Ihre Worte sollten sich als nur allzu prophetisch erweisen, aber ich war zu blind, das Offensichtliche zu sehen. Außerdem liebte ich noch immer den Geruch von frischem Teer.