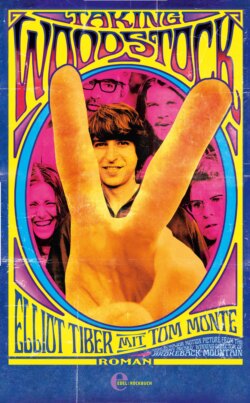Читать книгу Taking Woodstock - Elliot Tiber - Страница 9
3. Mein »anderes« Leben
ОглавлениеIch stand in der Nähe der Bar, ganz im Schatten, mit dem Rücken an den Zigarettenautomaten gelehnt, rauchte Kette und zog gelegentlich an den Joints, die mir die hungrigen Freier anboten. Alle drei Etagen von The Mine Shaft, einem Sexclub auf der Little Twelfth Street in Greenwich Village, waren an diesem Abend brechend voll. Aber ich war nur auf ein Augenpaar fixiert – aggressiv, zornig und hungrig nach Beute –, das meinen Blick sogar erwiderte. Das Objekt meiner Begierde war groß, schlank und von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet. An einer Seite seines Outfits hingen Handschellen und eine neunschwänzige Katze herab, und über die Schulter hatte er eine Lederkapuze geworfen. Ich war ähnlich gekleidet, aber nicht annähernd so selbstsicher: Ich fühlte mich fett und hässlich. Fotos von mir aus dieser Zeit erzählen eine etwas andere Geschichte – aber worauf es ankommt, ist die Geschichte in deinem Kopf. Was mich betraf, so gab es nichts an mir, was jemand anziehend finden konnte, der so schöne, wenn auch ein wenig beängstigende Augen hatte wie die, die mich an diesem Abend von der anderen Seite des Raumes aus verschlangen.
Wie ein Löwe, der plötzlich aus seiner Lethargie erwacht und für sein Abendessen bereit ist, bewegte sich mein Raubtier langsam auf mich zu. Er starrte mich mit einem so zornigen wie bösartigen Blick an und boxte mir fest in den Magen. Es war Liebe auf den ersten Schlag. Dann begann er sein Balzritual, führte mich in die Mitte des Raumes und machte mich vor den Augen von etwa hundert Männern – alle wie Polizisten oder, in einem Fall, wie ein SS-Offizier gekleidet – zum Objekt seines Vorspiels.
Als Kind hatte ich Aufmerksamkeit nur in Form von Ablehnung erfahren, doch hier gab es plötzlich Dutzende von Männern, die mich wollten. Das war das Tolle an den New Yorker Sexbars für Schwule: Jeder wollte jeden haben, sogar mich. In vieler Hinsicht war ich der Prototyp des schwulen Mannes, besonders zur damaligen Zeit. Nachdem sie von allen Teilen der Gesellschaft – außer ihrer eigenen – unterdrückt worden waren, ließen schwule Männer ihrem aufgestauten sexuellen Verlangen und ihrem verzweifelten Bedürfnis nach Anerkennung in den Sexbars und Badehäusern von New York freien Lauf. Was vor unseren Familien und Arbeitskollegen versteckt wurde, entlud sich in Läden wie dem Mine Shaft ganz offen. Ich fühlte mich noch hässlicher und abstoßender als die meisten, was jede Form von Akzeptanz sofort zu einem Aphrodisiakum machte. Die Situation, in der ich mich dort befand – Dutzende von Männern, die mich in der Mitte des großen, schwach beleuchteten Raumes befummelten, begrapschten, an sich rissen und küssten –, war die Erfüllung eines meiner besseren Sexträume.
Nachdem der Löwe lange genug zugesehen hatte, kam er herüber, schob die Männer fort, die mich umringten, und sprach Worte von süßester Poesie: »Mach dich sauber, du verdammte Schwuchtel. Du stinkst wie ein Scheißhaus.« Ich fiel fast in Ohnmacht. Draußen hielt er ein Taxi an und nahm mich mit »zu sich« in ein riesiges Loft in SoHo.
Zu viel Gras und zu viele THC-Pillen hatten mich zwar längst gefügig gemacht, aber als ich seine Wohnung sah, wurde ich schlagartig nüchtern. An einer Wand hing eine gewaltige, etwa neun Meter breite und sechs Meter lange Naziflagge. Hier und da lagen lange Messer und Säbel herum. Ich bevorzugte mein Sexspiel als ritualisierte Sadomaso-Nummer – ein paar kräftige Ohrfeigen, Schläge und Tritte waren unverzichtbar, aber Messerstiche und echtes Blut blieben definitiv tabu. Irgendetwas verriet mir, dass mein neuer Bekannter diese Auffassung nicht teilte.
»Hey, mir gehts nicht so gut, Boss«, sagte ich. »Ich würde lieber gehen.«
»Du gehst nirgendwohin.« Mit diesen Worten zog er ein Paar Handschellen heraus, drückte sie fest um meine Handgelenke und ließ sie zuschnappen. Dann zog er mir eine Lederkapuze über den Kopf und fesselte mich ans Bett. Ich war gleichzeitig erregt und erschrocken, was den Sex umso aufregender machte. Wir trieben es die ganze Nacht und auch fast den ganzen nächsten Tag, bis uns Drogen und Erschöpfung schließlich an unsere Grenze brachten.
Nachdem wir unseren Sex- und Drogenrausch ausgeschlafen hatten, kletterte ich aus dem Bett und sah mich in seinem Loft um. Wäre ich in der Nacht zuvor nicht von Drogen, Geilheit und Angst – besonders vor Hakenkreuzen – geblendet gewesen, so hätte ich vielleicht bemerkt, dass die Wände mit den erstaunlichsten Schwarz-Weiß-Fotografien bedeckt waren, die ich je gesehen hatte. Das waren keine der üblichen Bilder: Sie zeigten Männer und Frauen in hypnotisierend erotischen Posen, viele davon unverhohlen sadomasochistisch, die meisten hart an der Grenze. Ich erkannte in dieser Galerie von Gesichtern eine einzige Person: die Sängerin, Songschreiberin und spätere Punkrock-Ikone Patti Smith aus Greenwich Village.
An den Wänden hingen auch ein paar Porträts meines grimmigen Gastgebers sowie gerahmte Plakate mit Ankündigungen von Fotoausstellungen. Am unteren Rand dieser Plakate stand ein einzelner Name: Robert Mapplethorpe. Ich verstand nichts von Fotografie, und auch der Name sagte mir nichts.
»Was machst du, Boss?«
»Ich bin Fotograf.«
»Dann bist du ... Robert.«
»Ja«, antwortete er und schob eine große Trennwand zurück, hinter der sich ein weiterer Raum öffnete. Darin standen Unmengen von Holzkisten, alle voller Fotos. Ich sah die Stapel durch und erstarrte vor Ehrfurcht, denn Robert Mapplethorpe war ohne Zweifel ein Genie. Die unglaubliche Schönheit und bewusstseinsverändernde Perspektive der Bilder überwältigten mich. Viele zeigten Blumen, die in eine schmale Vase gesteckt und in ein weiches, zartes und entblößendes Licht getaucht waren. Die Menschen auf den Bildern waren fast alle nackt. Jedes Foto schien die Seele der betreffenden Person freizulegen – die eine stark und gepanzert wie die eines Kriegers, die andere vollkommen ungeschützt, verletzlich und scheu. Viele dieser Fotos zeigten Männer beim Sex – sehr befreiende und revolutionäre Porträts. Sie stellten sexuelle Handlungen dar, die Homosexuelle jeden Tag vollzogen, die aber – ebenso wie Schwule selbst – von der Gesellschaft verleugnet wurden. Mapplethorpe holte schwulen Sex – und damit das Leben von Schwulen – ans Licht und zeigte ihn der Welt. Jedes Foto war eine erstaunlich mutige Aussage, eine standhafte Weigerung, sich marginalisieren oder verleugnen zu lassen. Robert gehörte zu jenen Künstlern, die die Welt erschüttern, mit einem einzigen Foto Sichtweisen verändern und einen lange gehegten Glauben infrage stellen können.
Irgendwann riss er mich aus meinen Gedanken.
»Ich will dich fotografieren«, sagte er.
»Ja? Warum?«
»Ich will dich in einer Gestapo-Uniform fotografieren.«
»Das glaube ich nicht, Boss«, entgegnete ich.
»Doch, ich glaub schon«, sagte er mit einer Stimme hart wie Granit.
Wir waren nicht gerade das, was man ein perfektes Paar nennen würde.
»Vielleicht hast du Lust, an irgendeinem Wochenende mit mir nach White Lake zu kommen«, schlug ich vor.
»Ich weiß nicht, wo White Lake ist«, antwortete er leise und in geringschätzigem Ton.
»Es liegt oben im Norden, nur zwei Stunden auf dem New York State Thruway. Wir haben da ein Motel – nichts Besonderes, aber dort werden wir nicht gestört.«
»Du verstehst mich nicht«, sagte er. »Ich habe andere Pläne, und die sehen nicht vor, dass wir Kumpel werden. Ich will nichts über dein verdammtes Motel oder dein Leben wissen. Du bist nicht mal mein Typ.« Und so begann und endete unser Tanz.
Einige Monate danach sah ich Artikel über ihn in The Village Voice und den SoHo News. Er kämpfte gegen die Zensur seiner Fotografien. Später ging ich in eine Galerie in der Stadt, die seine Arbeiten ausstellte. Als er mich hereinkommen sah, schaute er mich an, als hätte er mich noch nie zuvor gesehen.
Das war so ungefähr die Zusammenfassung meiner sexuellen Geschichte. Männer, mit denen ich Sex gehabt hatte, taten immer so, als würden sie mich nicht kennen, wenn sie mich bei Tageslicht sahen. Daran hatte sich seit meiner Kindheit nichts geändert.
Als ich elf Jahre alt war, schlich ich mich tagsüber – manchmal auch nachts – aus dem Haus, um ins Kino zu gehen. Ich nahm die U-Bahn von Brooklyn zum Times Square in Manhattan, wo es Dutzende von Kinos mit Nonstop-Programmen gab. Ich war groß für mein Alter und ging leicht für sechzehn durch – nicht, dass es irgendjemanden interessiert hätte. Ich verlangte eine Eintrittskarte, bezahlte und wurde in die Filme gelassen, die ich sehen wollte – Laurel und Hardy, Abbott und Costello, die Marx Brothers, Betty Grable und Carmen Miranda.
In den Vierziger- und Fünfzigerjahren waren die Kinos am Times Square große, prachtvolle Paläste, in denen ursprünglich Theateraufführungen stattgefunden hatten und später erst Filme gezeigt wurden. Diese Kinos verfügten über riesige Balkone und erste Ränge, in denen ein paar Hundert Leute sitzen konnten. Entlang der Wände, etwa in der Mitte zwischen Boden und Decke, gab es kunstvoll gestaltete Logen. Wände und Balkone waren mit geprägten Löwenköpfen und noch anderen vergoldeten Ornamenten verziert. Die riesigen Leinwände waren zwei- bis dreimal so groß wie heute. Für eine Eintrittskarte bekam man zwei Filme hintereinander sowie eine Wochenschau und einen Cartoon zu sehen. So konnte ich fast den ganzen Tag oder die ganze Nacht im Kino verbringen.
Eines Abends saß ein Junge aus meiner Nachbarschaft, der Frank hieß und nur zwei Jahre älter war als ich, neben mir im Kino. Er erkannte mich nicht, sondern blickte stur auf die Leinwand. Ich dachte mir nichts dabei und sah mir den Film an. Aber schon bald bemerkte ich, dass Franks Schulter näher an meine herangerückt war und er sein Bein gegen meines drückte. Ich ignorierte diese Annäherung, bis ich seine Hand innen auf meinem Oberschenkel spürte. Dann zog er die Hand zurück und schien kurz mit irgendetwas anderem beschäftigt zu sein – bis er sich plötzlich wieder zu mir drehte und mir ein Taschenmesser vors Gesicht hielt.
»Elli, bleib einfach sitzen und halt den Mund«, flüsterte er.
Ich erstarrte vor Angst. Frank steckte sein Messer weg, sah wieder auf die Leinwand und legte die Hand in meinen Schritt. Dann öffnete er den Reißverschluss meiner Hose und befummelte mich. Ich saß wie versteinert da. Was geschah hier? Was sollte ich tun? Ich kannte diesen Jungen aus meiner Nachbarschaft. Wenn ich abhaute, würde er mich bei unserer nächsten Begegnung verprügeln. Schon bald vermischte sich die Angst mit einem merkwürdigen Vergnügen, das ich allerdings nicht verstand. Ich war ein Spätentwickler und hatte nicht die geringste Ahnung von Sex. Ich hatte noch nie masturbiert, aber jetzt masturbierte mich Frank – und ich sprach darauf an. Es dauerte nicht lange, bis ich zum Höhepunkt kam – worauf Frank aufstand und ging, ohne mich anzusehen. Meine Hose war vorn ein wenig nass, aber ich hatte keine Ahnung warum. Also nahm ich an, ich würde irgendwo bluten. Ich muss wohl eine Stunde völlig schockiert und verwirrt dagesessen haben und nicht gewusst haben, was ich tun sollte. Schließlich tauchte eine Platzanweiserin auf und leuchtete mir mit ihrer Taschenlampe ins Gesicht. Hinter mir hörte ich die Stimme meines Vaters: »Was tust du hier, Elli? Deine Mutter ist meschugge vor Angst. Wo ist mein Sohn, fragt sie andauernd.«
Er brachte mich nach Hause, schlug mich mit dem Gürtel und schickte mich ins Bett. Als ich mich in meinem Zimmer umzog, stellte ich fest, dass kein Blut in meiner Hose war. Ich atmete erleichtert auf. Dann schlich ich mich in den Keller hinunter, wo einer dieser alten Frontlader-Kohleöfen stand. Ich öffnete die Ofentür, warf meine Hose und die Unterwäsche ins Feuer, schlich mich wieder nach oben, stellte mich unter die Dusche und ging schlafen.
Ein paar Tage später fragte einer meiner Klassenkameraden unseren Biologielehrer nach der Bedeutung des Wortes »Masturbation«. Der Lehrer weigerte sich zu antworten – was mich sofort vermuten ließ, dass es sich um ein wichtiges Wort handeln musste. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, schlug ich es im Wörterbuch nach und dachte: Okay – das ist genau das, was Frank mit mir gemacht hat. Ich verstehe. Hier steht, dass es keine schädliche Wirkung hat. Nichts Lebensbedrohliches. Das sind gute Nachrichten!
Jetzt gab es einen neuen Grund, ins Kino zu gehen – und nichts konnte mich aufhalten, nicht einmal der drohende Gürtel meines Vaters.
Frank hatte mir die Augen für etwas geöffnet, das schon die ganze Zeit um mich herum passiert war, ohne dass ich es bemerkte. Die Kinos am Times Square waren Sextreffs; auf allen Rängen hatten Jungen und Jungen, Jungen und Männer, Mädchen und Jungen, Frauen und Männer Sex. Am begehrtesten waren die Balkone, weil man sich dort am besten in der Dunkelheit verstecken konnte. Man geht ins Kino, um Sex zu haben. Diese Erkenntnis ereilte mich mit einem seltsamen und intensiven Gefühl der Erregung. Während Lou Costello von Bud Abbott auf der großen Leinwand geohrfeigt wurde, fielen die Zuschauer in den Sitzreihen übereinander her.
Als ich das nächste Mal ins Kino ging, setzte ich mich auf meinen alten Platz, ließ mich ein wenig in den Sitz sinken und wartete, ob jemand kam. Es dauerte nicht lange, bis ein Mann im Regenmantel erschien. Er zog seinen Mantel aus, setzte sich neben mich und warf den Mantel über seinen Schoß. Dann zog er ihn über meinen Schoß, fuhr mit seiner Hand darunter und fing an, mich zu befummeln. Erkenntnis Nummer zwei: Es gab Unmengen von Regenmänteln im Kino. Männer gaben Jungen oder Mädchen ein Zeichen und trieben dann allerlei sexuelle Spielchen unter ihren Regenmänteln. Eine völlig neue Welt tat sich vor mir auf. Ich war in diesem Sexladen wie ein Kind: Ich wollte alles, was ich bekommen konnte. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich begehrt.
Der erste Regenmantel sollte zu meinem Stammfreier werden. Jeden Freitagabend um halb acht ging ich ins Kino und nahm meinen üblichen Platz ein. Kurze Zeit später saß er neben mir und warf, ohne mich anzusehen, seinen Regenmantel über meinen Schoß, um dann zu tun, was er immer tat. Das ging ein paar Monate so. Aber eines Abends setzte sich ein schwarzer Mann auf seinen Platz und befummelte mich. Mein Stammfreier kam zu spät, aber statt sich zurückzuziehen, fing er an, sich mit dem schwarzen Mann zu prügeln. Die beiden schlugen im Gang aufeinander ein, als mein Stammfreier plötzlich ein Messer aus der Tasche zog und den Schwarzen verjagte.
Wow, was für eine Aufregung! Ich konnte mir kaum vorstellen, dass mich gleich zwei Männer begehrten – ganz zu schweigen davon, dass sie um mich kämpften. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann waren da die Berührungen: Männer berührten mich mit der Absicht, ihre Lust zu befriedigen. Und ob es zu ihrer Absicht dazugehörte oder nicht, sie befriedigten jedenfalls auch meine Lust. Bis zu diesem Punkt hatte ich in meinem Leben genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, denn zu Hause waren immer alle Berührungen mit Schmerz verbunden. Doch wie ich schon bald erfahren sollte, konnte auch Schmerz etwas mit Lust zu tun haben.
Als Teenager wechselte ich dann in andere Kinos. Eines Abends im Rialto, das ebenfalls an der 42. Straße lag, setzte sich ein großer Mann im feinen Anzug neben mich – jemand, den Mama bestimmt einen »echten Gentleman« genannt hätte. Er öffnete den Reißverschluss meiner Hose und bearbeitete meinen Penis, bis er steinhart war. Dann kratzte er mich mit seinen Fingernägeln, bis ich Blut in meinen Schritt tropfen fühlte. Ich blieb die ganze Zeit mucksmäuschenstill, war mir aber sehr deutlich der Tatsache bewusst, dass die Schmerzen meine Lust steigerten. Auch dieser Mann wurde ein Stammfreier. Ich erschien ungefähr um Mitternacht im Rialto und erwartete den Herrn im feinen Anzug. Manchmal sahen andere dabei zu, was er mit mir anstellte, was das Ganze noch aufregender machte.
Nachdem mein »Gentleman« gegangen war, saß ich zitternd da und versuchte, mich wieder in den Griff zu bekommen. Ich verstand nichts von all dem, was mit mir geschah. Alles war Instinkt und Spontaneität. Aber damit begann ein neues Kapitel der sexuellen Erkundung – sadistische Pädophile in Kinos zu suchen und zu finden. Das war meine geheime Welt, und dies waren meine geheimen Vergnügungen. Hätte ich jemals darüber nachgedacht, vielleicht hätte ich gesagt, dass meine Kinoabenteuer die Kompensation waren für all die Wut, den Schmerz und das Leid, wie ich es zu Hause und in der Jeschiwa ertragen musste.
Es dauerte nicht lange, bis ich nach brutalem Sex verlangte. Wenn sich ein Regenmantel neben mich setzte, löste ich schon meinen Gürtel und band ihn mir um die Handgelenke. Meine Freier verstanden die Botschaft sofort und nutzten die Gelegenheit voll aus.
Wie ich bereits erfahren hatte, war mein Verhalten keineswegs ungewöhnlich. In den Kinos existierte eine eigenständige S&M-Subkultur. Eines Nachts rutschte ein Mann auf den Sitz neben mir, der wie ein Cowboy gekleidet war. Nach einem kurzen Vorspiel zog er ein Stück Seil aus der Tasche, schnürte es um meine Genitalien und sengte dann die Haut an meinem Arm mit einem Feuerzeug an. Regelmäßig tauchten Leute mit Handschellen, Feuerzeugen und sogar mit Messern auf.
Manchmal wurde es gefährlich. Einmal fesselte mich ein Mann in Militäruniform in einem praktisch leeren Kino und drohte, mich umzubringen. Ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben solche Angst gehabt und war mir sicher, nicht lebend aus dem Kino herauszukommen. Aber die Militäruniform verlor das Interesse, als ich so tat, als sei ich betrunken und high und gar nicht in der Lage, mich auf ihn einzulassen. Ein anderes Mal sah ein Junge zu, wie mich ein älterer Mann masturbierte. Als der Mann gegangen war, setze sich der Junge neben mich, bedrohte mich mit einem Messer und verlangte mein Geld. Ich gab ihm meine Brieftasche, in der sich ein einziger Ein-Dollar-Schein befand. Er wusste natürlich nicht, dass ich mein Geld immer in den Socken aufbewahrte. Man lernte, was man lernen musste.
Natürlich hatte ich manchmal Angst, aber wenn man ein Junge ist und sich verzweifelt nach körperlicher Lust sehnt, erscheinen die Gefahren gering und kalkulierbar. Wenn ich jetzt auf diese Zeit in meinem Leben zurückblicke, wird mir klar, wie unendlich allein und ausgehungert nach jeder Art von körperlichem Kontakt ich gewesen sein muss.
Wie jeder andere lernte auch ich zu Hause, was Liebe war. Ich erfuhr »Liebe« jedoch nur in Form von Manipulation und Gewalt, überzuckert mit dem Anschein von Familie und Fürsorge. Eigentlich benutzte niemand in meiner Familie das Wort »Liebe« im Zusammenhang mit anderen Familienmitgliedern. Wir »liebten« Schokolade und wir »liebten« unseren Fernseher. Aber wir sagten nie, dass wir einander liebten, und niemand in unserer Familie wurde wirklich liebevoll behandelt. Dementsprechend fielen auch meine frühen Erfahrungen mit Sex aus. Die sexuellen Freuden von Erregung, Berührung und Orgasmus waren zwar alle sehr real, kamen aber von Fremden und stellten im Grunde nichts anderes dar als verschiedene Formen des Missbrauchs. Da ich jedoch so wenig mit Liebe vertraut war, wusste ich nicht, was ich vom Sex erwarten sollte. Meine Eltern hatten weder über das eine noch über das andere jemals mit mir gesprochen. Am Ende war der Sex, den ich erlebte, ebenso missbräuchlich, wie die Liebe es auch immer gewesen war.
Und so wurde ich, Elliot Tiber, zum Sex mit Männern getrieben – eine Tatsache, die ich mir zunächst gar nicht bewusst machte. Ich hielt es für selbstverständlich. Erst viel später, als ich tatsächlich Sex mit jemandem hatte, den ich mochte, gab sich meine wahre Natur zu erkennen.
Es war an einem Tag in dem Sommer, als ich sechzehn wurde, also kurz vor dem College. Eines Tages fuhr ich zum Riis Beach, nicht weit von Coney Island entfernt. Ich hatte meine Badehose angezogen und legte mich auf eine Decke, um mich zu sonnen. Kurze Zeit später breitete irgendjemand seine Decke unmittelbar neben meiner aus und legte sich darauf. Aus den Augenwinkeln sah ich einen hübschen Jungen in meinem Alter, wandte mich aber schnell wieder ab und ließ mir nichts anmerken. Schon bald spürte ich, wie sich eine Hand unter meine schob und sich mit meinen Fingern verschränkte. Überrascht sah ich meinen Nachbarn an und lächelte. Er lächelte zurück und sagte, sein Name sei Barry.
»Ich bin Elliot«, entgegnete ich. »Aber meine Freunde nennen mich Elli.«
Wie immer war mein erster Gedanke: Wie ist es möglich, dass so ein hübscher Junge Interesse an mir haben kann? Aber so war es. Wir unterhielten uns ein paar Stunden über Filme und die Schule. Die ganze Zeit über streichelte er meine Hand. Das alles war neu und aufregend – eine erste Liebe. Schließlich schlug ich vor, er solle mit mir nach Hause kommen. Meine Eltern und Schwestern waren nicht da, und ich wusste, dass ich sturmfreie Bude hatte. Ich hatte noch nie zuvor einen Jungen zu mir nach Hause eingeladen. Die Aufregung war fast unerträglich.
Als ich die Tür aufschloss, spürte ich sofort eine Welle der Scham in mir aufsteigen. Unsere Möbel stammten von der Heilsarmee; all das aussortierte Zeug, das die Wohlfahrt nicht wollte, bekamen wir so gut wie umsonst. Und das sah man auch. Das einzige Zimmer, in dem es keine zusammengewürfelten Möbel gab, war das meiner Schwester Goldie, und dort führte ich Barry auch sofort hinein.
Barry war der erste Mann, den ich küsste. Er war im Grunde auch der erste Mann, mit dem ich etwas erlebte, was man »sich lieben« nennen könnte. Wir küssten uns, hatten Sex und redeten dann tatsächlich über unser Leben. Ich erzählte ihm, dass ich zwar bald Kunststudent am Hunter College sein würde, aber lieber in Brooklyn studieren würde. Er wollte demnächst auf ein College im Norden von New York gehen. Es schien also möglich, dass wir Freunde werden und uns tatsächlich wiedersehen könnten. Das allein war eine vollkommen neue Erfahrung für mich – Sex mit jemandem zu haben, den ich ansah und mit dem ich sprach.
Wir verbrachten den Rest des Tages und der Nacht damit, zu reden und uns zu lieben. In unseren Unterhaltungen benutzte Barry die ganze Zeit das Wort »schwul« – vor allem, wenn er von sich selbst sprach. Ich selbst hatte es noch nie gebraucht. Obwohl ich bisher ausschließlich mit Männern Sex gehabt hatte, bezeichnete ich mich auch deshalb nicht als homosexuell, weil ich mich einem anderen menschlichen Wesen beim Sex bisher noch nie verbunden gefühlt hatte. Außerdem war Sex etwas, das ich verborgen hielt, sogar vor mir selbst: Er ereignete sich in dunklen Kinosälen mit vollkommen Fremden. Und in den meisten Fällen hätte ich mit diesen Fremden auch keinerlei Beziehung haben wollen.
Barry betrachtete sich selbst jedoch eindeutig als homosexuell. Er fühlte sich mit seiner Sexualität wohl und sehnte sich nach einer Beziehung. Für ihn waren Sex und Beziehungen miteinander verbunden, und diese Verbindung machte er mir bewusst. Er sorgte dafür, dass ich mich meinem eigenen Bedürfnis nach einer Beziehung öffnete, insbesondere der mit einem homosexuellen Mann. All das half mir dabei, die nächste große Erkenntnis zu akzeptieren: Ich bin schwul.
Es hätte nicht offensichtlicher sein können, doch bis zu diesem Augenblick war dies eine unbekannte Tatsache in meinem Leben gewesen. Ich hatte nicht nur etwas Wesentliches über mich selbst begriffen – etwas, das immer da gewesen war –, es hatte sogar einen Namen. Homosexuell. Schwul. Es war, als hätte sich plötzlich eine riesige Tür geöffnet, von deren Existenz ich vorher keine Ahnung gehabt hatte, und mir einen vollkommen neuen Teil meines Ichs gezeigt – einen Teil, von dem ich vielleicht schon einmal vage vermutet hatte, dass es ihn gab, über den ich aber nie zuvor nachgedacht hatte.
Doch eigentlich änderte das nicht viel. Ich war noch immer ich selbst. Wenn ich jetzt zurückblicke, wird mir allerdings klar, dass mein Leben damals eine Art neuen Glanz bekam – eine neuartige Freude, die aus dem Wissen erwuchs, auf der Welt nicht vollkommen allein zu sein.
Als wir am nächsten Morgen aufwachten, sagte Barry: »Ich könnte doch meinen Freund Harvey anrufen und fragen, ob er herkommen will. Er schreibt Theaterstücke. Du wirst ihn mögen.«
Als Harvey ankam, stand Barry gerade unter der Dusche, also führte ich Harvey ins Wohnzimmer und wir setzten uns aufs Sofa. Wir hatten gerade erst ein paar Worte gewechselt, als Harvey den Arm um mich legte und mich direkt auf den Mund küsste. Dann rückte er näher an mich heran, und wir umarmten und küssten uns noch leidenschaftlicher. Das war die zweite Person in zwei Tagen, die mich küsste, also stand ich ein wenig unter Schock. Zwei hübsche Männer fanden mich attraktiv und wollten mich küssen. Irgendwie konnte ich das alles nicht glauben, konnte aber auch die überwältigende Freude nicht leugnen, die es mir bereitete, begehrt zu werden.
Leider kam Barry genau in diesem Augenblick die Treppe herunter und erwischte uns in einer leidenschaftlichen Umarmung, als er das Wohnzimmer betrat. Er bekam einen Wutanfall, zog sich an, stürmte aus dem Haus und ward nie mehr gesehen. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Also versuchte ich ihn anzurufen und es zu erklären, aber er rief nie zurück. Harvey und ich trafen uns etwa einen Monat, bevor sich auch unsere Wege trennten.
Auf dem College wurde mir meine Sexualität noch einmal deutlicher bewusst, auch wenn ich mein Bestes tat, um sie vor anderen verborgen zu halten. In meinem ersten Jahr schloss ich mich einer Studentenverbindung an und tat so, als sei ich hetero, wie die anderen Jungs. Bei einer unserer Partys fand eine Rothaarige – betrunken und high – Gefallen an mir und zerrte mich in eines der Zimmer, wo alle Mäntel auf einem Haufen auf dem Bett lagen. Sie fing an, sich auszuziehen und bestand darauf, dass wir miteinander schliefen. Ich tat ihr den Gefallen – in erster Linie, um nicht aufzufliegen. Und auch das war nicht schlecht. Aber plötzlich wurde die Tür aufgerissen und die meisten meiner Verbindungskameraden stürmten ins Zimmer und riefen meinen Namen, während ich mit diesem Mädchen Sex hatte. Also stöhnten wir beide weiter – für unsere Zuschauer –, doch letztlich fand ich dieses Erlebnis absolut widerwärtig.
Mit neunzehn erzählte mir ein Freund von einer Schwulenbar auf der Third Avenue, in der alle Lederjacken trugen. »Willst du hingehen?«, fragte der Freund.
»Klar«, antwortete ich.
Wir tauchten in Baumwolljacke, Baumwollhose und normalen Straßenschuhen in der Bar auf und stachen hervor wie Schuljungs im Puff. Es dauerte nicht lange, bis uns ein großer muskulöser Motorradtyp entdeckte und direkt auf mich zusteuerte. Er musterte mich von oben bis unten, schaute mich missbilligend an und versetzte mir einen harten Schlag auf die Schulter. »Verdammte Schwuchtel, wenn du nächsten Samstag wiederkommen willst, ziehst du besser eine Lederjacke und Stiefel an.« Das musste er mir nicht zweimal sagen.
Ich ging in den nächsten Armeeshop, kaufte mir eine Jacke und ein Paar Stiefel. Als mein Freund erfuhr, dass ich die erforderlichen Klamotten tatsächlich gekauft hatte, sagte er: »Du gehst doch da nicht wieder hin, oder?«
»Natürlich gehe ich wieder hin.«
»Du bist verrückt.«
»Marlon Brando trägt eine Lederjacke. Warum soll ich nicht auch eine tragen?«
Als ich am darauffolgenden Samstag in die Bar auf der Third Avenue ging, sah ich so cool aus wie alle anderen. Derselbe große Biker kam zu mir, musterte mich wieder von oben bis unten, schlug mir auf die Schulter und küsste mich dann. Wir verbrachten die nächsten drei Tage in seinem Apartment und hatten aufregenden S&M-Sex. Aber dann sah ich ihn nie wieder, wie andere davor und danach auch.
Nach meinem Collegeabschluss bezog ich ein Apartment in Greenwich Village und arbeitete als Innenausstatter bei W. & J. Sloane. Daneben betätigte ich mich häufig als freiberuflicher Designer für einen festen Stamm reicher Kunden. Meine Karriere führte steil nach oben, und es dauerte nicht lange, bis ich regelmäßigen Umgang mit den Reichen und Berühmten von New York pflegte. Zu meinen Freunden gehörte damals auch Alvin Epstein, ein bekannter Broadway- und Fernsehschauspieler. Alvin kannte offenbar jeden in der Kunstszene und in Hollywood, er wurde ständig auf die besten Partys eingeladen.
Eines Abends trafen wir uns auf ein paar Drinks in der San Remo Bar in Greenwich Village, einem beliebten Treffpunkt von Schwulen und ab und zu auch von Prominenten. Wir waren noch bei unserem ersten Drink, als ich Marlon Brando und Wally Cox an einem der Tische in der Nähe erkannte. Ich stieß Alvin mit dem Ellbogen an und sagte: »Ist das der, von dem ich glaube, dass er es ist?«
Alvin drehte sich um und grinste breit, bevor er aufstand und zu den beiden Männern hinüberging. Alvin, Brando und Cox begrüßten sich überschwänglich und umarmten einander. Ich hielt mich im Hintergrund, aber Brando und Cox bestanden darauf, dass wir uns zu ihnen setzen.
Brando verströmte förmlich Sexualität. Egal ob hetero oder schwul – man konnte den Mann nicht anschauen, ohne ihn sich im Bett vorzustellen. Brando und Cox hatten bereits ein paar Drinks intus und waren schon ziemlich gut dabei.
Brando sah mich an und sagte: »Hey Kid. Was starrst du so?«
Ich war verunsichert und antwortete: »Ist das wirklich Mr. Peepers?« Wally Cox, der später die Hauptrolle in einer Reihe sehr beliebter Fernsehshows spielte, darunter auch The Hollywood Squares, war nämlich ursprünglich in den Fünfzigern als Titelheld der Sitcom Mister Peepers berühmt geworden.
Cox wandte sich mir zu und sagte: »Nein, ich bin Orson Welles.«
Brando lachte und meinte: »Nein, er ist Rita Hayworth.«
Daraufhin sagte ich zu Brando, die Leute würden mir andauernd erzählen, er und ich könnten Zwillinge sein.
Alle lachten schallend, und jetzt ging die Party erst richtig los.
»Wo kommst du her, Junge?«, fragte mich Brando.
»Ich? Aus Bensonhurst, Brooklyn, nicht weit von Coney Island.«
»Dann bist du aber weit weg von zu Hause. Weißt du nicht, dass hier in dieser Bar eine Menge Homos rumlaufen?«
»Psst«, antwortete ich, »die Leute könnten dich hören. In Bensonhurst haben wir keine Homos.«
Alle brüllten vor Lachen.
»Habt ihr wohl«, rief Wally Cox. »Sie sind doch überall. Sogar auf Coney Island. Was würden deine Eltern wohl sagen, wenn sie wüssten, dass du mit Homos ein Bier trinkst? Barkeeper, gib unserem Brooklyn-Jungen hier noch ein Bier.«
»Ich kann nicht glauben, dass ich ein Bier mit Mr. Peepers und Stanley Kowalski trinke«, sagte ich zu Cox und Brando.
»Nein, der bin ich nicht. Ich bin Eva Marie Saint«, erwiderte Brando.
»Ich spar auf eine Motorradjacke«, sagte ich zu Brando. Und dann flüsterte ich den beiden verschwörerisch zu: »Hey, seid ihr ... äh ... beide ... Homosexuelle?«
»Auf gar keinen Fall«, meinte Cox. »Wir sind nur herge kommen, um uns ein paar von diesen Tunten da anzusehen. Aber wir selbst? Kein bisschen. Bist du denn einer?«
»Du weißt doch, er ist aus Brooklyn. Die haben da keine«, warf Brando ein. Wieder lachten alle schallend.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid beide mit ganz normalen Leuten hier.« Dann wandte ich mich wieder an Brando: »Herrgott noch mal, du hast einen Academy Award gewonnen.«
Brando lächelte und erklärte: »Ich sag dir was, Junge. Umarme mich, aber tu’s wie ein Mann.«
»Wie wär’s, wenn du mich umarmst?«, fragte Cox. »Willst du deiner Mom und deinem Pop nicht erzählen, dass Mr. Peepers und Marlon Brando dir ein Bier spendiert und dich umarmt haben?«
Ich stand auf und umarmte die beiden ein wenig schüchtern.
»Weißt du was«, schlug Brando vor, »wir gehen zu einer Party nur ein paar Blocks von hier. Komm doch einfach mit. Da können wir uns so lange umarmen, wie wir wollen.«
Wally Cox beugte sich zu mir vor und raunte in einer Art Bühnenflüstern: »Aber ich muss dich warnen. Es könnten ziemlich viele Homosexuelle auf der Party sein.«
In dieser Nacht hing ich mit Marlon Brando, Wally Cox, Alvin Epstein und einem ganzen Haufen anderer Berühmtheiten herum, darunter waren viele Homosexuelle. Sie wurde zu einer der großartigsten Nächte meines Lebens.
Nächte wie diese sind im Leben jedes Menschen sehr selten. Sie sind wie ein großes Hoch – auf das bei mir meist ein großes Tief folgte. Ich war völlig allein, als ich in dieser Nacht nach Hause kam. Meine wenigen Freunde und Verwandten hatten alle jemanden, zu dem sie nach Hause kommen und dem sie ihre tollen Geschichten erzählen konnten. Aber ich lag einsam in meinem Bett – ohne jemanden an meiner Seite, dem ich von der Nacht berichten konnte, in der ich Marlon Brando und Wally Cox umarmt, mit ihnen gelacht und die Puppen hatte tanzen lassen. Ich hätte vermutlich eine meiner Schwestern anrufen können, aber es wäre ihnen egal gewesen, selbst wenn sie mir geglaubt hätten. Was ich allerdings bezweifle. Und meine Eltern hätte es ohnehin nicht im Geringsten interessiert.
»Bran-wer?«, konnte ich meine Mutter sagen hören. »Wally Cox? Der so viel Unsinn redet? Hör mal, hast du heute Geld verdient? Die Hypothek bringt uns noch um.« Und so endete eine weitere lange, langsame und traurige Nacht für Elli. Immer, wenn mich die Einsamkeit ganz schlimm erwischte, folgte ich dem lebenslangen Beispiel meines Vaters. Ich ging einfach schlafen.
Und so verlief mein ganzes Leben: Während der Woche arbeitete ich in New York, wo ich Geld verdiente und gelegentlich eine sexuelle Liaison mit einem Fremden hatte. Am Freitagabend fuhr ich nach White Lake, um das Geschäft meiner Eltern zu retten.
In White Lake spielte ich den ganz normalen Geschäftsmann – eine gigantische Lüge, denn in New York war ich ein Künstler und ein schwuler Mann. Und indem ich vorgab, beides zu sein, konnte ich weder das eine noch das andere sein – zumindest nicht vollständig.
Ich wurde von meinen beiden Identitäten zerrissen und war unfähig, den Konflikt zu lösen, mit dem ich mich konfrontiert sah. Hätte ich mich für mein eigenes Leben entschieden, wäre ich aus White Lake geflohen: wie ein Mann, der aus einem Foltergefängnis freigelassen wird. Aber dann wären meine Eltern völlig verarmt. Doch wenn ich nicht langsam begann, mein eigenes Leben zu leben, würde ich mich ver mutlich eines Tages mit meinem Wagen von der George Washington Bridge stürzen. So oder so, die Uhr tickte. Jeden Freitagnachmittag, während ich auf dem New York Thruway nach Norden rollte und meine Freunde Richtung Osten nach Fire Island unterwegs waren, grübelte ich in düsterer Stimmung über das heillose Durcheinander nach, in dem sich mein Leben befand. Auf diesen Fahrten zurück zum Motel verfolgte mich oft die prophetische Warnung meiner Schwester: »Du verschwendest die besten Jahre deiner Jugend an dieses beschissene Motel. Es wird niemals laufen.«
Wie oft wäre ich am liebsten umgedreht und hätte vergessen, dass ich diese beiden Trottel überhaupt kannte, die da gerade ihr eigenes und auch mein Leben zerstörten. Es gab Zeiten, da hätte ich sie am liebsten beide erwürgt. Aber ich fuhr weiter bis zur Ausfahrt Nummer 16, auch wenn mir Tränen übers Gesicht liefen.