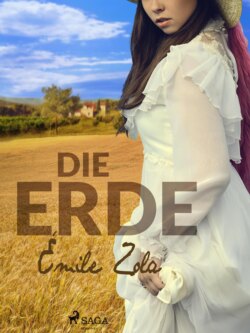Читать книгу Die Erde - Эмиль Золя, Emile Zola, Еміль Золя - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL IV
ОглавлениеDer folgende Sonntag fiel gerade auf den 1. November, auf Allerheiligen; und es war kurz vor neun Uhr, als Abbé Godard, der Pfarrer von Bazoches-le-Doyen, dem es oblag, den ehemaligen Pfarrsprengel Rognes mitzuversehen, oben am Abhang herauskam, der zur kleinen Brücke über den Aigre hinabführte. Das einst bedeutendere Rognes, dessen Bevölkerung auf kaum dreihundert Einwohner zurückgegangen war, hatte seit Jahren keinen Pfarrer mehr und schien sich nicht darum zu kümmern, einen zu bekommen, so daß der Gemeinderat den Feldhüter in dem halbverfallenen Pfarrhaus untergebracht hatte.
Jeden Sonntag legte also Abbé Godard zu Fuß die drei Kilometer zurück, die Bazoches-le-Doyen von Rognes trennten. Dick und untersetzt, mit rotem Genick und so aufgeblähtem Hals, daß der Kopf nach hinten zurückgedrückt wurde, zwang er sich aus Gesundheitsgründen zu dieser Übung. Aber da er an diesem Sonntag merkte, daß er sich verspätet hatte, schnaufte er schrecklich, hatte den Mund weit offen in dem apoplektischen Gesicht, in dem das Fett die kleine Stupsnase und die grauen Äuglein ertränkt hatte; und unter dem fahlen, schneebeladenen Himmel schwenkte er trotz der vorzeitigen Kälte, die auf die Regengüsse der Woche folgte, seinen Dreispitz und kam barhäuptig daher mit seinem dichten, struppigen, fuchsroten Haar, das bereits grau wurde.
Die Landstraße führte steil zu Tal, und am linken Ufer des Aigre vor der Steinbrücke standen nur ein paar Häuser, eine Art Vorwerk, das der Abbé in seinem Sturmesgang durcheilte. Er hatte nicht einmal einen Blick – weder stromauf noch stromab – für den trägen und klaren Fluß, dessen Windungen sich inmitten von Weiden- und Pappelgruppen hinschlängelten zwischen den Wiesen. Aber auf dem rechten Ufer begann das Dorf, eine Doppelreihe von Häuserfassaden, die die Landstraße säumten, während andere Häuser, auf gut Glück hingepflanzt, den Hang hinaufkletterten; und gleich hinter der Brücke befanden sich die Bürgermeisterei und die Schule, eine ehemalige, um eine Etage aufgestockte, mit Kalk getünchte Scheune. Einen Augenblick zögerte der Abbé, steckte den Kopf in den leeren Hausflur. Dann drehte er sich um, er schien mit einem flüchtigen Blick die zwei Kneipen gegenüber zu durchwühlen: die eine hatte ein sauberes Ladenfenster, in dem Flaschen ausgestellt waren und über dem ein kleines gelbes Holzschild angebracht war, auf dem man in grünen Buchstaben lesen konnte: Macqueron Kolonialwaren; die andere, deren Tür lediglich mit einem Stechpalmenzweig geschmückt war, breitete auf der grob verputzten Mauer in Schwarz die folgenden Worte aus: Tabakwaren hier bei Lengaigne. Und Abbé Godard entschloß sich, eine abschüssige Gasse zwischen beiden einzuschlagen, einen kleinen steilen Weg, der gerade vor die Kirche führte; da ließ ihn der Anblick eines alten Bauern stehenbleiben.
„Ach, Ihr seid’s, Vater Fouan ... Ich hab’s eilig, ich wollte Euch schon besuchen kommen ... Wie geht’s uns denn, na? Es ist unmöglich, daß Euer Geierkopf Lise in ihrer Lage sitzenläßt, mit diesem Bauch, der dick wird und einem geradezu in die Augen springt ... Sie ist Marienjungfrau, das ist eine Schande, eine Schande!“
Der Alte hörte mit einer Miene höflicher Ehrerbietung zu. „Freilich! Herr Pfarrer, was soll ich denn da machen, wenn Geierkopf halsstarrig ist? – Und dabei hat der Bursche immerhin recht, in seinem Alter verheiratet man sich kaum, wenn man nichts hat.“
„Es ist aber ein Kind da!“
„Sicher ... Bloß es ist noch nicht zur Welt gekommen, dieses Kind. Weiß man’s denn? – Das ist es ja gerade, ein Kind, das muntert einen nicht gerade auf, wenn man nicht das Nötige hat, ihm ein Hemd auf den Leib zu kleben!“ Er sagte diese Dinge besonnen, eben wie ein Greis, der das Leben kennt. Dann fügte er mit derselben gemessenen Stimme hinzu: „Übrigens wird sich das vielleicht einrenken ... Ja, ich teile meinen Besitz auf, nachher, nach der Messe losen wir aus ... Alsdann, wenn Geierkopf seinen Teil hat, wird er, wie ich hoffe, zusehen, daß er seine Kusine heiratet.“
„Gut!“ sagte der Priester. „Das genügt, ich verlasse mich auf Euch, Vater Fouan.“ Aber plötzlich voll einsetzendes Glockenläuten schnitt ihm das Wort ab, und er fragte bestürzt: „Es läutet doch zum zweiten Mal, nicht wahr?“
„Nein, Herr Pfarrer, zum dritten Mal.“
„Ach, du meine Güte! Das ist wieder dieser Trottel Bécu, der läutet, ohne auf mich zu warten!“
Er fluchte, er stieg ungestüm den Pfad hinan. Oben hätte er beinahe einen Anfall bekommen, und sein Brustkasten fauchte wie ein Schmiedeblasebalg.
Die Glocke läutete weiter, während die Raben, die sie gestört hatte, krächzend zur Turmspitze flogen, ein Spitztürmchen aus dem fünfzehnten Jahrhundert, das Zeugnis ablegte von der früheren Bedeutung von Rognes. Vor der weit offenen Tür wartete eine Gruppe Bauern, mitten unter ihnen rauchte der Schankwirt Lengaigne, ein Freidenker, seine Pfeife; und weiter weg, dicht an der Mauer des Friedhofs, sprach der Bürgermeister, der Hofbesitzer Hourdequin, ein stattlicher Mann mit energischen Zügen, mit seinem Stellvertreter, dem Krämer Macqueron. Als der Priester grüßend vorübergegangen war, folgten ihm alle bis auf Lengaigne, der all dem ostentativ den Rücken kehrte und seine Pfeife schmauchte.
In der Kirche zog rechts von der Vorhalle ein Mann immer noch am Glockenstrang, an dem er hing.
„Genug, Bécu!“ sagte Abbé Godard außer sich. „Ich habe Euch schon zwanzigmal gesagt, daß Ihr auf mich warten sollt, bevor Ihr mit dem dritten Läuten anfangt.“
Verstört, weil er ungehorsam gewesen war, fiel der Feldhüter, der zugleich Glöckner war, auf seine Füße zurück. Er war ein Männlein von fünfzig Jahren mit dem eckigen und gegerbten Schädel eines alten Soldaten, mit grauem Schnurrbart und Kinnbart und steifem, von den zu engen Kragen gleichsam ständig abgewürgtem Hals. Sehr betrunken bereits, verharrte er in Habt-Acht-Stellung, ohne sich eine Entschuldigung herauszunehmen.
Übrigens durchquerte der Priester das Kirchenschiff und warf dabei einen raschen Blick auf die Bänke. Es waren wenige Leute da. Links sah er erst nur Delhomme, der als Gemeinderatsmitglied gekommen war. Rechts, auf der Frauenseite, waren es höchstens ein Dutzend: er erkannte die dürre, sehnige und anmaßende Cœlina Macqueron; Flore Lengaigne, eine beleibte, weinerliche, weichliche und sanfte Frau; die lange, schwarzbraune, sehr schmutzige Bécu. Aber was ihn vollends in Zorn versetzte, war die Haltung der Marienjungfrauen auf der ersten Bank. Françoise saß dort zwischen zwei ihrer Freundinnen, Berthe, Macquerons Tochter, einer hübschen Brünetten, die in Cloyes als feines Fräulein erzogen worden war, und Suzanne, Lengaignes Tochter, einer häßlichen, unverschämten Blondine, die ihre Eltern bald zu einer Schneiderin in Châteaudun in die Lehre stecken würden. Alle drei lachten in ungebührlicher Weise. Und daneben stellte die arme Lise, üppig und rund, mit fröhlicher Miene angesichts des Altars das Ärgernis ihres Bauches zur Schau.
Schließlich betrat Abbé Godard die Sakristei, als er auch schon über Delphin und Nénesse stolperte, die Schubsen spielten, während sie die Meßkännchen zurichteten. Ersterer, der elfjährige Sohn von Bécu, war ein bereits sonnverbranntes und kräftiges munteres Bürschchen, das die Erde liebte und um der Feldarbeit willen die Schule sein ließ, während Erneste, Delhommes Ältester, ein schmächtiger und fauler Blondkopf im gleichen Alter, stets einen Spiegel in seiner Hosentasche hatte.
„Na, ihr Schlingel!“ rief der Priester. „Ihr glaubt wohl, ihr seid in einem Stall!“ Und zu einem großen hageren Mann gewandt, in dessen bleichem Gesicht ein paar gelbe Bartstoppeln standen und der die Bücher auf dem Brett in einem Schrank aufräumte, sagte er: „Wahrhaftig, Herr Lequeu, Sie könnten dafür sorgen, daß sie sich ruhig verhalten, wenn ich nicht da bin!“
Dies war der Schulmeister, ein Bauernsohn, der mit der Bildung den Haß auf seine Klasse eingesogen hatte. Er ging gewalttätig mit seinen Schülern um, behandelte sie wie Viehzeug und verbarg aufgeklärte Ideen vor dem Pfarrer und dem Bürgermeister unter untadeliger Steifheit. Er sang wohl im Kirchenchor, er nahm sich sogar der heiligen Bücher an, aber er hatte es trotz des Brauches ausdrücklich abgelehnt, die Glocke zu läuten, weil eine solche Verrichtung eines freien Mannes unwürdig sei.
„Ich habe keine Polizeigewalt in der Kirche“, antwortete er trocken. „Ah! Bei mir, da würde ich sie schon ohrfeigen!“ Und da der Abbé, ohne zu antworten, überstürzt das Meßgewand und die Stola überstreifte, fuhr er fort: „Eine stille Messe, nicht wahr?“
„Gewiß, nun aber rasch! – Ich muß bis halb elf in Bazoches zum Hochamt sein.“
Lequeu, der ein altes Meßbuch aus dem Schrank genommen hatte, schloß den Schrank wieder und ging, um das Buch auf den Altar zu legen.
„Machen wir schnell, machen wir schnell“, wiederholte der Pfarrer mehrmals und trieb Delphin und Nénesse zur Eile an.
Schwitzend und schnaufend, betrat er mit dem Kelch in der Hand wieder die Kirche, er begann die Messe, bei der die beiden Bengel mit den versteckten Blicken duckmäuserischer Faxenmacher ministrierten.
Es handelte sich um eine einschiffige Kirche mit rundem Gewölbe, die mit Eiche getäfelt war und infolge der Starrköpfigkeit, mit der der Gemeinderat jeden Kredit ablehnte, langsam immer mehr verfiel: das Regenwasser sickerte durch die zerbrochenen Schieferziegel des Dachwerks, große Flecke waren zu sehen, die auf die vorgeschrittene Fäulnis des Holzes schließen ließen; und im Chor, der durch ein Gitter abgeschlossen war, verschmutzte ein grünlicher Belag hoch oben die Fresken der Apsis, schnitt das Gesicht eines Ewigen Vaters entzwei, den Engel anbeteten.
Als sich der Priester mit ausgebreiteten Armen zu den Gläubigen umwandte, besänftigte er sich ein wenig, weil er sah, daß viele Leute gekommen waren, der Bürgermeister, dessen Stellvertreter, Gemeinderäte, der alte Fouan, Clou, der Hufschmied, der bei Singmessen Posaune blies. Mit würdiger Miene war Lequeu in der ersten Reihe geblieben. Zum Umfallen besoffen, bewahrte Bécu im Hintergrund die Steifheit eines Pfahls. Und besonders auf der Frauenseite waren die Bankreihen gut besetzt: Fanny, Rose, die Große, noch andere, so viele, daß die Marienjungfrauen, die sich nun mustergültig verhielten und die Nase in ihre Meßbücher steckten, hatten zusammenrücken müssen. Was aber dem Pfarrer besonders schmeichelte, war, daß er Herrn und Frau Charles mit ihrer Enkeltochter Elodie erblickte, Herr Charles im Überrock aus schwarzem Tuch, Frau Charles im grünen Seidenkleid, beide ernst und protzig, ein gutes Beispiel gebend.
Jedoch beschleunigte er seine Messe, verschluckte das Latein, stieß den Ritus um. Zur Predigt stieg er nicht auf die Kanzel, saß auf einem Stuhl mitten im Chor, stotterte, verhedderte sich, verzichtete darauf, den Faden wiederzufinden: die Beredsamkeit war seine schwache Seite, die Worte stellten sich nicht ein, er machte „Hm, hm!“, ohne jemals seine Sätze beenden zu können; das erklärte, weshalb ihn Monsignore seit fünfundzwanzig Jahren in der kleinen Pfarre Bazoches-le-Doyen vergaß. Und der Rest wurde runtergepfuscht, die Glöckchen bei der Wandlung bimmelten wie närrisch gewordene elektrische Signalglocken, er entließ seine Leute mit einem hingepeitschten „Ite missa est“.
Die Kirche hatte sich kaum geleert, als Abbé Godard wieder auftauchte; in seiner Hast hatte er den Dreispitz verkehrt aufgesetzt. Vor der Tür stand eine Gruppe Frauen, Cœlina, Flore, die Bécu, die sehr gekränkt waren, daß er mit ihnen so im Galopp umgesprungen war. Er verachtete sie also, daß er ihnen an einem hohen Feiertag nicht mehr gab?
„Hören Sie mal, Herr Pfarrer“, fragte Cœlina mit ihrer schrillen Stimme, während sie ihn anhielt, „Sie sind uns wohl böse, daß Sie uns wie ein richtiges Lumpenpaket abschieben?“
„Ach, na das wäre ja!“ antwortete er, „die Meinen warten auf mich ... Ich kann nicht gleichzeitig in Bazoches und in Rognes sein ... Besorgt euch einen eigenen Pfarrer, wenn ihr Hochämter wünscht.“
Das war der ewige Streit zwischen Rognes und dem Abbé, weil die Einwohner Rücksichten heischten und er sich dabei an seine strikte Pflicht hielt, einer Gemeinde gegenüber, die es ablehnte, die Kirche instand zu setzen, und wo ihn übrigens ständige Ärgernisse entmutigten. Auf die Marienjungfrauen zeigend, die gemeinsam weggingen, fuhr er fort:
„Und außerdem, geziemt sich denn das, heilige Handlungen mit einer Jugend, die keine Achtung vor den Geboten Gottes hat?“
„Sie sagen das doch hoffentlich nicht wegen meiner Tochter?“ fragte Cœlina mit zusammengebissenen Zähnen.
„Wegen meiner doch sicherlich auch nicht?“ fügte Flore hinzu.
Da brauste er auf, weil ihm das zuviel war:
„Ich sag das wegen der ich das sagen muß ... Das springt einem ja in die Augen. Seht euch so was an mit weißen Kleidern! Ich habe hier nicht eine Prozession, ohne daß eine Schwangere dabei ist ... Nein, nein, ihr würdet dem lieben Gott selber auf die Nerven fallen!“
Er ließ sie stehen, und die Bécu, die stumm geblieben war, mußte zwischen den beiden Müttern Frieden stiften, die sich aufgeregt ihre Töchter vorwarfen; aber sie stiftete Frieden mit so hämischen Andeutungen, daß sich der Streit verschlimmerte. Berthe, ah, ja, man würde schon sehen, wie das ausging mit ihren Samtblusen und ihrem Klavier! Und Suzanne, famose Idee, sie zur Schneiderin nach Châteaudun zu schicken, damit sie sich umlegen lasse!
Endlich frei, schoß Abbé Godard davon; da sah er sich der Familie Charles gegenüber. Sein Gesicht erstrahlte in einem breiten freundlichen Lächeln, er schwenkte weit seinen Dreispitz. Majestätisch grüßte der Herr, Madame machte ihre schöne Verneigung. Aber es war vorherbestimmt, daß der Pfarrer nicht fortkommen sollte, denn er war noch nicht am Ende des Platzes, als ihn eine neue Begegnung aufhielt. Eine große Frau von einigen dreißig Jahren war es, die wie gut fünfzig wirkte, mit spärlichen Haaren, ausdruckslosem, weichem, kleiegelbem Gesicht; und zerschlagen, ausgepumpt von zu schweren Arbeiten, schwankte sie unter einem Bündel Kleinholz.
„Palmyre“, fragte er, „warum seid Ihr nicht zur Messe gekommen an einem Tag wie Allerheiligen? Das ist sehr schlecht.“
Sie stöhnte auf:
„Sicherlich, Herr Pfarrer, aber wie soll ich das anstellen? – Mein Bruder friert, wir erfrieren zu Hause. Da bin ich losgegangen, um das hier an den Hecken aufzulesen.“
„Die Große ist also immer noch so hart?“
„Ach ja! Sie würde lieber verrecken, als uns ein Brot oder ein Scheit Holz hinzuwerfen.“ Und mit ihrer jammernden Stimme erzählte sie wieder einmal ihre Geschichte, wie ihre Großmutter sie beide fortgejagt, wie sie sich mit ihrem Bruder in einem verlassenen früheren Pferdestall hatte einqartieren müssen. Dieser krummbeinige, arme Hilarion hatte einen durch eine Hasenscharte verzerrten Mund und war trotz seiner vierundzwanzig Jahre so dumm, so einfältig, daß niemand ihm Arbeit geben wollte. Sie arbeitete also für ihn, arbeitete sich zu Tode, sie brachte für diesen Blödling eine leidenschaftliche Fürsorge, eine heldenhafte Mutterzärtlichkeit auf.
Während Abbé Godard ihr zuhörte, wurde sein dickes und schwitzendes Gesicht von ungewöhnlicher Güte verklärt, seine Zornesäuglein verschönten sich vor Mildtätigkeit, sein großer Mund zeigte eine schmerzensvolle Huld. Der furchtbare Wüterich, der stets mit einem Windesungestüm aufbrauste, war den Elenden leidenschaftlich zugetan, gab ihnen alles, sein Geld, seine Wäsche, seine Anzüge, so daß man in der Beauce nicht einen Priester gefunden hätte, dessen Soutane verschossener und geflickter war. Mit besorgter Miene durchwühlte er seine Taschen, er steckte Palmyre ein Hundertsousstück zu.
„Da! Versteckt das, ich habe nichts mehr für andere ... Und ich muß noch mal mit der Großen sprechen, da sie so schlecht ist.“ Diesmal enteilte er. Als ihm beim Wiederhinaufsteigen des Hanges auf der anderen Seite des Aigre die Luft wegblieb, nahm ihn glücklicherweise der Fleischer aus Bazoches-le-Doyen, der nach Hause fuhr, in seinem Wägelchen mit; und dicht über der Ebene hin und her geschüttelt, verschwand er mit dem tanzenden Schattenriß seines Dreispitzes, der sich gegen den fahlen Himmel abzeichnete.
Während dieser Zeit hatte sich der Platz vor der Kirche geleert, Fouan und Rose waren soeben zu sich nach Hause hinuntergegangen, wo sich bereits Grosbois befand. Kurz vor zehn Uhr trafen dann auch Delhomme und Jesus Christus ein; aber auf Geierkopf wartete man vergeblich bis Mittag, niemals konnte dieser verdammte Eigenbrötler pünktlich sein. Zweifellos hatte er unterwegs haltgemacht, um irgendwo zu Mittag zu essen. Man wollte sich darüber hinwegsetzen; dann bewirkte die dumpfe Angst, die er mit seinem Dickkopf einflößte, daß beschlossen wurde, die Auslosung erst nach dem Mittagessen, gegen zwei Uhr, vorzunehmen. Grosbois, der von den Fouans ein Stück Speck und ein Glas Wein annahm, trank die Flasche aus, riß eine andere an, war in seinen üblichen Rauschzustand zurückgefallen.
Um zwei Uhr noch immer kein Geierkopf. Da ging Jesus Christus in dem Bedürfnis nach Fressen und Saufen, das das Dorf an diesem Feiertagssonntag schlapp werden ließ, bei Macqueron vorbei und machte einen langen Hals; und das hatte Erfolg, die Tür wurde jäh aufgestoßen, Bécu zeigte sich und schrie:
„Komm, Sauhaufen, damit ich dir einen Schoppen spendiere!“ Er war noch steifer geworden, war um so würdevoller, je mehr er sich betrank. Für den Wilddieb hegte er die brüderlichen Gefühle eines ehemaligen Militärsaufsacks und eine geheime Zärtlichkeit; aber er kannte ihn nicht, wenn er im Amt war und sein Schild am Jackenärmel hatte, immer drauf und dran, ihn auf frischer Tat zu ertappen, so daß er zwischen seiner Pflicht und seinem Herzen hin und her gerissen wurde. In der Schenke hielt er ihn brüderlich frei, sobald er besoffen war. „Eine Partie Pikett, he, willst du? Und zum Himmeldonnerwetter, wenn die Beduinen uns dumm kommen, schneiden wir ihnen die Ohren ab.“
Sie ließen sich an einem Tisch nieder, spielten laut schreiend Karten, während die Literflaschen eine nach der anderen leergetrunken wurden.
Macqueron mit seinem dicken schnurrbärtigen Gesicht drehte, in einer Ecke zusammengesackt, die Daumen. Seit er durch seine Spekulation mit den geringen Weinen aus Montigny ein Vermögen verdient hatte, das Jahreszinsen abwarf, war er der Faulheit verfallen, jagte, fischte, spielte den Bürger; und er blieb sehr dreckig, in Lumpen gekleidet, während seine Tochter Berthe rings um ihn überall Seidenkleider herumschleppte. Wenn seine Frau auf ihn gehört hätte, hätten sie den Laden und die Krämerei und die Schenke zugemacht, denn er wurde eingebildet bei seinen noch unbewußten, dumpfen ehrgeizigen Neigungen; aber seine Frau war von einer wilden Gewinngier, und er selber ließ sie, während er sich mit nichts beschäftigte, weiterhin Schoppen ausschenken, um seinen Nachbarn Lengaigne zu ärgern, der den Tabakladen hatte und ebenfalls Getränke anbot. Das war eine alte Nebenbuhlerschaft, die niemals erloschen und immer drauf und dran war, neu aufzuflammen. Allerdings gab es Wochen, in denen man in Frieden lebte; und gerade kam Lengaigne mit seinem Sohn Victor herein, einem großen linkischen Burschen, der bald sein Los ziehen mußte. Lengaigne selber, der sehr lang war, steif aussah und auf breiten, knochigen Schultern einen kleinen Eulenkopf hatte, bestellte seine Äcker, während seine Frau den Tabak abwog und den Wein aus dem Keller holte. Was ihm Ansehen verschaffte, war der Umstand, daß er das Dorf rasierte und allen die Haare schnitt, ein vom Kommiß mitgebrachter Beruf, den er inmitten der Gäste oder in der Wohnung ausübte, wie seine Kunden es wünschten.
„Na, wie ist’s mit dem Bart, paßt es heute, Gevatter?“ fragte er gleich an der Tür.
„Richtig, stimmt, ich hab dir gesagt, du sollst kommen“, rief Macqueron aus. „Ja natürlich, sofort, wenn’s dir beliebt.“
Er hakte ein altes Barbierbecken von der Wand, nahm ein Stück Seife und laues Wasser, während der andere ein Rasiermesser, das so groß wie ein Hirschfänger war, aus seiner Tasche holte und es auf einem am Etui angebrachten Leder abzuziehen begann. Aber eine keifende Stimme kam aus dem Krämerladen nebenan.
„Hört mal“, schrie Cœlina, „wollt ihr etwa euern Dreck da auf den Tischen machen? – Ah, nein, ich mag nicht, daß man bei mir Barthaare in den Gläsern findet!“ Das war ein Angriff auf die Sauberkeit der Schenke nebenan, wo man mehr Haare aß als man echten Wein trank, wie sie sagte.
„Verkauf dein Salz und deinen Pfeffer und laß uns in Frieden!“ antwortete Macqueron, verärgert über diese Zurechtweisung vor allen Leuten.
Jesus Christus und Bécu grinsten. Abgeblitzt, die bessere Hälfte! Und sie bestellten einen neuen Liter bei ihr, den sie wütend und ohne ein Wort brachte. Sie mischten die Karten, sie knallten sie so heftig auf den Tisch, als wollten sie sich gegenseitig totschlagen. Und Trumpf und Trumpf und Trumpf!
Lengaigne hatte bereits seinen Kunden eingeseift und hielt ihn an der Nase, als Lequeu, der Schulmeister, die Tür aufstieß. „Guten Abend, alle miteinander!“
Er blieb stumm am Ofen stehen, um sich das Kreuz zu wärmen, während sich der junge Victor hinter den Spielern in den Anblick ihres Spiels vertiefte.
„Was ich sagen wollte“, fing Macqueron wieder an, eine Minute ausnützend, in der ihm Lengaigne den Schaum von seinem Rasiermesser an der Schulter abwischte, „Herr Hourdequin hat vorhin vor der Messe noch zu mir von dem Weg gesprochen ... Man müßte sich doch entscheiden.“
Es handelte sich um den famosen direkten Weg von Rognes nach Châteaudun, der die Entfernung um ungefähr zwei Meilen abkürzen sollte, denn die Wagen waren bisher gezwungen, über Cloyes zu fahren. Natürlich hatte man auf La Borderie großes Interesse an dieser neuen Verkehrsverbindung, und um den Gemeinderat mitzureißen, rechnete der Bürgermeister sehr auf seinen Stellvertreter, der auch an einer raschen Lösung interessiert war. Es war tatsächlich die Rede davon, den Weg mit der Landstraße unten zu verbinden, was den Wagen die Auffahrt zur Kirche erleichtern würde, zu der man nur auf Ziegenpfaden kletterte. Die geplante Absteckung sollte einfach der zwischen den beiden Schenken eingeengten Gasse folgen, sie erweitern und dabei den Abhang aussparen; und die Grundstücke des Kolonialwarenhändlers, die dann unmittelbar am Wege liegen und leicht zugänglich sein würden, bekämen den doppelten Wert.
„Ja“, fuhr er fort, „es scheint, daß die Regierung, um uns zu helfen, darauf wartet, daß wir über irgend etwas abstimmen ... Nicht wahr, du machst doch mit?“
Lengaigne, der Gemeinderatsmitglied war, aber nicht ein Stück Garten hinter seinem Haus hatte, antwortete:
„Mir, mir ist das egal! Was schert mich dein Weg?“ Und die andere Wange in Angriff nehmend, deren Leder er wie mit einer Raspel abschabte, kam er auf das Gehöft La Borderie zu sprechen. Ach, diese Bürgersleute heutzutage, die waren schlimmer noch als die adligen Herren von einst: ja, sie hatten alles für sich behalten bei der Aufteilung, und sie machten Gesetze nur für sich, sie lebten nur vom Elend der armen Leute!
Die andern hörten ihm zu, verlegen und im Grunde glücklich über das, was er auszusprechen wagte: den jahrhundertealten unbezähmbaren Haß der Bauern gegen die großen Grundbesitzer.
„Nur gut, weil wir unter uns sind“, murmelte Macqueron und warf einen besorgten Blick zum Schulmeister hinüber. „Ich, ich bin für die Regierung ... So hat unser Deputierter, Herr de Chédeville, der, wie es heißt, der Freund des Kaisers ist ...“
Sofort fuchtelte Lengaigne wütend mit seinem Rasiermesser herum.
„Noch ein reizender Strolch, der da! – Sollte euch so ein reicher Knopp wie er, der mehr als fünfhundert Hektar in der Gegend von Orgères besitzt, nicht euern Weg zum Geschenk machen, anstatt Sous aus der Gemeinde ziehen zu wollen? – Dreckiger Leuteschinder!“
Aber entsetzt erhob der Krämer dieses Mal Einspruch:
„Nein, nein, er ist sehr ehrbar und nicht stolz ... Ohne ihn hättest du deinen Tabakladen nicht bekommen. Was würdest du sagen, wenn er ihn dir wieder wegnähme?“
Jäh beruhigt, machte sich Lengaigne wieder daran, ihm das Kinn zu schaben. Er war zu weit gegangen, er geriet in Wut: seine Frau hatte recht, wenn sie sagte, daß diese Ideen ihm noch einen bösen Streich spielen würden.
Und man hörte alsdann einen Streit, der zwischen Bécu und Jesus Christus ausgebrochen war, Bécu war im Rausch böse, zänkisch, während Jesus Christus im Gegenteil, so ein furchtbarer Taugenichts er in nüchternem Zustand auch war, bei jedem Glas Wein mehr gerührt und von der Sanftmut und der Gutmütigkeit eines Säuferapostels überkommen wurde. Man mußte außerdem ihre grundlegende Verschiedenheit der Meinungen hinzurechnen: der Wilddieb war Republikaner, ein Roter, wie man sagte, der sich brüstete, er habe 1848 in Cloyes die Bürger den Rigaudon tanzen lassen; der Feldhüter huldigte einem grimmigen Bonapartismus, vergötterte den Kaiser, den er zu kennen behauptete.
„Ich schwöre dir, daß das stimmt! Wir haben zusammen einen Salzheringssalat gegessen. Und da hat er zu mir gesagt: ‚Kein Wort, ich bin der Kaiser ...ʻ Ich habe ihn recht wohl erkannt, nach seinem Bild auf den Hundertsousstücken.“
„Möglich! – Trotzdem ein Schurke, der seine Frau schlägt und niemals seine Mutter geliebt hat.“
„Schweig, Himmelsakrament! Oder ich schlag dir die Fresse ein!“
Man mußte Bécu das Literglas aus den Händen reißen, das er schwenkte, während Jesus Christus mit feuchten Augen in einer lächelnden Ergebenheit den Hieb erwartete. Und sie fingen wieder an, brüderlich zu spielen. Und Trumpf und Trumpf und Trumpf!
Macqueron, den die betonte Gleichgültigkeit des Schulmeisters verwirrte, fragte ihn schließlich:
„Und Sie, Herr Lequeu, was meinen Sie dazu?“
Lequeu, der seine langen bleichen Hände am Ofenrohr wärmte, setzte das saure Lächeln eines überlegenen Menschen auf, den seine Stellung zum Schweigen zwingt.
„Ich, ich meine nichts dazu, das geht mich nichts an.“
Alsdann tauchte Macqueron sein Gesicht in eine Schüssel Wasser, und prustend sagte er, während er sich abtrocknete:
„Na schön! Hört zu, ich will euch mal was sagen ... Ja, Himmelsakrament, wenn man für die Straße stimmt, gebe ich meinen Grund und Boden umsonst.“
Diese Erklärung verblüffte die anderen. Sogar Jesus Christus und Bécu hoben trotz ihres Rausches den Kopf. Schweigen entstand, man sah ihn an, als sei er plötzlich verrückt geworden; und von der erzielten Wirkung aufgepeitscht, wobei ihm jedoch die Hände zitterten wegen der Verpflichtung, die er einging, fügte er hinzu:
„Es wird gut ein halber Arpent sein ... ein Schwein, wer sein Versprechen zurücknimmt! Das ist ein Schwur!“
Lengaigne ging mit seinem Sohn Victor fort, hochgebracht und krank von dieser Großzügigkeit des Nachbarn: die Erde kostete den andern kaum etwas, er hatte die Leute genug bestohlen! Macqueron nahm trotz der Kälte seine Flinte vom Haken, ging hinaus, um zu sehen, ob er einem Kaninchen begegne, das er am Vortage am Ende seines Weinbergs erblickt hatte. Es blieben nur noch Lequeu, der hier seine Sonntage verbrachte, ohne irgend etwas zu trinken, und die beiden versessenen Spieler, die die Nase in den Karten hatten. Stunden verflossen, andere Bauern kamen und gingen wieder.
Gegen fünf Uhr stieß eine rohe Hand die Tür auf, und Geierkopf erschien, dem Jean folgte. Sobald er Jesus Christus erblickt hatte, schrie er:
„Ich hätte um zwanzig Sous gewettet ... Machst du dich über die Leute lustig? Wir warten auf dich.“
Aber geifernd und sich erheiternd antwortete der Trunkenbold:
„Ach, verdammter Spaßvogel, ich, ich warte auf dich ... Seit heute früh versetzt du uns.“
Geierkopf hatte auf La Borderie Rast gemacht, wo Jacqueline, die er seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr auf dem Heu umlegte, ihn zurückgehalten hatte, weil er mit Jean Weinbrote essen sollte. Da der Hofbesitzer Hourdequin nach der Messe zum Mittagessen nach Cloyes gegangen war, hatte man sehr lange geschwelgt, und die beiden jungen Männer, die sich an diesem Abend nicht mehr trennten, trafen eben erst ein.
Indessen brüllte Bécu, daß er die fünf Liter bezahle, daß das aber eine Partie sei, die fortgesetzt werden müsse, während Jesus Christus, nachdem er sich mühselig von seinem Stuhl losgeeist hatte, mit in Sanftmut schwimmenden Augen seinem Bruder folgte.
„Warte hier“, sagte Geierkopf zu Jean, „und komm in einer halben Stunde nach ... Du weißt, daß du mit mir beim Vater zu Abend ißt.“
Bei den Fouans waren, als die beiden Brüder die Wohnstube betreten hatten, alle vollzählig versammelt. Der Vater stand da und hielt den Kopf gesenkt. Die Mutter saß am Tisch in der Mitte der Stube und strickte mechanisch. Grosbois, ihr gegenüber, hatte soviel getrunken und gegessen, daß er mit halb offenen Augen eingeschlummert war, während weiter entfernt Fanny und Delhomme auf zwei niedrigen Stühlen geduldig warteten. Und etwas Seltenes in dieser verrauchten Stube mit den alten armseligen Möbeln, den paar vom Saubermachen abgenutzten Hausgeräten: ein Blatt weißes Papier, ein Tintenfaß und eine Feder lagen auf dem Tisch neben dem Hut des Landvermessers, einem monumentalen, fuchsrot verschossenen schwarzen Hut, den er seit zehn Jahren bei Regen und Sonnenschein mit sich herumschleppte. Die Nacht brach herein, das schmale Fenster spendete einen letzten schmutzigen Lichtschein, in dem der Hut mit seiner flachen Krempe und seiner Urnenform eine ungewöhnliche Bedeutung annahm.
Aber trotz seines Rausches immer bei seinem Geschäft, wachte Grosbois auf und stammelte:
„Nun wären wir soweit ... Ich sage euch, daß das Schriftstück fertig ist. Ich bin gestern bei Herrn Baillehache vorbeigekommen, er hat es mir gezeigt. Bloß hinter euern Namen sind die Nummern der Parzellen noch nicht eingesetzt ... Wir werden sie also jetzt verlosen, und der Notar braucht sie nur noch einzutragen, damit ihr Sonnabend bei ihm das Schriftstück unterzeichnen könnt.“ Er schüttelte sich, hob die Stimme: „Na los, ich werde die Zettel zurechtmachen.“
Mit einer jähen Bewegung kamen die Kinder näher, ohne daß sie dabei versuchten, ihr Mißtrauen zu verbergen. Sie paßten auf ihn auf, beobachteten die geringsten Handbewegungen, als seien es die eines Taschenspielers, der imstande ist, die Teile verschwinden zu lassen. Zunächst hatte er mit seinen dicken zitternden Alkoholikerfingern das Stück Papier in drei Teile geschnitten; dann schrieb er auf jedes Stück eine riesige Zahl – 1, 2, 3 – und drückte dabei sehr auf; und über seine Schultern hinweg folgten alle der Feder; befriedigt, festzustellen, daß keine Mogelei möglich war, nickten selbst der Vater und die Mutter mit dem Kopf. Die Zettel wurden langsam zusammengefaltet und in den Hut geworfen.
Schweigen herrschte, feierliches Schweigen.
Nach reichlich zwei Minuten sagte Grosbois:
„Ihr müßt euch endlich entscheiden ... Wer macht den Anfang?“
Niemand rührte sich. Die Finsternis nahm zu, der Hut schien in diesem Dunkel größer zu werden.
„Dem Alter nach, wollt ihr?“ schlug der Landvermesser vor. „Du, Jesus Christus, du bist der Älteste.“
Gutmütig trat Jesus Christus vor, aber er verlor das Gleichgewicht und wäre beinahe hingefallen. Er hatte die Faust mit einer heftigen Anstrengung in den Hut versenkt, als gelte es, einen Felsblock herauszuholen. Als er den Zettel in der Hand hielt, mußte er ans Fenster treten.
„Zwei!“ schrie er und fand zweifellos diese Zahl besonders schrullig, denn ihm blieb die Luft weg vor Lachen.
„Du, Fanny!“ rief Grosbois auf.
Als Fanny die Hand tief drin hatte, ließ sie sich Zeit. Sie wühlte, rührte die Zettel um, wog einen gegen den andern ab.
„Es ist verboten auszusuchen“, sagte Geierkopf wütend, dem die Leidenschaft die Kehle zuschnürte und der bleich geworden war bei der Nummer, die sein Bruder gezogen hatte.
„Sieh mal einer an! Warum denn?“ entgegnete sie. „Ich guck nicht hin, fühlen kann ich wohl.“
„Laß sein“, murmelte der Vater, „das bleibt sich gleich, der eine Zettel ist nicht schwerer als der andere.“
Sie entschloß sich endlich, lief vor das Fenster.
„Eins!“
„Na schön, da hat also Geierkopf die drei“, fuhr Fouan fort. „Zieh sie, mein Junge.“
In der zunehmenden Finsternis hatte man nicht sehen können, wie sich das Gesicht des Jüngsten verzerrte. Seine Stimme platzte los vor Zorn:
„Nie und nimmer!“
„Wieso?“
„Wenn ihr glaubt, daß ich annehme, ah, nein! – Das dritte Los, nicht wahr? Das schlechte Los! Ich habe euch zur Genüge gesagt, daß ich anders teilen wollte. Nein! Nein! Ihr macht euch über mich lustig! – Und überhaupt, glaubt ihr, ich durchschaue eure Schliche nicht? Hätte nicht der Jüngste als erster sein Los ziehen müssen? – Nein! Nein! Ich ziehe nicht, weil gemogelt wird!“
Der Vater und die Mutter sahen zu, wie er sich ereiferte, mit Füßen und Fäusten um sich schlug.
„Mein armes Kind, du wirst verrückt“, sagte Rose.
„Ach, Mutter, ich weiß genau, daß Ihr mich nie habt leiden können. Ihr würdet mir die Haut vom Leibe ziehen, um sie meinem Bruder zu geben ... Ihr alle, ihr würdet mich auffressen ...“
Fouan unterbrach ihn hart:
„Genug Dummheiten, he! – Willst du ziehen?“
„Ich will, daß man noch mal von vorn anfängt.“
Aber man erhob allgemein Einspruch. Jesus Christus und Fanny umklammerten ihre Zettel, als trachte man, sie ihnen zu entreißen. Delhomme erklärte, daß es bei der Verlosung ehrlich zugegangen sei, und sehr gekränkt redete Grosbois davon, fortzugehen, wenn man seine Redlichkeit in Verdacht ziehe.
„Dann will ich, daß der Vater zu meinem Teil tausend Francs von dem Geld aus seinem Versteck hinzulegt.“
Der Alte, der einen Augenblick verdutzt war, stammelte. Furchtbar richtete er sich wieder hoch, trat vor.
„Was sagst du? Du legst es also darauf an, mich umzubringen, schlimmer Kerl! Man könnte das Haus abreißen und würde nicht einen Liard finden ... Nimm das Los, Himmelsakrament, oder du kriegst gar nichts!“
Aber Geierkopf mit seinem eigensinnigen Schädel wich vor der erhobenen Faust seines Vaters nicht zurück.
„Nein!“
Das Schweigen sank wieder herab, beklommenes Schweigen. Nun war der riesige Hut hinderlich, der sich mit diesem einzigen Los auf dem Grunde, das niemand anrühren wollte, den Dingen in den Weg stellte. Um dem ein Ende zu machen, riet der Landvermesser dem Alten, es selber zu ziehen. Und ernst zog es der Alte, ging vors Fenster, um es zu lesen, als wäre es ihm nicht bekannt gewesen.
„Drei! – Du hast das dritte Los, hörst du? Das Schriftstück ist fertig, todsicher wird Herr Baillehache nichts daran ändern, denn was getan ist, kann nicht noch mal getan werden ... Und da du hier schläfst, geb ich dir die Nacht zum Überlegen ... Los, es ist zu Ende, reden wir nicht mehr darüber.“
Geierkopf, den die Finsternis ertränkte, antwortete nicht.
Die anderen stimmten geräuschvoll zu, während sich nun die Mutter entschloß, eine Kerze anzuzünden, um den Tisch zu decken.
Und in diesem Augenblick gewahrte Jean, der sich wieder zu seinem Kumpel begab, zwei Schatten, die sich umschlungen hielten und von der menschenleeren und schwarzen Landstraße aus spähten, was man bei Fouans mache. Am schieferfarbenen Himmel begannen Schneeflocken zu stieben, schwerelos wie Federn.
„Oh, Herr Jean“, sagte eine sanfte Stimme, „Ihr habt uns Angst eingejagt!“
Da erkannte er Françoise, in eine Kapuze vermummt, mit den üppigen Lippen in dem langen Gesicht. Sie preßte sich an ihre Schwester Lise, hielt sie mit einem Arm umfaßt. Die beiden Schwestern vergötterten einander, man traf sie immer so, die eine am Halse der andern. Lise, die größere, die trotz ihrer groben Züge und der beginnenden Aufgedunsenheit ihrer ganzen rundlichen Person freundlich aussah, blieb lustig in ihrem Unglück.
„Ihr spioniert also?“ fragte er heiter.
„Freilich!“ antwortete sie, „das interessiert mich, was da drin vor sich geht ... Möchte wissen, ob das Geierkopf zu einem Entschluß bringt!“
Mit einer liebkosenden Bewegung hatte Françoise mit ihrem anderen Arm den aufgetriebenen Bauch ihrer Schwester umschlossen.
„Das Schwein, mit Verlaub zu sagen! – Wenn er Land besitzt, wird er vielleicht ein reicheres Mädchen haben wollen.“
Aber Jean machte ihnen Hoffnung: die Teilung dürfte beendet sein, das übrige würde man regeln. Als er ihnen dann mitteilte, daß er bei den Alten esse, sagte Françoise noch:
„Na schön, wir werden uns nachher wiedersehen, wir kommen zum Feierabend.“
Er sah zu, wie sie sich in der Nacht verloren. Der Schnee fiel dichter, auf ihre Kleidungsstücke, die nicht mehr zu unterscheiden waren, legte sich ein Besatz aus feinem weißem Flaum.