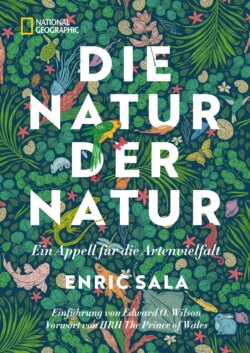Читать книгу Die Natur der Natur - Enric Sala - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. KAPITEL
WAS IST EIN ÖKOSYSTEM?
KORSIKA, DIE GRANITINSEL IM westlichen Mittelmeer, gehört zu meinen liebsten Orten auf der Welt. Als ich 1993 im Zuge meiner Dissertation zum ersten Mal dorthin kam, war das, »als würde man im Mittelmeer 500 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen«, wie mich mein Doktorvater Charles-François Boudouresque gewarnt hatte.
Ich hatte die Sommer meiner Kindheit in Küstenstädten mit Betonmauern und dicht bevölkerten Stränden verbracht. Selbst meine Lieblingsbuchten, wo ich schon früh das Meeresleben beobachtet hatte, waren von Häusern, Hotels und Apartmentanlagen umgeben. Korsika war anders. Es war kurz vor Sonnenaufgang, als sich die Fähre vom französischen Festland der Küste von Ajaccio im Südwesten der Insel näherte. Verschlafen, aber voller Ehrfurcht stand ich an Deck. Vor uns lag das stolze, wilde Korsika, auf dem von der menschlichen Besiedelung kaum etwas zu erkennen war. Als die Sonne über die Berge stieg, trug ein warmer Windhauch Inselgerüche heran, die meine Augen mit Tränen füllten. Noch heute erinnere ich mich daran: Wacholder, Lorbeer, Rosmarin, Myrte, Salbei, Minze, Thymian und Lavendel – die Essenz der Macchia auf Korsika. Das war der Beginn einer Liebesgeschichte, die bald zum Wesenskern meiner wissenschaftlichen Bestrebungen werden sollte.
Ich schätze mich äußerst glücklich, dass ich in Begleitung einer Handvoll treuer Freunde und Kollegen oft das Naturschutzgebiet Scandola an der Nordwestküste aufsuchen konnte. Viele sind im Lauf der Jahre zu unseren wissenschaftlichen Forschungen gestoßen, ursprünglich aber waren wir ein eingeschworener Freundeskreis, Leute, die auch meine Mentoren und Kollegen waren: Kike Ballesteros, der mir vieles über Algen und Naturgeschichte beibrachte; Mikel Zabala, ein fabelhafter Naturforscher und Professor der Ökologie an der Universität Barcelona, der meine Dissertation mit begleitet hatte; und Joaquim Garrabou, der damals ebenfalls an einer Dissertation über die Veränderungen ökologischer Gemeinschaften abhängig von der Wassertiefe schrieb. Gemeinsam war uns allen: Wir waren begeisterte Taucher, wir waren fasziniert von der Natur, und keiner von uns konnte die Füße still halten. Da wir alle grüne Neoprenanzüge trugen, nannten wir uns – in Anlehnung an das berühmte US-Basketballteam, das 1992 bei den olympischen Spielen in Barcelona die Goldmedaille gewann – das »grüne Team«.
Meistens fanden unsere Feldforschungen im Oktober statt, wenn die wenigen Touristen fort waren und die Verwaltung des Naturschutzgebiets sich auf unsere Arbeit konzentrieren konnte. Oktober auf Korsika ist immer Glücksache. Man wusste nie, wie das Wetter sein würde. Manchmal hatten wir Sonne und ein ruhiges Meer, manchmal aber auch stürmische Winde und raue See, was verhinderte, dass wir unsere Tauchgründe aufsuchen konnten. Aber wir waren nie müßig. Wenn das Meer sich uns verweigerte, erkundeten wir die alten Eichenwälder und sammelten Pilze – meistens köstliche Steinpilze, Pfifferlinge und Kaiserlinge. Oder wir streiften durch die Pinienwälder entlang der verlassenen Strände oder gingen in den spektakulären Granitbergen wandern, die sich mit dem Monte Cintu bis auf eine Höhe von 2700 Metern über dem Meeresspiegel erheben.
ERSTELLT MAN EIN TRANSEKT unserer Tauchgänge und Wanderungen entlang einer Höhenlinie, könnte man daran gut die Verteilung der korsischen Pflanzen- und Tierwelt zeigen. 60 Meter unterhalb der Wasseroberfläche finden sich ganze Wälder mit weißen und roten Gorgonien sowie gelben Schwämmen, die wie Orgelpfeifenkakteen aussehen. In 50 Metern Tiefe werden sie von Braunalgen abgelöst. Mit ihrem knorrigen Stamm und ihren Zweigbüscheln, die scheinbar aus einem Olivenkern herauswachsen, gleichen sie Miniatur-Olivenbäumen. In etwa 30 Metern Tiefe folgt auf sie eine andere Braunalgenart. Diese besitzt einen daumendicken Stamm und wird von Palmwedeln gekrönt. Je näher wir der Oberfläche kommen, desto mehr dominieren andere Algenarten, die ihre eigenen Wälder bilden. Die Tierwelt folgt einem ähnlichen Muster. Gorgonien leben tiefer, Seeigel näher an der Oberfläche. Manche Fische wie die Goldstriemen bewegen sich in unterschiedlichen Tiefen, die meisten Arten aber lassen sich in einem eng umgrenzten, vorhersagbaren Bereich finden.
Nachdem wir das Wasser verlassen haben, klettern wir über rotes Vulkangestein, auf dem dunkelgrüne Sträucher und die aromatischen Kräuter wachsen, deren Duft mich zu Tränen gerührt hat – und der immer nostalgische Gefühle wecken wird, wenn ich nur daran denke. Oder wir wenden uns nach links, gehen über einen Sandstrand, vorbei an Pinien, Korkeichen und Steineichen und treffen auf einen nicht gestauten Fluss, in dem Süßwasserschildkröten leben und der von einem Auwald gesäumt wird. Wenn wir nun aufsteigen, begegnen uns See-Kiefern, zwischen denen Flaumeichen, Traubeneichen, Herzblättrige Erlen und Edelkastanien stehen, dazu gibt es eine große Vielfalt an Pilzen, die wir gesammelt und verspeist haben, wenn das Wetter Tauchgänge nicht erlaubte. Weiter oben in den Bergen werden diese Laubwälder an Südhängen von Schwarzkiefernwäldern abgelöst, an den Nordhängen von Weißtannen und Hängebirken. Über der Waldgrenze, bei etwa 2000 Metern, finden wir eine Strauchlandschaft mit Grünerlen, Wacholder, Bergahorn und Birken vor. Noch weiter oben wird es irgendwann zu kalt für große Pflanzen, dort sieht man nur noch Flechten, die stoisch den Granit besiedeln. Der Gipfel des Monte Cintu besteht aus nacktem Gestein – und ist im Winter mit viel Schnee bedeckt.
Ziehen wir Linien um die unterschiedlichen Arten der Pflanzen- und Tiergesellschaften, würden sie wie eine Reihe von etwa parallel verlaufenden Gürteln aussehen. Jede dieser einzigartigen Pflanzen- und Tiergruppierungen kann auch als ein unterschiedliches ökologisches System definiert werden – als ein Ökosystem.
EIN ÖKOSYSTEM IST NICHTS anderes als die Gemeinschaft lebender Organismen (Mikroben, Pflanzen und Tiere) und der Umwelt (das Habitat), die sie besetzen. Die Organismen und ihre Beziehungen untereinander bilden das, was Ökologen ein »Nahrungsnetz« nennen – grafisch lässt sich das als eine Collage aus sich überlappenden Nahrungsketten darstellen, in denen Räuber andere Räuber fressen, die sich von anderer Beute ernähren und die alle um Raum, Licht und sonstige Ressourcen konkurrieren. Aber diese Lebewesen besetzen nicht nur ihr Habitat, mag es Granit- oder Vulkangestein, ein Sandstrand oder eine Hochebene im Inland sein; tatsächlich schaffen sie sich ihr Habitat (Korallenriffe sind ein Beispiel dafür) und liefern damit Platz und Nahrung für viele andere Lebewesen. Wenn das Leben auf der Erde ein Wunder ist, dann ist es ein noch größeres Wunder, was das Leben hier bewirkt.
Ökosysteme wachsen und schrumpfen und altern, teilweise entwickeln sie sich sogar zurück zu einem jüngeren Zustand, der es inaktiven Arten ermöglicht, auch einmal einen Tag an der Sonne zu genießen. Ökosysteme sind niemals statisch. Sie regulieren sich selbst durch Rückkopplungsschleifen innerhalb der biologischen Gemeinschaft, aber auch zwischen lebenden Organismen und ihrem Habitat. Sie lassen es regnen und regulieren das Wetter. Sie füllen die Atmosphäre mit einem Gasgemisch, das uns atmen und überleben lässt. Sie filtern das saubere Wasser, das wir trinken. Sie schützen uns vor Überschwemmungen. Seit mehr als einem Jahrhundert schützen sie uns vor katastrophalem Klimawandel. Aber nur wenige haben das bemerkt.
Ökosysteme hatten Milliarden Jahre Zeit zum Experimentieren, sodass sie, durch Trial and Error und Selbstorganisation, zu den effizientesten Maschinen im Universum wurden. Sie wandeln sich fortlaufend und fluktuierten, vorhersehbaren Mustern folgend, innerhalb gewisser Grenzen – zumindest war das bis vor Kurzem so. Wir können nur äußerst begrenzt nachbilden, was Ökosysteme für uns leisten. Aber tote Ökosysteme ermöglichten es dem Menschen, sich zum Herrn des Lebens auf der Erde aufzuschwingen – und zu seinem Zerstörer. Diese Geschichten heben wir uns allerdings für später auf.
Nicht nur Wälder, Feuchtgebiete und Flüsse sind Ökosysteme, sondern auch unsere Städte. Das Habitat von New York City zum Beispiel ist zum größten Teil eine künstlich geschaffene Umgebung, die auf Asphalt, Beton, Glas und Stahl aufgebaut ist, dazwischen eingestreut ist ein wenig Vegetation. Bei der Tierwelt in der Stadt denken die meisten an Ratten, Eichhörnchen im Central Park oder an den komischen Wanderfalken, der auf dem Dach eines Bürogebäudes nistet und es mal wieder in die Schlagzeilen geschafft hat. Die Stadt New York ist aber auch Heimat Tausender Pflanzen- und Tierarten, die mit den fast neun Millionen Bewohnern zusammenleben. Zu ihnen gehören Kojoten, Eichhörnchen, Fledermäuse, Skunks, Beutelratten, Rotfüchse, Weißwedelhirsche, Schnappschildkröten, Carolina-Dosenschildkröten, Salamander und mehr als 200 Vogelarten. In den Gewässern um New York City und im Hudson leben 80 Fischarten. Selbst Buckelwale und Finnwale wurden schon gesichtet. Auch im klaustrophobischsten Betondschungel nistet sich das Leben ein.
Würden die Menschen New York überraschend verlassen, würde das künstlich errichtete Habitat einstürzen. Die Stadt ist im Untergrund wie ein Emmentaler, Dutzende Tunnel, 400 Kilometer U-Bahn, über 10.000 Kilometer Abwasserkanäle und Leitungen durchziehen den Boden. Ohne die 290 Pumpanlagen, die rund um die Uhr arbeiten und pro Minute mehr als 60.000 Liter Wasser vom Hudson, East River und der Upper Bay abpumpen, würden die Tunnel und die U-Bahn in relativ kurzer Zeit überflutet werden. Die Löcher im Emmentaler Käse würden sich noch vergrößern und schließlich zum Einsturz der Gebäude führen. Staub und Erdreich würden sich in den Löchern und Spalten an der Oberfläche sammeln, Pflanzen begännen den Schutt zu besiedeln. Die Tierwelt würde die Ruinenlandschaft übernehmen.
Das Leben – und die von ihm gebildeten Ökosysteme – besitzt die außerordentliche Fähigkeit zur Regeneration und Neubildung, selbst an den unwahrscheinlichsten Standorten. Jeder aus meiner Generation erinnert sich an die Explosion des Atomreaktors in Tschernobyl 1986. Trotz der heldenhaften Anstrengungen der sowjetischen Wissenschaftler, Soldaten und Bergleute, die Strahlung einzudämmen, musste die nahe gelegene Stadt Prypjat letztlich geräumt werden – für immer. Sogar Haustiere wurden getötet, damit sie die Strahlung nicht weitertrugen. Dann kam die Natur. Die Gebäude verfallen, werden von Sträuchern und Bäumen erobert, das Stadtgebiet ist das Revier der Wölfe. Das von Menschen errichtete Habitat kann ohne seine Erbauer nicht überleben. In einigen Tausend Jahren sieht Prypjat vielleicht aus wie die Maya-Stätten im Dschungel, die unter einer dichten Vegetationsschicht erst ausgegraben werden müssen.
ZOOMEN WIR VON DEN korsischen Wäldern hinaus, stoßen wir irgendwann an die Grenze zwischen Land und Meer. Zoomen wir weiter hinaus, erkennen wir, dass Korsika ein vom Mittelmeer umgebenes Insel-Ökosystem ist. Noch weiter, und das Mittelmeer selbst erscheint als eigenständiges Ökosystem mit klaren Grenzen im Norden (den Gebirgszügen der Alpen und Karpaten) und im Süden (der Sahara). Astronauten in der Internationalen Raumstation, die noch weiter hinausgezoomt haben, erkennen den ganzen Planeten als ein Ökosystem ohne sichtbare Grenzen bis auf jene zwischen Land und Wasser, Wüste und Vegetation, Städten und landwirtschaftlichen Flächen. Kein Wunder.
Der Begriff Ökosystem leitet sich vom altgriechischen Wort oikos ab, das »den Ort, an dem man wohnt«, bezeichnet, das »Haus«, aber auch die »Familie«. Der ganze Kreis. Aber wie funktioniert dieses lebende Wunder, wie unterhält es sich selbst? Wie können neun Millionen Lebewesen, die wir sehen, und eine Billion Mikrobenarten, die wir nicht sehen können, auf eine Art und Weise interagieren, damit Stabilität für den ganzen Planeten entsteht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz an den Anfang gehen. Bringen wir zwei Arten zusammen und sehen zu, was geschieht.