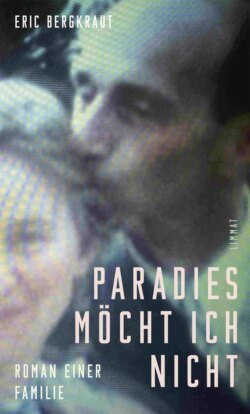Читать книгу Paradies möcht ich nicht - Eric Bergkraut - Страница 9
Halma im Oktober
ОглавлениеWenn Louise die Spielfigur bewegte und in ein neues Loch steckte, fiel mir auf, dass zwischen dem Handknochen im Vorlauf zum Zeigefinger und dem seitlichen Ansatz des Daumens gar kein Fleisch mehr war, nur Haut.
Mutter war dünn geworden, ich hatte sie ein paar Wochen lang nicht gesehen. Zum Tisch, vorne am Fenster, wo das Halmabrett stand, bewegte sie sich bevorzugt im Rollstuhl, manchmal ging sie an meinem Arm. In beiden Fällen drehte sich Louise eineinhalb Schritte vor dem Stuhl um und ließ sich, die Richtung einigermaßen einschätzend, rücklings in den Sitz plumpsen. Das machte mir jedes Mal Angst, erinnerte aber auch an den Moment, als ich erstmals gesehen hatte, wie der Hochspringer Dick Fosbury rücklings über eine Latte gesegelt war.
Das Spielfeld war eine runde Holztafel, ursprünglich vielleicht zur Benutzung als Schnittbrett in der Küche gedacht, mit regelmäßig eingebohrten Öffnungen. Als Spielfiguren dienten grüne und weiße Stifte mit feinen Rillen an den Seiten, nicht unähnlich jenen, die Ikea zur Montage von Gestellen mitliefert, womöglich waren es gar solche. Keine Ahnung, woher das Brett stammte, Mutter wusste es auch nicht, vielleicht aus einer Werkstatt handicapierter Menschen?
Mich erstaunte, wie Louise Sprünge nach vorne über Rückwärtszüge einleitete. Keck sei ich, meinte sie, wenn auch mir ein geschickter Zug gelang, beide wollten gewinnen, jedenfalls brauchte ich mich nicht absichtlich ungeschickt anzustellen, die zwei Züge, die ihr noch fehlten, als alle meine Figuren am Ziel waren, wollte Louise noch ausführen. Der Sportsgeist imponierte mir, und ich fragte mich, weshalb wir erst jetzt angefangen hatten, miteinander Halma zu spielen. Ich mochte die Ruhe, Konversation war nicht nötig, es war ein Spiel der Wiederholungen, auch wenn jede Konstellation einzig war.
Im dritten Stock des Hauses zur Bachwies, in dem sie jetzt lebte, ging es bunter zu als vorher im achten. Ein paar Bewohner hatten Ticks, ein Mann im Entree machte mit seinem rechten Arm stete Kreisbewegungen, ein anderer spielte ununterbrochen mit einer Perlenkette, wie man sie aus Griechenland kennt, andere lachten schrill oder schienen im Dauerschlaf. Insgesamt gab es hier, wie die leitende Ärztin sagte, weniger Kontrolle über die Psyche der Insassen und daher mehr Emotion als im achten Stock, wo sich die Damen und Herren dumpf von Medikamenten den ganzen Tag im Wohnzimmer aufhielten, meist ohne Regung.
Zuvor war Mutter immer wieder abgeprallt mit ihrem deutlichen Wunsch nach Austausch, nach Erfahrung. War sie die kleine Louise aus dem Chratz, war sie die Alte aus dem Heim, verloren war sie oft, verloren in der Zeit, verloren in der Welt. Zuletzt hatte sie aus ihrem Zimmer heraus durch die offene Tür so oft Hallohallo gerufen, dass es lästig geworden war. Man hatte beschlossen, ihre Rufe seien pathologisch und Mutter gehöre daher in den dritten Stock, wo ihre Rufe sich in den anderen verloren und vom Personal mit mehr Verständnis aufgenommen wurden.
Als ich mit Louise erstmals den Aufenthaltsraum betreten hatte, sagte sie: Es bedrückt mich, die sind alle meschugge, die Männer mehr noch als die Frauen, ich selber bin es auch, aber nur halb, lass uns ins Zimmer gehen.
Auf dem Weg hatte sich mir eine Clara vorgestellt und meine Hand geküsst wie auch jene von Juliette, die dabei war, und vorgeschlagen, später mit uns mitzukommen. Meine Tochter besuchte Louise gerne, auch ohne mich, die beiden konnten Stunden zusammen verbringen, der Großmutter gefiel, dass ihre Enkelin sich in die Bewegung zur Verteidigung der Umwelt eingereiht hatte. Sie war stolz darauf, dass Juliette immer wieder in den Klimastreik trat, obwohl die Schulleitung es ebenso verboten hatte wie irgendwann auch ich, ihr Vater. Amüsiert ließ sich Louise erzählen, wie die Lehrerin immer hilfloser nach einer passenden Strafe suchte.
Aus dem Gang schon hatte ich in Mutters Zimmer eine andere, füllige Frau entdeckt, die vorne am Fenster gemütlich am Brötchen kaute, das Juliette neben dem Halmabrett hatte liegen lassen. Sie und ich fanden das komisch, es war wie im Theater, Louise aber war durch die Frau verwirrt, ich bat sie aus dem Zimmer, täglich begleitete Mutter die Not, sie müsse den Ort wechseln, sie sei nirgends zu Hause.
Zur Welt gekommen war Louise fast einundneunzig Jahre vor diesem Halmaspiel in Albisrieden, heute ein Quartier von Zürich, damals ein Dorf. Im Chratz, dem Dorfteil gleich hinter der Kirche, bestehend aus lauter alten Fachwerkbauten, betrieb ihr Großvater das Restaurant Alperösli. Die Pöstler kehrten täglich zum Zvieri ein, Landjäger und Cervelat gab es, die Lehrer kamen zweimal jährlich zum Examensessen, ihnen wurde nobler Pot-au-feu serviert. Der Großvater, gelernter Schuhmacher, klein und untersetzt, mit Nickelbrille, war zugleich Friedensrichter, er sollte den Streit im Dorfe schlichten.
Während Großmutter Anna trotz insgesamt elf Kindern täglich für die Gäste kochte, stiegen zerstrittene Albisrieder über den Hintereingang in den ersten Stock. Dort war das enge Zimmer des Friedensmannes, der in seiner Doppelrolle eine Stütze der dörflichen Gesellschaft war, eine Respektsperson. Im «Alperösli» lernte Louises Mutter Lina ihren Mann kennen, Ernst, einen Turner aus Aarau, der mit seiner Riege nach einem Wettkampf auf ein Bier haltgemacht hatte.
Das Paar zeugte in schneller Folge vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen. Als meine Großmutter mit Louise schwanger war, der jüngsten, verließ Ernst seine Frau. Ein paar Wochen später musste sie die gemeinsame Wohnung im Aargau verlassen. Die Jungs durften beim Vater bleiben, eine neue Frau stand schon bereit, auch diese hatte er in einer Gaststätte kennengelernt, die Mädchen sollten mit der Mutter weg, egal wohin, einfach weg. Zwar schickte der Friedensrichter einen kleinen Lastwagen nach Aarau, aber Hab und Gut, seine Tochter und die beiden Enkelinnen waren im «Alperösli» nicht erwünscht. Eine Geschiedene war der Schmach zu viel, für sie war kein Platz im großen, heimeligen Haus des Friedensrichters.
Fünf Jahre lebte die verstoßene junge Frau auf dem Land, das Geld war knapp. Der Kindsvater schickte etwas Alimente, der Friedensrichter legte ein bisschen dazu und ließ sich endlich erweichen: Lina und ihre Töchter durften zurück. Glücklich zu Hause, trotz des Makels, verlassen worden zu sein, sprang Lina im Restaurant ein, wann immer es nötig war, und half rundum allen Menschen, wo immer sie konnte.
Nachbarskind Margrith machte jeden Morgen halt, wenn sie Louise zur Schule abholte; sie setzte nacheinander den rechten und dann den linken Fuß auf der Steintreppe ab, die zur kleinen Wohnung führte. Lina band ihr den Doppelknopf, den sie so gut konnte, und Louise freute sich, viel galt ihre geschiedene Mutter nicht in Albisrieden, in der Schule wurde sie ausgelacht.
«Margrithli», wie Lina sie immer nannte, kam nach der Schule oft mit in den Chratz, sie mochte meine Großmutter. Vom Wohnzimmer ging eine steile Treppe in den ersten Stock, ein Bälchli, oben schliefen Mutter und die jüngere Tochter in einem Zimmer. Hier erledigten die beiden Mädchen, die eine blond, die andere rot, ihre Schularbeiten. Die Familie war arm, mit dem Abendessen wartete Lina, bis Margrithli gegangen war, das Essen reichte nicht für ein weiteres Maul. Mag sein, dass Louises oft ausschweifende Gastfreundschaft hier ihren Ursprung hat; bis zur Aufdringlichkeit bot sie zu trinken an, Wein und anderes, sie liebte es, Zimmer mit so viel Betten auszustatten wie nur möglich, es konnte noch wer kommen.
Sie wuchs heran, ein waches Kind, das bald männliche Blicke auf sich zog. Coiffeur Huber, ein gebürtiger Basler, hatte seinen Salon gleich neben dem «Alperösli» des Großvaters, unter dem gleichen Dach. Vor dem ersten Haarschnitt – sie war neun oder zehn – zog er nicht nur Louise einen Umhang über, sondern auch sich selber. Er fasste mit der rechten Hand die Schere, griff mit der linken nach Louises Hand und führte sie unter die Kutte, wo sie etwas hart Fleischiges halten musste. So gehöre es sich bei ihm und zum Haarschnitt, erklärte er dem eingeschüchterten Mädchen. Was sie festzuhalten hatte, verstand sie lange nicht, niemand hatte mit ihr je über Derartiges gesprochen, sie lebte in einem Frauenhaushalt, und es gab keine auch nur ungefähre Anschauung. Es war ihr unangenehm, sehr, bei Huber, und mehr als das. Der Friseur keuchte, sein Atem schlug ihr stickig ins Gesicht, wenn er die Kopfseite wechselte, erneut nach ihrer Hand griff und sagte: Nicht loslassen.
Später bekniete Louise ihre Mutter, sie wünsche sich langes Haar. Es nützte nichts. Wenn man schon arm war, sollte man doch gepflegt daherkommen, meinte Lina. Ihrer Mutter zu erzählen, was sich im Salon abspielte, kam Louise nicht einmal in den Sinn. Sie begann eine kaufmännische Lehre, es ging weiter. Den Morgendienst eröffnete der Chef der Druckerei im Hinterzimmer, indem er Louise am ganzen Körper abtastete. Er hatte damit einfach angefangen und dann so getan, als sei es so abgemacht. Einmal, sie waren alleine im Betrieb, sollte sich die Fünfzehnjährige morgens nackt auf den Tisch legen, das war zu viel.
Niemand außer Margrith wusste, dass die Männer sich angewöhnt hatten, von Louise zu nehmen, was immer sie wollten. Und dass sie nicht wusste, wie sie sich wehren konnte. Louise begann, ihre Gedanken in ein schwarzes Heft zu schreiben, gekauft in der Papeterie Kaufmann beim Dorfplatz. Weder Lina noch ihre ältere Schwester sollten davon erfahren, Louise versteckte das Heft mal unter dem Holz, das im Vorraum zu den Toiletten gestapelt lag, mal unter ihren Kleidern im Schrank. Sie schrieb von Sünden, auch eigenen, und dass sie den nächsten Sonntag herbeisehne. Der liebe Gott war eine Instanz geworden, das Heft ihr Begleiter.
In Europa herrschte Krieg, zu Hause war es eng. Louise trat der kommunistischen Jugend bei, zugleich unterrichtete sie in der evangelischen Sonntagsschule. Hier waltete ein charismatischer Pfarrer, eine große Figur in Albisrieden, seine Kirche war nur einen Steinwurf vom Chratz entfernt. Er wurde die bewunderte Liebe, vielleicht auch der Vater, den sie sich gewünscht hätte. Ihm vertraute sie sich an, er fand eine neue Lehrstelle für sie. Die beiden spazierten auf den Uetliberg, den Haushügel von Zürich, sie sollte erzählen. Dann plötzlich zwang er sie zum Kuss. Mehr nicht?, fragte ich Louise irgendwann zwischen ihrem siebzigsten und achtzigsten Lebensjahr, als sie mir davon erzählte. Nein, sagte sie trocken, es war Winter, es lag Schnee.
Am Schauspielhaus, wo der Widerstand gegen das Nazitum lebte, sah Louise alle neuen Stücke, das war billig für Lehrlinge, fast umsonst. Sie schickte sich an, Goethes Faust auswendig zu lernen, Verse daraus blieben bis ins hohe Alter haften –, setzte sich dazu abends gerne auf eine Wiese oberhalb von Albisrieden, direkt an der Straße.
Eines Tages sprach sie dort ein Mann an, Jules mit Namen, elsässischer Emigrant, und zu Fuß unterwegs aus dem Lager Birmensdorf in die Stadt. Dass dieser Jules gerne mit Louise angebändelt hätte, war für sie ebenso deutlich wie ihr eigenes Gefühl, dass sie das nicht wollte. Jules schlug vor, einen Freund mitzubringen, Emigrant auch er, einen gebürtigen Wiener. Damit war Louise einverstanden, neugierig war sie, und es trat auf: Felix, mein Vater, es war April 1943.
Ein paar Tage nach dem Treffen mit Felix kritzelte sie in ihr Heft:
Ich bin fast restlos glücklich. Ja, es gibt wahrhaftig Männer, die verstehen wollen und können.
Auf dieses Heft, das sie womöglich auch später geheim hielt, stieß ich, als ich nach dem Halmaspiel etwas Ordnung machen und die Zeitung, die zwar nicht mehr gelesen, wohl aber geliefert wurde, in den Abfall spedieren wollte. Ich hatte es noch nie gesehen, fragte um Erlaubnis und begann, darin zu blättern. Vorne waren die ersten Ziffern verschiedener Telefonnummern notiert, auch die meiner eigenen; Louise fragte zuweilen mitten im laufenden Telefonat, wie die Nummer laute. In der Mitte des Hefts hatte sie offensichtlich Tagebuch geführt, etwa die Hälfte dieser Seiten fehlte, herausgerissen.
Auf der letzten Seite standen in jugendlich schwarzer Schrift nur ein paar Worte, genau in die Mitte gesetzt:
Schau, ich bin nur ein Internierter!
Felix wurde verlegt, nur drei Wochen nach dem ersten Treffen, er wurde in ein Lager in der Westschweiz beordert. Louise hatte freigenommen, zwei Stunden lang wartete sie im Schatten einer Platane hinter dem Bahnhof von Birmensdorf. Dann traf die Formation ein, Felix in der zweiten Reihe, lachte ihr zu. Ein paar Minuten waren sie alleine. Es sollte kein Abschied sein, das wussten beide. Louise wollte wissen, wohin die Reise ging, ob sie ihn besuchen könne. Bevor er in den Zug stieg, sagte Felix leise und kopfschüttelnd, die langen Arme mit offenen Handflächen zur Seite gestreckt:
Schau, ich bin nur ein Internierter!
Konnte er ahnen, dass er mit dieser Warnung Louises Herz gewonnen hatte?
Zu Hause im Chratz stieg sie in den ersten Stock, das schwarze Heft lag zwischen Unterlagen der Gewerbeschule Zürich Aussersihl:
«Zwei Menschen lösen ihre Hände, aus ihren Augen spricht die Qual, die heimlich sie im Herzen tragen: Sehen wir uns wohl z. letzten Mal? … Doch eins ist das Wunderbare, dass Menschenherzen gläubig schlagen: Ich bin bei Dir, für Dich bereit.»
Im Haus zur Bachwies hielt ich vierundsiebzig Jahre später das Heft in der Hand und fragte Louise: Hast du das geschrieben oder irgendwo abgeschrieben? Na hör mal, gab sie zurück, es gab welche, die meinten, ich könnte Schriftstellerin werden!
Sie war sechzehn, er sechsundzwanzig, sie eine beinahe noch unschuldige, temperamentvolle Christin und er ein lebenserfahrener, staatenloser Jude, der fünf Jahre lang um sein Leben gerannt war und eben seine Familie und sich selbst gerettet hatte. Er kannte die Liebe, war der leidenschaftlichen Begegnung fähig wie der Verbindlichkeit, glaube ich, und noch nie standen die Zeiten so gut für einen neuen Anfang. Louise trug, trotz allem, was sie erlebt hatte, in sich den Drang zu einem Ganzen, zu etwas Heilem gar, und wenn es die Kirchenglocken von Albisrieden waren, die den Klang gaben. Vielleicht dachte Felix schon an Kinder, die nie erleben sollten, was er kannte.
Ihn trieb nicht der Ehrgeiz einer beruflichen Karriere, sondern der Wunsch, eine Familie zu gründen, die er sich vorstellte als die Bewohner einer unzerstörbaren Nussschale im Sturm der Zeiten. Er sehnte sich nach einer unbelasteten Zukunft. Er war nicht der Einzige in Europa. Wusste er, wie kühn es war, dafür die eigene Familie zum Vehikel zu machen? Vielleicht spielte im Hintergrund Pfarrer R. eine Rolle, zog gar die Fäden: christliche Nächstenliebe gegen gottlose Barbarei, Louise als ihr Instrument.
Louise war angetan von der Kultur und vom Witz des vielsprachigen Weltgängers, so einen hatte sie im «Alperösli» nie getroffen, das gab es in Albisrieden nicht. Die beiden schrieben sich fast täglich, fürs schwarze Heft blieb keine Zeit. Zweimal reiste Louise in die Westschweiz, einmal kam Felix nach Zürich. Louise war weder kleinlich noch berechnend, es zählte nicht, dass Felix staatenlos war und ohne Beruf, nach drei Monaten war klar: Man wollte heiraten. Die kaufmännische Lehre sollte Louise zu Ende bringen, das war nur vernünftig.
Es war die Zeit des Aufbruchs, Louise war aufgekratzt. Im Tram mit den noch hölzernen Sitzen beobachtete Freundin Margrith auf dem Weg in die Schule, wie Louise gleichgültig in die Luft schauende Zürcher anging: Wie könnt ihr einfach so stumpf zur Arbeit fahren, wo Hitler doch massenhaft unschuldige Menschen abschlachtet, mitten in Europa, nicht weit von uns entfernt!
Endlich wurde deutlich, dass Hitler und seine Truppen den Krieg verlieren würden, bloß: wann? Zu gerne hätte Felix doch noch gekämpft, französische Militärpapiere hatte er ja. Womöglich spürte er, dass es gesünder wäre, den Hass ins Feld zu schicken, statt ihn durchs Leben zu tragen. Rundum rieten alle ab, sich einer jener französischen Einheiten anzuschließen, die den Kontinent mitbefreiten, zuvorderst die Kommunisten: Man müsse alle Kräfte sparen für den Aufbau der neuen, gerechten Welt, später, im alten Heimatland.
Nie wieder Krieg. Im Kongresshaus wurde das Ende des Krieges gefeiert, Bertolt Brechts Gedicht An die Nachgeborenen gab den Takt an, Vater war kein Parteimann, aber man war links, natürlich, und der Blick ging direkt nach vorne. Wohin gehen, wo leben? Alles fast schien möglich, alles zugleich schwierig, nichts war gesetzt. Gewiss war: Sie mussten die Schweiz wieder verlassen, Flüchtlinge durften nur bleiben bis zum Ende des Krieges. Es lockte, es blieb: Paris.
Wir saßen am Fenster, zwischen uns Heft und Halmabrett, Louise trank den Kaffee, den ich am Automaten im Aufenthalt geholt hatte, selber verzichtete ich lieber, eine Lüürebrüe hätte sie solch schwachen Saft früher genannt, die Tasse fasste sie mit beiden Händen, sie zitterte ein wenig, aber es ging.
Über den kleinen Park um die Bachwies legte sich Dunkelheit, Lichter gingen an. Im Herbst wurde es früh dunkel in dieser Stadt, die Farben erinnerten mich an die Zeit, wenn ich als Bub ausgehungert vom Eishockeyspiel auf dem Rad nach Hause fuhr, den Schläger hatte ich von hinten längs durch den Gepäckträger gezogen, er verlief parallel zur Querstange und störte beim Treten kaum, die Schaufel lag vorne nach innen abgedreht gegen die vordere Radgabel, die Tasche mit den Schlittschuhen klemmte auf dem Träger mit der kräftigen Feder, für ein Chäschtli im Eisstadion reichte das Geld nicht.
Ich fragte Louise nach einem zweiten Spiel, nein, schüttelte sie den Kopf, sie sei müde, aber allen Enkeln möchte sie ein Halmaspiel schenken. Ob ich das besorgen könne?