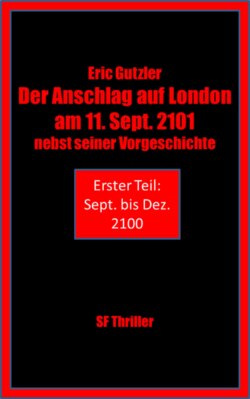Читать книгу Der Anschlag auf London am 11. Sept. 2101 nebst seiner Geschichte - Eric Gutzler - Страница 5
Kapitel 3: Kinder ohne Namen
ОглавлениеNach langen Debatten wurden in der zweiten Hälfte des einundzwanzigsten Jahrhunderts von einigen Staaten die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Errichtung und das Betreiben von Organspenderfarmen zu legalisieren. Auf diesen Farmen werden Menschen zu dem alleinigen Zweck gezüchtet, als Organspender zu dienen. Neben den staatlich autorisierten Farmen existieren in anderen Ländern privatwirtschaftlich geführte Betriebe, die nicht oder nur lasch kontrolliert werden … Aus: Roberta Gregorian: Kleiner Abriss der Genetik. Helsinki 2099.
Wenn Solveig Solness an ihre frühe Kindheit dachte, sah sie den Direktor vor sich und hörte ihn mit kalter Stimme sagen, ihre Erinnerungen seien Wunschvorstellungen, sie habe keine Eltern, er rate ihr nachdrücklich, mit niemandem über diese Hirngespinste zu reden. Wenn sie aber das Gesicht des Direktors wie einen Vorhang zur Seite schob, sah sie in einer Erinnerung, die sie für ihre erste hielt, ihre Eltern in einem Garten vor sich. Sie selbst spielte auf einer Wiese, in einiger Entfernung standen zwei Erwachsene beisammen, ein Mann und eine Frau. Beide waren schlank und großgewachsen. Sie lief auf sie zu, der Mann war ihr Papa, er breitete seine Arme aus, fing sie auf und setzte sie auf seine Schultern. Er war jetzt ihr Pferd. Sie hielt sich mit ihren Händen an seiner Stirn fest und sah sich um. Der Garten lag an einem Hang, in der Ferne sah man Wasser, einen See, vielleicht auch die Bucht eines Meeres, vom Gefühl her – wenn sie später an die Erinnerung dachte – eher eine Bucht oder ein Meeresarm. Auf der anderen Seite des Wassers zog sich eine blaugraue Bergkette hin, der höchste Gipfel war mit Schnee bedeckt. Am unteren Ende der Wiese standen mehrere Bäume, im Geäst eines Baumes war ein Vogelnest zu erkennen. An einem kräftigen Ast dieses Baumes hing eine Schaukel, zwischen zwei anderen Bäumen war eine Hängematte gespannt. Unter der Hängematte lief im Halbschatten ein Vogel mit einem langen gebogenen Schnabel am Boden hin und her, hielt an, pickte und lief weiter. Hangaufwärts lag das Haus, es war zweistöckig und hatte ein hohes Dach. Mehrere Fenster waren geöffnet, und Solveig sah, wie sich die Vorhänge im Wind leicht bauschten. Seitwärts des Hauses erstreckte sich ein Gewächshaus, dahinter erhob sich ein Bergrücken, dessen Hang teilweise aus rötlichen Felsen bestand. Während ihr Vater als Pferd einige Schritte durch den Garten trabte, waren zwischen dem Bergrücken und dem Wasser noch andere Häuser zu sehen, sie verteilten sich als kleine weiße und rote Punkte im Grün der Wiesen und Baumgruppen. An eine Stadt in ihrem Blickfeld hatte sie keine Erinnerung, aber an Segelboote auf dem leicht gekräuselten Wasser. Ihre Eltern sprachen miteinander. Ihre Mutter lächelte ihr zu. Plötzlich verschwand das Lächeln, ihre Mutter griff sich an die Brust, machte ein paar Schritte und setzte sich auf einen Gartenstuhl. Dann sackte sie zusammen. In diesem Augenblick erschien eine Person in der Tür des Hauses, die ihr Vater jedoch nicht beachtete. Hastig setzte er Solveig ab und griff in eine Jackentasche. Er holte eine kleine Spritze heraus und drückte sie seiner Frau in die Armbeuge. Dabei sagte er zu seiner Tochter: „Mama ist krank. Aber du hilfst ihr, gesund zu werden.“ „Wie helfe ich ihr?“ „Mit deinem Blut.“ Immer wenn sie an diese Erinnerung dachte, versuchte sie, sich das Gesicht der Person in der Tür zu vergegenwärtigen, aber sie hatte das Gesicht nur einen Augenblick lang gesehen und konnte noch nicht einmal sagen, ob ein Mann oder eine Frau aus dem Haus getreten war. Trotzdem war ihre Erinnerung an diesen kurzen Augenblick stets mit einem Gefühl von Unbehagen und Gefahr verbunden.
In einer anderen Erinnerung war sie auf der Suche nach ihrer Mutter und öffnete die Tür zu einem Zimmer, in dem sich ihre Mutter oft aufhielt. Das Zimmer war jedoch leer, Solveig trat ein und blickte sich um. Auf einem niedrigen Tisch lagen neben einem Buch kleine, unregelmäßig geformte Steine, die auf einigen Seiten Vertiefungen und auf anderen Seiten Ausbuchtungen oder Höcker besaßen. Neugierig trat Solveig an den Tisch und nahm einige der Steine in die Hand, wobei sie bemerkte, dass sie aus Holz waren und sich warm anfühlten. Einer der Steine war wesentlich größer als die anderen. Solveig drehte und wendete ihn und stellte ihn anschließend mit seiner größten Fläche auf den Tisch. Jetzt nahm sie andere Teile in die Hand und versuchte, zwei so zusammenzustecken, dass der Höcker eines Steins in die Ausbuchtung eines anderen passte und dass die Kanten nicht voneinander abwichen oder überstanden. Nachdem sie einige passend zusammengesteckt hatte, suchte sie nach den beiden Steinen, die zu dem großen Stein passten. Sie fand sie, fügte sie zusammen und stellte fest, dass die drei Steine den Beginn eines Bogens zu bilden schienen. Ah, das ist ein Spiel, dachte sie und fügte mit zunehmender Begeisterung einen Stein an den nächsten, bis eine merkwürdige Figur entstanden war, eine Acht, die in sich gedreht war. Als sie das Zimmer wieder verlassen wollte, kam ihre Mutter herein. Solveig lief auf sie zu und rief: „Mama, Mama! Du hast ein schönes Spiel.“
„Welches Spiel meinst du denn?“
„Das Spiel mit den Steinen, die man zusammenfügen kann.“
Erst jetzt bemerkte ihre Mutter die zusammengesetzte Figur, sah ihre Tochter voller Staunen an: „Hat dir Papa dabei geholfen?“
„Nein, ich war allein im Zimmer. Aber es war ganz einfach. Die Steine sind nämlich unterschiedlich schwer, die schwersten kommen unten hin, die leichten oben.“
„Na, das wollen wir Papa erzählen“, antwortete ihre Mutter, nahm Solveig bei der Hand und ging mit ihr auf die Suche. Als sie ihren Mann im Gewächshaus gefunden hatte, sagte sie: „Stell dir vor, Solveig hat das Möbius’sche Band zusammengesetzt – ohne irgendeine Hilfe.“
Ein anderes Mal saß ihre Mutter vor dem niedrigen Tisch und sagte zu ihr: „Wir wollen jetzt gemeinsam ein Spiel spielen. Unter diesem Tuch liegen einige Gegenstände. Wenn ich das Tuch wegziehe, darfst du dir die Sachen ansehen. Dann bedecke ich sie wieder, und du sagst mir, woran du dich erinnerst. Magst du dieses Spiel spielen?“
Solveig nickte: „Ja gern, Mama.“
Noch als Erwachsene erinnerte sie sich, woran sie sich damals erinnerte hatte: an eine silberne Münze, eine rötliche Münze mit einem Loch in der Mitte, einen weißen Knopf, einen Ring, einen Ring mit einem Stein, ein Armband, eine Glaskugel, einen Würfel, eine weiße und eine schwarze Schachfigur, eine Spielkarte, einen grauen Stein, ein braunrotes Blatt, ein gestreiftes Schneckenhaus, ein kleines Messer, eine Pinzette, eine Batterie und eine Patrone.
„Toll hast du das gemacht“, sagte ihre Mutter, nachdem sie die Gegenstände genannt hatte, „von zwanzig Dingen hast du dich an achtzehn erinnert.“
„Was ist der Unterschied zwischen achtzehn und zwanzig?“
So hatte sie im Alter von dreieinhalb Jahren Zahlen kennengelernt, erst die von eins bis zwanzig, dann sogar bis fünfzig. Als ihre Eltern sahen, wie leicht ihr das Lernen fiel, sagte ihr Vater eines Abends zu ihr: „Die Kette, die du um den Hals trägst, hast du zu deinem dritten Geburtstag erhalten. Teil der Kette ist eine kleine Scheibe, die die Form einer Muschel hat. Obwohl die Scheibe ganz dünn ist, besteht sie aus zwei Hälften. Auf den Innenseiten sind dein Geburtstag, deine beiden Vornamen und unser Familienname eingraviert. Wenn du groß bist, wirst du herausfinden, wie sich die Muschel öffnen lässt. Ich habe dir auf diesem Blatt aufgeschrieben, was in der Muschel steht. Siehst du die Schrift?“
Als sie nickte, gab er ihr den Zettel: „Wenn du dir die Schrift mit deinem Namen einprägst, kennst du schon zehn Buchstaben. Wenn du willst, kannst du versuchen, die Buchstaben mit einem Stift abzumalen.“
„Wann wurde ich geboren, Papa?“
„Am 4. Juli 2077.“
Einige Zeit später traf Solveig ihren Vater in seinem Arbeitszimmer an. Er saß an seinem Tisch vor einem Bildschirm und schrieb. Als er seine Tochter erblickte, nahm er sie auf den Schoß und zeigte ihr die in der Tischplatte eingelassene Tastaturfolie: „Siehst du die weißen Buchstaben auf den schwarzen Feldern? Wenn du die Buchstaben erkennst, die du für deinen Namen brauchst, dann drücke sie kurz nach unten.“
„Da ist das S. Darf ich drücken?“
Er nickte. So drückte sie nacheinander die Buchstaben ihres Rufnamens, vergaß aber das g, weil es nicht gesprochen wurde. Als sie danach auch die Buchstaben des zweiten Vornamens und des Familiennamens in der richtigen Reihenfolge drückte, lobte ihr Vater sie sehr und zeigte ihr, wie man das Geburtsdatum eingab.
„Wenn du größer bist und richtig lesen und schreiben kannst, wirst du oft vor einem Bildschirm sitzen und eine Tastatur oder ein Mikrophon benutzen, um etwas aufzuschreiben. Das Wichtigste an diesem Gerät ist ein kleiner Speicher, in dem man Wörter, Zahlen, Bilder und Musik aufbewahren kann. Auf viele Fragen, die du einmal haben wirst, kannst du die Antworten in dem Speicher finden. Du musst nur wissen, mit welchem Schlüsselwort du die Auskünfte auffinden kannst."
Ein anderes Mal, als Solveig zu ihm gekommen war und gefragt hatte, ob sie noch einmal Buchstabentasten drücken dürfte, zeigte er ihr in einem Bildlexikon verschiedene Tiere, nannte deren Namen und fragte sie, welchen Namen sie schreiben möchte. Alle, Papa, hatte sie geantwortet, woraufhin er ihr die Schreibweise von Hund, Katze, Vogel und Maus zeigte. Sie übte diese Namen mehrmals, wollte danach aber nicht aufhören, bis ihr Vater wieder das Lexikon zur Hand nahm und ihr einen Elefanten, ein Krokodil und einen Schmetterling zeigte. „Die üben wir morgen. Einverstanden?“ Sie hatte genickt und war voller Stolz zu ihrer Mama gelaufen, um ihr vom Buchstabenspiel und einem grünen Krokodil mit ganz vielen Zähnen zu erzählen. In der Folgezeit fragte sie immer wieder nach dem Bildlexikon, bis ihr Vater ihr erlaubte, das Buch in ihr Zimmer mitzunehmen. Beim Blättern stieß Solveig auch auf die Abbildung einer Halskette und zeigte das Bild ihrem Vater, was ihn veranlasste, auf die Muschel und die Innenseiten zu sprechen zu kommen: „Nur wenige Menschen, nur unsere engsten Freunde kennen deinen zweiten Vornamen. Wenn dir einmal später, wenn du erwachsen bist, ein Mann sagt, er sei ein guter Freund deiner Eltern gewesen, dann frage ihn nach deinem zweiten Vornamen. Wenn er den nicht kennt, dann hüte dich vor ihm, denn er gehört nicht zu unseren Freunden. Merke dir das gut. Vergiss es nie!“
In ihrer letzten Erinnerung war es Nacht. Sie erwachte vom Geräusch eines Schusses. Schlaftrunken begann sie, nach ihrer Mama zu rufen. Doch statt ihrer Mutter kamen zwei Männer in ihr Zimmer, zerrten sie aus dem Bett und brachten sie fort. Ihre Eltern hat sie nie mehr gesehen. Wenn sie später an diese Nacht dachte, erinnerte sie sich nur an eine lange Fahrt in einem Lastwagen.
Nach jener Nacht lebte sie in einer Einrichtung, die vom Direktor als Internat, aber von den meisten Aufsichtspersonen eher abschätzig als Camp bezeichnet wurde. Sie hatte kein eigenes Schlafzimmer mehr, sondern schlief in einem Schlafsaal, in dem vierundzwanzig Betten in vier Reihen aufgestellt waren. In dem Schlafsaal schliefen nur Mädchen. In einem anderen Schlafsaal mit vierundzwanzig Betten schliefen nur Jungen. Tagsüber waren alle Kinder beisammen. Sie standen zur selben Zeit auf, sie aßen zusammen, wurden zusammen unterrichtet und trieben zusammen Sport. Die Kinder durften sich nicht mit einem Vornamen anreden, sondern mit den Nummern, die sie erhalten hatten und die sichtbar auf ihre Kleidungsstücke genäht waren. Solveig hieß F 217. Alle Mädchen hatten den Buchstaben F vor ihrer Nummer, alle Knaben den Buchstaben M. Als Solveig von den Aufsichtspersonen angehalten wurde, von sich nur mit der Bezeichnung F 217 zu reden, beharrte sie zu zunächst darauf, sie heiße Solveig Solness. Aber nach mehrtägigem Essensentzug und Unterbringung in einer Zelle ohne Fenster und ohne Licht gab das kleine Mädchen ihren Widerstand scheinbar auf. Tatsächlich jedoch rief sie abends nach dem Zubettgehen und dem Löschen der Lampen die Erinnerungen an ihre Eltern auf und bewahrte sie so über die Jahre. Vor allem das Gespräch, in dem ihr Vater die Innenseiten der muschelförmigen Scheibe erwähnt hatte, schien ihr besonders bedeutsam, weil ihr der Direktor die Halskette abgenommen hatte.
Als sie die anderen Kinder näher kennenlernte und mit ihnen sprach, musste sie feststellen, dass die überwiegende Zahl keine Vornamen kannte und sich nicht daran erinnerte, jemals einen Vornamen gehabt zu haben. Sie kannten nur die Zahlen, mit denen sie angeredet wurden und mit denen sie sich meldeten: F 198, F 207, M 546, M 560 usw. Nur zwei Jungen gaben einmal in einem geflüsterten Gespräch zu, einen Vornamen gehabt zu haben, den sie aus Angst nicht auszusprechen wagten. Einige Jahre später war einer dieser Jungen von einem auf den anderen Tag verschwunden. Bei einer Nachfrage erhielt F 217 nur die knappe Antwort, er sei in ein anderes Internat gebracht worden, wo man sich besser um ihn kümmern könne.
Auch die Erzieher und Lehrer hatten keine Namen, sondern wurden mit dem Buchstaben T und einer anschließenden Zahl angesprochen. Nur der Direktor trug kein Zahlenschildchen und hieß der Direktor.
Vom Tagesablauf der ersten beiden Jahre im Camp besaß Solveig nur noch eine schwache Erinnerung an Schwimmkurse, Labyrinthspiele und Leseunterricht, weil die Zeit in der dunklen Zelle die anderen Ereignisse fast vollständig ausgelöscht hatte. Später war der Tagesablauf immer gleich: Der Tag begann nach dem Wecken um 6.30 mit einer halben Stunde Gymnastik und anschließendem Schwimmen. Danach wurde ein, wie sie später herausfand, muskelbildendes und wachstumbeschleunigendes Frühstück eingenommen. Der Unterricht begann um 8.00 und dauerte bis zum Mittag. Die Kinder erhielten Unterricht in Spanisch, ab dem dritten Schuljahr zusätzlich in Russisch und ab dem sechsten in Chinesisch. Der Wortschatz, den sie in den Fremdsprachen übten, war ein Alltagswortschatz; literarische Texte lasen sie nicht. Sie erhielten zunächst keinen Unterricht in Geschichte oder Geographie. Sie erfuhren nichts von Erdteilen, Ländern, Völkern und ihrer politischen oder religiösen Geschichte. Stattdessen wurden sie in Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und Teilen der Medizin unterrichtet. Außerdem mussten sie ein Musikinstrument erlernen, wobei sie zwischen dem Klavier und einem Holzblasinstrument wählen konnten.
Nach dem Mittagessen und einer Freistunde begann ein dreistündiger Sportunterricht. Die eine Hälfte bestand aus einem Ausdauertraining, in der anderen Hälfte wurden Kampfsportarten geübt. Das Abendessen wurde um 18.30 eingenommen, um 20.00 war Bettzeit, und fünfzehn Minuten später wurde das Licht gelöscht.
Nach acht Tagen Schulunterricht verbrachten die Kinder immer zwei Tage im Freien. Das Gelände außerhalb der Gebäude war hügelig und bewaldet. Unter der Führung von zwei Lehrern marschierten die Kinder nach dem Frühstück los. Etwa zwei Stunden später bestimmten die Führer eine Waldlichtung oder eine Wiese am Waldrand als Lagerplatz. Danach mussten die Kinder Zelte aufschlagen und ein Feuer entfachen, auf dem das Essen gekocht wurde.
In den späteren Jahren, als Solveig zehn geworden war, durften die Kinder keine Zelte mehr mitnehmen, sie mussten sich ihre Schlafstelle im Freien einrichten – auch wenn es regnete oder manchmal schneite. Im Lauf der Jahre wurde an den Tagen im Wald auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln reduziert. Als Solveig zwölf war, mussten die Kinder ihre Nahrung im Wald suchen, Suppen aus Blättern oder Baumrinde bereiten, Fallen aufstellen oder versuchen, Tiere mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Trotz dieser Einschränkungen fieberten die Kinder den beiden Tagen im Freien entgegen, weil diese Tage die einzige Unterbrechung der sonstigen Monotonie des Tagesablaufs und der strengen Kontrolle, der sie in der Schule unterworfen waren, bildeten.
An diesen Tagen im Wald konnten die Kinder jedoch nicht nach Lust und Laune herumstreifen, sondern sie erhielten Aufgaben, die sie entweder in Gruppen, paarweise oder allein lösen mussten. Manchmal wurden die Gruppen und Paare von den Führern eingeteilt, manchmal durften die Kinder ihre Gruppen selbst zusammenstellen. Die Führer beobachteten genau, welche Kinder einander wählten, sich zu Gruppen zusammenschlossen oder Paare bildeten, und stellten daher mitunter Gruppen zusammen, in denen Spannungen entstehen mussten, die die Durchführung der Aufgaben erschwerten und anderen Gruppen Vorteile verschafften. So wurde über jedes Kind ein Dossier angelegt, in dem über die Jahre festgehalten wurde, ob es einen durchsetzungsstarken Willen besaß oder ein Mitläufer oder ein Außenseiter war.
Die Spiele waren zunächst Versteck- und Suchspiele oder Schnitzeljagden, manchmal waren es Kampfspiele. Die Sieger erhielten keinen besonderen Preis, aber die Verlierer mussten den Siegern in den folgenden acht Tagen Dienste erweisen, die Betten machen, die Wäsche waschen, die Waschräume putzen und das Geschirr nach den Mahlzeiten abtragen. Im Lauf der Jahre wurden die Kampfspiele gewalttätiger. Die Parteien, die sich bekriegten, erhielten die Erlaubnis, Gefangene zu machen, die Gefangenen zu fesseln und im Wald liegen zu lassen. Als Solveig dreizehn war, wurden Gewehre ausgegeben, mit denen Hartgummikugeln verschossen werden konnten. Wurde ein Kind getroffen, galt es als tot und musste ausscheiden. Da die Kinder Bekleidung trugen, die mit kleinen Sendern ausgerüstet waren, wurden die Führer über jeden Treffer informiert.
Das Gebäude, in dem Solveig mit den anderen Kindern lebte, bestand aus vier Flügeln, die um ein größeres Haus gruppiert waren. In dem zentralen Gebäude befanden sich auf verschiedenen Stockwerken der Speisesaal mit der Küche, die Turnhalle und die Schwimmhalle. Ganz oben lagen die Räume der Erwachsenen, zu denen die Kinder keinen freien Zutritt hatten. Die Kinder hatten ihre Schlafsäle und Aufenthaltsräume in einem der Flügel. Die anderen drei Flügel standen in den ersten beiden Jahren leer. Während einer Fragestunde mit dem Direktor und den Lehrern stellte Solveig die Frage, wozu die anderen Häuser daseien.
„Ich habe eine Frage“, sagte Solveig.
Fragen durften nur in der Fragestunde und in der Anwesenheit aller Kinder gestellt werden.
„Welche Frage hast du, F 217?“ antwortete der Direktor.
„Wozu sind die leeren Räume da?“
Der Direktor blickte die anwesenden Lehrer an und zögerte einen Augenblick mit der Antwort: „Ihr seid die ersten. Eigentlich sollte hier schon ein weiterer Jahrgang aufgezogen werden, aber es gab einige … Schwierigkeiten. Im nächsten Jahr kommt eine neue Gruppe, die zieht in den zweiten Flügel, jedes Jahr kommt eine weitere Gruppe, in drei Jahren werden alle Räume bewohnt sein.“
Solveig meldete sich. Der Direktor sah sie an: „Hast du noch eine Frage, F 217?“
„Ja, ich habe noch eine Frage. Was geschieht mit uns im vierten Jahr?“
Der Direktor machte sich eine Notiz, dann blickte er auf: „In drei Jahren bauen wir ein neues Gebäude für vier weitere Jahrgänge. Ihr bleibt in eurem Gebäude wohnen.“
Neben dem Direktor und den Lehrern gab es noch eine Gruppe Erwachsener. Ihre Bezeichnung begann mit dem Buchstaben S. Die meisten S-Personen waren Frauen, die die Mahlzeiten zubereiteten oder bei Verletzungen und Erkrankungen Dienste verrichteten. Die S-Frauen waren bei den Kindern sehr beliebt, zum einen, weil das Essen im Gegensatz zur Monotonie des Tagesablaufs sehr abwechslungsreich und schmackhaft war, zum anderen, weil die S-Frauen sehr sanft und umgänglich waren und für viele Kinder zu einer Art Mutterersatz wurden. Auch Solveig hatte mit einer der S-Frauen Freundschaft geschlossen. S 483 war Anfang zwanzig, hatte dunkle Haare und eine sehr blasse Hautfarbe. Der enge Kontakt zwischen ihr und Solveig war entstanden, als das kleine Mädchen nach zwei regnerischen Waldtagen hohes Fieber bekommen hatte, aus dem sich eine Lungenentzündung entwickelte. Solveig wurde in die Krankenstation verlegt, wo sie eine Woche bleiben musste und von S 483 gepflegt wurde.
Nachdem Solveig Zutrauen zu ihrer Pflegerin gefasst hatte, fragte sie sie am Ende der Woche, ob sie ein Geheimnis wahren könne. Als S 483 ihr versprach, jedes Geheimnis, das man ihr anvertraue, für sich zu behalten, erklärte Solveig, dass sie einen richtigen Namen habe und sich daran erinnere, Solveig Solness zu heißen. Die Pflegerin sah sie kurz prüfend an und antwortete, sie habe davon gehört, dass einige Kinder des ersten Jahrgangs von draußen stammten. Sie erwartete jetzt, dass F 217 die Frage stellen würde, warum sie und die anderen Kinder in dem Camp seien. Doch stattdessen sagte Solveig: „Hast du auch einen richtigen Namen?“
„Nein“, sagte S 483 mit leiser Stimme, „ich habe keine Eltern und habe daher auch keinen Namen erhalten.“
„Wie bist du ohne Eltern auf die Welt gekommen?“
„Ich bin das, was man einen Klon nennt, ich bin künstlich entstanden.“
„Bist du ein Roboter?“
„Nein, ich bin aus Fleisch und Blut wie du. Ich wurde erschaffen, um mein Leben als Organspender zu verbringen. Eines Tages werde ich eine Niere, ein Auge oder eine Hand spenden. Später werde ich meine Lunge oder mein Herz spenden. Danach werde ich sterben.“
„Wem wirst du deine Organe geben? Den Lehrern oder den Kindern?“
„Das ist nicht vorgesehen. Ich werde sie Menschen geben, die draußen leben – außerhalb dieser ... Anlage.“
Zu diesem Zeitpunkt hatte Solveig bereits die Mauer gesehen und wusste, dass sie das Internat ohne Hilfe nicht würde verlassen können.
Einige der S-Personen waren Männer, teilweise waren sie Aufsichtspersonen, teilweise Ärzte. Im ersten Jahr lebten vier Ärzte in dem Internat. Mit jedem neuen Jahrgang von Kindern wuchs auch die Zahl der Ärzte. Alle drei Monate wurden die Kinder von einem Arzt untersucht. Der Arzt prüfte nicht nur den allgemeinen Gesundheitszustand, sondern auch in unregelmäßigen Abständen und nach einem für die Kinder undurchschaubaren Plan Leistungsfähigkeiten, zum Beispiel die Reaktionszeit und das Erinnerungsvermögen oder Problemlösefähigkeiten und das Entscheidungsverhalten in Spielsituationen wie dem Gefangenendilemma. Manchmal wurden die Kinder nach einer Untersuchung in Narkose versetzt, und danach wurden operative Eingriffe vorgenommen, von denen sie nichts mitbekamen und über die sie nicht unterrichtet wurden.
Die Ärzte waren zu den Kindern stets freundlich und zogen die Untersuchungen als ein Spiel auf, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Manche Kinder lehnten sich im Lauf der Zeit so sehr an ihren Arzt an, dass sie ihm ihre geheimsten Gedanken und Wünsche offenbarten. Solveig fasste jedoch nie zu einem der Ärzte das Vertrauen, das sie S 483 gegenüber hegte, und benutzte nie einen der Ärzte als Beichtvater. Selbst, wenn sie einmal sehr verzweifelt war und ihrer Not Worte geben wollte, verschloss sie sich, indem sie die Erinnerung an ihre Eltern zurückrief. In diese Gedankenwelt ließ sie keinen Erwachsenen eindringen. Saß sie dann dem Arzt gegenüber, überlegte sie, ob er draußen ein Mensch mit einem Namen und Eltern gewesen war oder wie die Organspenderinnen geklont war. Sie hat es nie herausgefunden.
Solveig war acht, als sie an einem der Waldtage die Mauer entdeckte. Die Führer hatten am Vortag erst nach einem fast vierstündigen Marsch einen Platz zum Übernachten festgelegt und den Kindern nach dem Aufbau der Zelte leichte Einzelaufgaben gegeben. Schon während des Marsches war den Kindern bei ihren Führern, deren Verhalten sie gut kannten, eine gewisse Gleichgültigkeit und Lustlosigkeit aufgefallen. Es war offenkundig, dass sie mit einem Problem beschäftigt waren und darüber miteinander ohne Zuhörer reden wollten. Als am nächsten Morgen die Einteilung in Gruppen für einen Wettkampf unterblieb und die Kinder ohne Aufgaben in den Vormittag entlassen wurden, überkam Solveig die Idee, ihre Eltern zu suchen und zu fliehen. So sonderte sie sich ab und ging in den Wald hinein. Es war ein milder Herbsttag – die Bäume hatten schon zum Teil ihre Blätter verloren –, und sich am Stand der Sonne orientierend schlug Solveig eine Richtung ein, mit der sie sich ihrer Meinung nach von dem Gebäude entfernte. Nach einiger Zeit, es mochte eine Stunde vergangen sein, kam sie an einen Bach, den sie überqueren musste, wenn sie ihre Richtung beibehalten wollte. Einen Augenblick lang war das kleine Mädchen versucht, dem plätschernden Bach zu folgen, doch dann besann sie sich und watete durch das Wasser. In gerader Richtung ging sie weiter, Buschwerk und lichter Wald wechselten sich ab, bis zwischen den Bäumen in einiger Entfernung ein hoher Berg zu sehen war. Mit einem Mal war der Wald zu Ende, und vor ihren Augen lag eine steinige Ebene, hinter der sich der Berg erhob. Seine Flanke hügelte sich jedoch nicht sanft in die Höhe, die Flanke des Berges war von Menschenhand bearbeitet und abgegraben worden. Lotrecht und glatt erhob sich grauer Fels vielleicht fünfzig Meter oder mehr, bevor der natürlich entstandene Berghang einsetzte. Solveig blickte nach rechts und links, ohne ein Ende der Felswand erkennen zu können. Nach kurzem Zögern wandte sie sich nach links und folgte dem Waldrand. Nachdem sie etwa eine halbe Stunde gegangen war, verlor die Felswand an Höhe und wurde schließlich von einer hohen Mauer abgelöst, die sich bis zum Horizont erstreckte. Auf der Mauerkrone waren in Abständen kleine Rohre, die an einem Ende eine Glasscheibe besaßen, montiert. Solveig wusste nicht, dass es sich dabei um Überwachungskameras handelte, aber sie erkannte, dass sie die Mauer nicht würde übersteigen können. Enttäuscht und erschöpft setzte sie sich unter einen Baum und begann zu weinen.
Als ihre Tränen versiegt waren und sie wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, bemerkte sie, dass die Sonne inzwischen sehr hoch stand und dass es fast Mittag sein musste. Vermutlich würden die Führer inzwischen nach ihr suchen. Was würden sie tun, wenn sie sie in der Nähe der Mauer fänden? Vermutlich bestrafen, schoss es ihr durch den Kopf. Daher stand Solveig auf und schlug den Rückweg ein. Zuerst wollte sie, um sich nicht zu verlaufen, am Waldrand bis zu der Stelle gehen, wo sie zum ersten Mal den Berg gesehen hatte. Dann aber dachte sie, es sei klüger, sich möglichst schnell von der Mauer zu entfernen; sie wandte sich nach rechts und drang in den Wald ein. Schließlich erreichte sie den Bach. Als sie ihn überquert hatte, hörte sie Geräusche und Stimmen, die nach ihr riefen. Solveig beantwortete die Rufe und stieß nach kurzer Zeit auf einen der Anführer, der mit einer Gruppe von Kindern nach ihr gesucht hatte.
Mehr mit Besorgnis als mit Zorn in der Stimme fragte der Anführer, wo sie gewesen sei.
„Ich habe mich verlaufen“, antwortete Solveig, „und bin froh, dass ihr mich gefunden habt.“
„Wie weit bist zu gegangen?“
„Ich bin auf einen Bach gestoßen und folgte seinem Lauf talabwärts, dann machte ich Rast und bin wohl eingeschlafen.“
Zu ihrer Überraschung stellte der Anführer keine weiteren Fragen, zu ihrer Überraschung wurde sie nicht bestraft. Einige Zeit später jedoch sagte der Direktor am Ende einer Fragestunde: „Während eurer Tage im Wald werdet ihr irgendwann entdecken, dass eure Welt von einer Mauer umgeben ist und dass ihr diese Mauer nicht übersteigen könnt. Die Mauer ist zu eurem Schutz da. Sie beschützt euch vor dem Draußen. Hat einer von euch die Mauer schon gesehen?“
Niemand meldete sich.
„F 217. Hast du die Mauer schon entdeckt?“
„Nein, Herr Direktor, ich habe keine Mauer entdeckt.“
Der Direktor sah ihr in die Augen, bis sie den Blick senkte. Er machte sich eine Notiz und sagte dann zu allen: „Menschen sind neugierig. Je klüger Menschen sind, desto neugieriger sind sie. Sie wollen Rätsel lösen, Grenzen überschreiten und ins Unbekannte vorstoßen. Für euch ist das Draußen jenseits unserer Welt das Unbekannte. Ihr werdet später erfahren, was es mit dem Unbekannten auf sich hat. Aber vorerst müsst ihr auf dieses Wissen verzichten und daran denken, dass ihr hier geschützt seid. Wenn ihr“, schloss der Direktor die Fragestunde ab, „einmal auf die Mauer stoßt, die noch keiner von euch gesehen hat, nähert euch ihr nicht weiter als hundert Schritt. Merkt euch: Haltet mindestens einhundert Schritt Abstand.“
Danach war die Fragestunde beendet, und der Direktor erwähnte die Mauer in den folgenden Jahren nicht mehr.
Im Lauf der Jahre stieß Solveig in jeder Himmelsrichtung irgendwann einmal auf die Mauer, und als sie zehn Jahre alt war, wusste sie, dass das Camp tatsächlich vollständig von einer Mauer oder von unüberwindbaren natürlichen Hindernissen eingeschlossen war. Sie wusste, dass die grauen Röhren Überwachungskameras waren und dass die Aufnahmen der Kameras in eine Überwachungszentrale gesendet und dort gespeichert wurden. Außerdem wusste sie, dass es zwei Tunnel gab. Einmal war sie zu der Stelle zurückgekehrt, an der sie zum ersten Mal den Berg gesehen hatte. Dort schlug sie den Weg nach rechts ein. Nachdem sie etwa zwei Stunden am Waldrand entlang beständig bergauf gegangen war, vernahm sie ein Geräusch von rauschendem Wasser, das immer lauter wurde, je weiter sie kam. Schließlich sah sie einen Wasserfall. Aus einer Höhe von vielleicht einhundert Metern schoss das Wasser aus dem Berg hervor und stürzte sich in die Tiefe. Am Fuß des Wasserfalls hatte sich ein kleiner See gebildet, aus dem ein Fluss entsprang, der im oberen Teil ziemlich reißend war und mit seinen Strudeln und Wirbeln eine Überquerung unmöglich machte. Jetzt wusste Solveig, aus welcher Quelle sich der große See speiste, der fast am entgegengesetzten Ende des Camps lag. Der große See hatte einen Abfluss, dessen Wasser in einer Felshöhle verschwand.
Nachdem die Kinder zum ersten Mal die Waldtage an dem See verbracht hatten, erschien am nächsten Tag der Direktor im Unterricht und hielt eine kurze Ansprache: „Ich bin nur gekommen, um eine Warnung auszusprechen. Vermutlich überlegt ihr jetzt, wo ihr den Abfluss des Sees gesehen habt, ob man schwimmend das Internat verlassen kann. Das ist unmöglich. Bei dem Versuch würdet ihr sterben. Der Tunnel hat eine Länge von zwei Kilometern, bevor er ans Tageslicht kommt. Ein Schwimmer müsste also die Fähigkeit haben, die Strecke, ohne Luft zu holen, bewältigen zu können. Schon das ist einem Menschen nicht gegeben. Gelänge es aber einem, so käme er am Ende des Tunnels an ein Stahlgitter. Dort würde er, da er das Gitter nicht öffnen kann, elendiglich zugrunde gehen. Gelänge es aber einem, das Gitter zu öffnen, so würde er vom Schwall des Wassers in die Tiefe gerissen, denn das Wasser stürzt dort zweihundert Meter tief ins Meer. Würde aber einer den Sturz überleben, käme er doch elendiglich zu Tode, denn weit und breit gibt es keinen Strand, wo er an Land gehen könnte und Nahrung fände. Er würde auch verdursten, denn ihr müsst ihr wissen, dass das Wasser des Meeres salzig ist. Man kann es nicht trinken.“
Wenn Solveig später an das Camp dachte, schätzte sie, dass die Mauer ein nahezu quadratisches Gelände umschloss und dass die Entfernung von dem Wasserfall am Berg bis zu dem Ausgang des Sees etwa fünfzig Kilometer betrug. Was sie zu dem Zeitpunkt, als die Jacht Amiramis vom „Stolz des Islam“, dem vorgeblichen Polizeischiff der ISF, abgeschleppt wurde, immer noch nicht wusste, war, wo das Camp lag und ob es noch existierte.