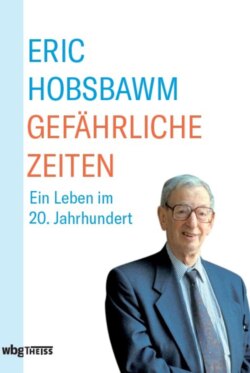Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Berlin: Weimar geht unter
ОглавлениеAls ich 1960 zum ersten Mal nach fast dreißig Jahren nach Wien zurückkehrte, schien sich nichts verändert zu haben. Das Haus, in dem wir gewohnt hatten, und die Schulen, in die wir gegangen waren, befanden sich immer noch dort, auch wenn sie jetzt kleiner wirkten; die Straßen waren wiederzuerkennen, selbst die Straßenbahnen verkehrten noch unter ihren alten Nummern und Buchstaben und befuhren dieselben Strecken. Nicht so in Berlin. Beim ersten Mal, als ich dorthin zurückkehrte, stand ich an der Stelle, an der das Haus hätte sein müssen, in dem wir alle gewohnt hatten, in der Aschaffenburger Straße in Wilmersdorf. Auf dem Stadtplan verlief die Straße noch vom Prager Platz zum Bayerischen Platz. Die Barbarossastraße hätte genau gegenüber der Eingangstür unseres alten Mietshauses beginnen und direkt zur Schule meiner Schwester führen müssen. Doch nichts von alledem war noch da. Es gab Häuser, aber ich erkannte sie nicht wieder. Wie in einem dieser Alpträume der Desorientierung und Fremdheit gab es nicht nur nichts mehr, was mir bekannt vorgekommen wäre, ich wußte nicht einmal, in welche Richtung ich blicken sollte, um mich an Bekanntem zu orientieren. Das zerstörte Gebäude meiner alten Schule war zwar noch physisch an der Grunewaldstraße vorhanden, doch die Schule selbst hatte den Krieg nicht überlebt. Die Lage des Büros meines Onkels im Stadtzentrum war auch auf der Karte nicht festzustellen, da das gesamte Terrain um den Leipziger und den Potsdamer Platz, ein von Bomben eingeebnetes Niemandsland zwischen Ost und West, seit dem Krieg nicht einmal symbolisch wieder instand gesetzt worden war. In Berlin war die physische Vergangenheit durch die Bomben des Zweiten Weltkriegs ausgelöscht worden. Aus ideologischen Gründen waren weder die beiden deutschen Staaten des Kalten Krieges noch das vereinigte Deutschland der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts daran interessiert, sie wieder aufzubauen. Die Hauptstadt der neuen Berliner Republik, ebenso wie das Westberlin des Kalten Krieges ein subventioniertes Schaufenster für die Werte des Wohlstands und der Freiheit, ist ein architektonisches Kunstprodukt. Die Deutsche Demokratische Republik war kein großer Baumeister – ihr ambitioniertestes Bauwerk außer der Stalinallee war die Berliner Mauer –, und sie war auch kein großer Restaurateur, auch wenn sie sich mit dem architektonisch sehr schönen altpreußischen Zentrum der Stadt, das zufällig in ihr Gebiet fiel, größte Mühe gab. Somit lebt die Stadt, in der ich die beiden entscheidendsten Jahre meines Lebens verbrachte, nur noch in meiner Erinnerung fort.
Nicht daß die Architektur Berlins in den letzten Jahren der Weimarer Republik etwas Besonderes geboten hätte. Es war eine Stadt der wirtschaftlich blühenden »Gründerzeit« des 19. Jahrhunderts, also im wesentlichen stark wilhelminisch geprägt, doch ohne den imperialen Stil und die urbane Kohärenz des Wiens der Ringstraße oder die planerische Anlage Budapests. Berlin hatte ein ziemlich prachtvoll bebautes, neoklassisches, langgestrecktes Terrain geerbt, doch zum größten Teil bestand die Stadt im stark proletarisierten Osten – Berlin war ein Industriezentrum – aus den endlosen Hinterhöfen riesiger Mietskasernen an baumlosen Straßen und im grüneren und durchweg bürgerlichen Westen aus Wohnblöcken mit schöner geschmückten Fassaden, die (anscheinend) komfortablere Wohnungen beherbergten. Das Berlin der Weimarer Republik war noch immer im wesentlichen das Berlin Wilhelms II., mit Ausnahme seiner schieren Ausdehnung wahrscheinlich die am wenigsten distinguierte Hauptstadt Europas außerhalb des Balkans, ausgenommen vielleicht Madrid. In jedem Fall dürften heranwachsende Intellektuelle von imperialen Bemühungen um Denkwürdigkeit wie dem Reichstag und der benachbarten Siegesallee kaum beeindruckt gewesen sein, einer lächerlichen Prachtstraße, zu beiden Seiten geschmückt mit den Statuen von 32 Brandenburger und preußischen Herrschern, alles Indikatoren des militärischen Ruhms und – dies war eine Quelle endloser Berliner Witze – unterschiedslos mit einem Fuß nach hinten und einem nach vorn gestellt. Nach dem Krieg wurden die Statuen von den siegreichen, aber humorlosen Alliierten demontiert, vermutlich als Teil der Eliminierung Preußens und alles dessen, was die Deutschen an Preußen erinnern könnte, aus dem Gedächtnis der Zeit nach 1945. Geblieben ist nur ein nicht minder kurioses literarisches Denkmal. Rudolf Herrnstadt, der ehemalige Chefredakteur des Neuen Deutschland, 1953 aus der Führung der SED ausgeschlossen und als Anhänger Berijas, des (hingerichteten) sowjetischen Ministers für Staatssicherheit angeprangert, wurde in das Preußische Staatsarchiv verbannt. (Der Gerechtigkeit halber gegenüber einem Regime, das mit gutem Grund eine schlechte Presse hatte, muß gesagt werden, daß kein »Verräter« in seinen Reihen hingerichtet wurde, nicht einmal in den schlimmsten stalinistischen Jahren.) Dort vergnügte er sich damit, eine brillant komische Satire zu schreiben, Die Beine der Hohenzollern, der eine Akte zugrunde lag, die er dort entdeckt hatte. Sie enthielt eine Sammlung von Besinnungsaufsätzen, aufgegeben einer Gruppe Gymnasiasten von einem Lehrer, der aus einem Klassenausflug zu dem (damals neuerrichteten) Denkmal etwas pädagogisch Wertvolles hatte herausschinden wollen. Wieweit brachten die Körperhaltungen der Statuen den Charakter der dargestellten Personen zum Ausdruck? So lautete das Thema, über das die Klasse einen Aufsatz schreiben sollte; was sie offenbar mit solcher Loyalität meisterte, daß der Kaiser persönlich darum bat, die Aufsätze einsehen zu dürfen, und von eigener Hand seine Anmerkungen darunter schrieb. Herrnstadts unter dem Pseudonym »Hardt« veröffentlichtes Büchlein war ganz im Geist des Berlins der zwanziger Jahre.
Das Berlin, in dem die Jugendlichen aus dem Bürgertum in den Jahren 1931–1933 lebten, war eine Stadt zum Sehen statt zum Stehen und Staunen, man mußte immer in Bewegung bleiben, denn sie bestand eher aus Straßen – wie der Motzstraße und der Kaiserallee Isherwoods, Kästners und meiner Jugend – als aus Gebäuden. Doch für die meisten von uns lag der Witz dieser Straßen darin, daß so viele in den wirklich denkwürdigen Teil der Stadt führten, den Gürtel aus Seen und Wäldern, von dem die Stadt bis heute umgeben ist: zum Grunewald und seinen langgestreckten, von Bäumen und Buschwerk gesäumten Seen, dem Schlachtensee und der Krummen Lanke, auf denen wir im Winter Schlittschuh liefen – Berlin ist eine ausgesprochen kalte Stadt –, nach Zehlendorf, dem Tor zu dem wunderbaren Seensystem. Die Seen im Osten gehörten weniger zu unserer Welt. Diese war dort, wo die Reichen und die noch Reicheren in grauen, massiven herrschaftlichen Villen zwischen den Bäumen wohnten. Aufgrund eines Paradoxons, das für Berlin nicht untypisch ist, war das »Grunewaldviertel« ursprünglich von einem millionenschweren Angehörigen einer jüdischen Berliner Familie erschlossen worden. Diese konnte sich einer langen sozialistischen Tradition rühmen, die auf einen passionierten Büchersammler zurückging, der 1848 in Paris zur Revolution bekehrt wurde – dort hatte er eine Erstausgabe des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels erstanden. Zu meiner Zeit wurde die Familie von den Söhnen und Töchtern R.R. Kuczynskis repräsentiert, einem renommierten Bevölkerungsstatistiker, der nach 1933 eine Zuflucht an der London School of Economics fand. Sie alle wurden lebenslange Kommunisten, von denen die bekannteste Ruth war, die in einer langen und abenteuerlichen Laufbahn im sowjetischen Geheimdienst unter anderem als Kontakt für Klaus Fuchs in England fungierte, und der charmante und ewig hoffende Wirtschaftshistoriker Jürgen, ein einfallsreicher Verteidiger der Marxschen These von der Verelendung des Proletariats, wie er sie verstand, der die riesige Familienbibliothek nach Ostberlin zurückbrachte, wo er im Alter von 93 Jahren verstarb. Er war der Doyen auf seinem Fachgebiet und hat vermutlich mehr an Worten veröffentlicht als jeder andere Wissenschaftler, den ich kenne, nicht eingerechnet die 42 Bände seiner Geschichte der Lage der Arbeiterklasse. Er konnte einfach mit dem Lesen und Schreiben nicht aufhören. Da seine Familie noch immer im Besitz des Grunewaldviertels war, dürfte er der reichste Bürger Ostberlins gewesen sein, was es ihm ermöglichte, die Bibliothek zu erweitern und einen jährlichen Preis in Höhe von 100.000 DM Ost für vielversprechende Arbeiten junger DDR-Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte auszusetzen, die dank seiner Förderung in der DDR eine Blüte erlebte. Er überlebte diesen Staat, in dem er moderat abweichende Meinungen geäußert hatte, die deshalb geduldet wurden, weil seine aufrichtige Loyalität so offen auf der Hand lag. Und außerdem gehörte er der Kommunistischen Partei länger an als die Herrscher des Staates selbst.
Denn Berlin war ebenso wie Manhattan (mit dem es sich während der Weimarer Republik gern verglich) politisch eine Stadt links von der Mitte. Berlin fehlte ein historisch verwurzeltes bürgerliches Patriziertum, und deshalb hatte es auch für die Juden einen einladenderen Charakter. (Die aristokratische Tradition des preußischen Hofs, der Armee und des Staates blickte auf den Bürger jeglicher Couleur herab.) Die nüchternen Berliner reagierten allergisch auf Leute »mit großer Klappe und nichts dahinter« und hielten wenig von Ansprüchen auf soziale Überlegenheit, von nationalistischer Rhetorik und Gefühlsduselei. Dr. Goebbels zum Trotz, der sich vorgenommen hatte, Berlin im Namen Hitlers den Roten zu entwinden, wurde es in seinem Innersten nie eine nationalsozialistische Stadt. Im Unterschied zum Wienerischen, das auf die eine oder andere Weise vom Kaiser bis zum Müllmann gesprochen wurde, war der Berliner Dialekt, eine beschleunigte, witzige, urbane Adaption des Plattdeutschen, primär ein volkstümliches Idiom, das die einfachen Leute von den feinen Pinkeln trennte, auch wenn es von allen gut verstanden wurde. Allein schon das Beharren auf spezifisch berlinerischen grammatischen Formen, die im Dialekt richtig, im Schuldeutschen dagegen offensichtlich falsch waren, reichte aus, das Berlinerische aus der Bildungssprache herauszuhalten. Natürlich griffen die bürgerlichen Schüler meines humanistischen Gymnasiums es ebenso begeistert auf wie die Schüler der prestigeträchtigen Pariser lycées den plebejischen Argot ihrer Stadt, und nach dem Ende der DDR grenzten sich viele ehemalige Ostberliner, ebenso empfindlich wie stolz, von den westlichen Herrschern über ihren Teil Deutschlands demonstrativ ab, indem sie jetzt erst recht »berlinerten«. Es war eine selbstbewußte, freche, unverblümte Sprache, in die ich mich ebenfalls mit Enthusiasmus stürzte, auch wenn mein Tonfall, wenn ich deutsch spreche, bis heute das Wien meiner Kindheit verrät. Noch immer versetzt mich der Klang eines reinen Berlinerisch, das heute auf der Straße selten geworden ist, zurück in jenen historischen Augenblick, der über die Gestalt des 20. Jahrhunderts und meines eigenen Lebens entscheiden sollte.
Ich kam im Spätsommer 1931 nach Berlin, als die Weltwirtschaft zusammenbrach. Innerhalb weniger Wochen nach meiner Ankunft erfolgte in England, das während der letzten hundert Jahre ihre Achse gebildet hatte, die Abkehr vom Goldstandard und vom Freihandel. In Mitteleuropa hatte man mit der Katastrophe gerechnet, da die Amerikaner ihre Kredite abgezogen hatten, und sie ereignete sich früher in diesem Sommer, als zwei große Banken zusammengebrochen waren. Die finanzielle Katastrophe hatte keine schweren direkten Auswirkungen auf einen landesfremden Heranwachsenden, doch die Arbeitslosigkeit, die bereits steil anstieg – 1932 waren 44 Prozent der deutschen Erwerbstätigen betroffen – reichte bis in unsere Familie. Mein Cousin Otto, der bei Onkel Sidney und Tante Gretl gewohnt hatte und sie noch von Zeit zu Zeit besuchte, hatte seine Stellung verloren und ging daraufhin zu den Kommunisten. Er war nicht der einzige: 1932 waren 85 Prozent der Mitglieder der KPD arbeitslos. Jünger als er, war ich natürlich beeindruckt von jemandem, der so groß gewachsen, gut aussehend und erfolgreich bei Frauen war und jetzt ein Abzeichen mit den russischen Initialen der Jungkommunistischen Internationale trug. Ich glaube, er war der erste Kommunist, den ich ganz bewußt erlebte: in Österreich gab es kaum welche, und der Eintritt in die Kommunistische Partei war somit etwas, woran junge Menschen erst nach 1934 dachten, als der Bürgerkrieg die sozialdemokratischen Führer diskreditiert hatte.
Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft war bis zu einem gewissen Punkt etwas, worüber junge Menschen aus der bürgerlichen Schicht etwas gelesen hatten, ohne ihn jedoch direkt zu erfahren. Doch die Weltwirtschaftskrise war wie ein Vulkan, der politische Eruptionen erzeugte. Das war etwas, dem wir nicht entgehen konnten, da es unseren Horizont beherrschte, wie die gelegentlich rauchenden Kegel der echten Vulkane, die sich über ihre Städte erheben – der Vesuv, Ätna oder der Mont Pelée. Eruptionen lagen in der Luft, die wir atmeten. Seit 1929 war ihr Symbol vertraut: das schwarze Hakenkreuz in einem weißen Kreis auf rotem Grund.
Es ist schwer für diejenigen, die das »Zeitalter der Katastrophen« im 20. Jahrhundert in Mitteleuropa nicht erlebt haben, sich vorzustellen, was es bedeutete, in einer Welt zu leben, an deren Dauer niemand glaubte, in einem Etwas, das nicht einmal wirklich als eine Welt beschrieben werden konnte, sondern lediglich als ein Übergang zwischen einer toten Vergangenheit und einer noch nicht oder höchstens vielleicht in der Tiefe des revolutionären Rußlands geborenen Zukunft. Nirgendwo war dies greifbarer als in der Weimarer Republik in ihren letzten Zügen.
Niemand hatte Weimar 1918 wirklich gewollt, und selbst diejenigen, die es akzeptierten oder sogar aktiv unterstützten, sahen darin bestenfalls einen Kompromiß zweiter Wahl: besser als Sozialrevolution, Bolschewismus oder Anarchie, wenn sie zur gemäßigten Rechten, besser als das wilhelminische Kaiserreich, wenn sie zur gemäßigten Linken neigten. Man konnte nur Vermutungen darüber anstellen, ob es die Katastrophen seiner ersten fünf Jahre überleben würde: ein Friedensvertrag mit Strafcharakter, der von den Deutschen jeglicher politischer Couleur fast einhellig als demütigend empfunden wurde, fehlgeschlagene Militärputsche und terroristische Attentate auf der extremen Rechten, gescheiterte lokale Räterepubliken und Aufstände auf der Linken, französische Truppen, die das Herzland der deutschen Industrie besetzten, und zu allem Überfluß das (für die meisten) unbegreifliche und bis heute beispiellose Phänomen der Hyperinflation von 1923. Während der Zeit zwischen 1924 und 1928 sah es so aus, als könnte Weimar sich behaupten. Die Mark wurde stabilisiert – sie blieb bis zum Krieg und erneut von 1948 bis zu ihrer Ersetzung durch den Euro stabil –, die stärkste Wirtschaft Europas, vom Krieg wieder erholt, hatte ihre frühere Dynamik wiedererlangt, und zum ersten Mal schien politische Stabilität in Sicht. Den Börsenkrach an der Wall Street und die Große Depression überlebte Weimar jedoch nicht und konnte es nicht überleben. 1928 schien die extreme Rechte praktisch von der Bühne verschwunden. Bei den Reichstagswahlen in diesem Jahr erhielt die NSDAP nicht mehr als 2,4 Prozent der Stimmen und zwölf Abgeordnetensitze, sogar noch weniger als die zunehmend geschwächte Deutsche Demokratische Partei, die treueste Stütze der Republik. Zwei Jahre später kehrten die Nationalsozialisten mit 107 Reichstagsmandaten zurück und wurden zweitstärkste Partei hinter den Sozialdemokraten. Was von Weimar übrigblieb, wurde mit Notverordnungen regiert. Zwischen dem Sommer 1930 und Februar 1932 tagte der Reichstag alles in allem nicht mehr als zehn Wochen. Und mit zunehmender Arbeitslosigkeit nahmen auch unausweichlich die Kräfte einer radikal-revolutionären Lösung gleich welcher Form zu: der Nationalsozialismus auf der Rechten und der Kommunismus auf der Linken. So lagen die Verhältnisse, als ich im Sommer 1931 nach Berlin kam.
Ich zog zu Nancy und dem sieben Jahre alten Peter in Onkel Sidneys und Tante Gretls Wohnung an der Aschaffenburger Straße, die von einer der vielen finanziell sehr schlecht gestellten älteren Witwen aus guter Familie gemietet worden war. Ich kann mich kaum noch an Einzelheiten dieser Wohnung erinnern, außer daß sie hell war und daß die Tischgespräche der Erwachsenen mit ihren abendlichen Gästen von dem Zimmer aus, in dem ich schlief, mitgehört werden konnten. Onkel Sidney und Tante Gretl führten ein ziemlich aktives gesellschaftliches Leben, mit Geschäftsfreunden, Verwandten und Wiener Freunden, die Berlin besuchten oder hierhergezogen waren, weil das kleine und verarmte Österreich der Zwischenkriegszeit für Wiener Talente ein zu kleines Betätigungsfeld bot. Wir waren noch zu jung, um uns daran in größerem Umfang zu beteiligen. Wir hielten uns die Vossische Zeitung, die meine Tante hauptsächlich wegen ihres Feuilletons schätzte, dessen Seiten sie herausschnitt. Ich habe lebhafte Erinnerungen an große Kinos und prächtige Luxuslimousinen, die auf der Straße parkten – Maybachs, Hispano-Suizas, Isotta-Fraschinis und Cords.
Innerhalb weniger Tage nach meiner Ankunft fand Onkel Sidney für mich einen Platz im Prinz Heinrichs-Gymnasium in Schöneberg, von der Wohnung und Nancys benachbarter Chamissoschule aus zu Fuß erreichbar, und das gerade noch so rechtzeitig, daß ich in die Obertertia eintreten konnte. Von den ganzen dreizehn Jahren, die ich an sieben Bildungsanstalten verbrachte, bevor ich nach Cambridge ging, haben die rund neunzehn Monate am PHG den tiefsten Eindruck in meinem Leben hinterlassen. Diese Schule war das Medium, durch das ich erfahren habe, was – wie ich schon damals wußte – ein entscheidender Augenblick in der Geschichte des 20. Jahrhunderts sein würde. Darüber hinaus erlebte ich ihn nicht mehr als das Kind, das ich in Österreich war (auch wenn bei mir bereits in meinem letzten Jahr in Österreich die Pubertät einsetzte), sondern in jenem Augenblick der Adoleszenz, in dem Leidenschaft und Intelligenz zum ersten Mal kolumbushaft die Welt entdecken und allein die Erfahrung zu leben unvergeßlich ist. Jahre später brachte mich ein alter Freund mit dem damaligen deutschen Botschafter in England, Günther von Hase, zusammen, der sich, als in einem Gespräch mein Name fiel, sofort daran erinnerte, daß wir dieselbe Schulklasse besucht hatten. Und ich wiederum konnte mich bei diesem Namen sofort an das Gesicht eines Jungen erinnern, mit dem ich zusammen in derselben Klasse gesessen war – und dies nur für einige Monate in einem langen Leben, in dem nach 1933 vermutlich keiner von uns beiden an den anderen gedacht hat. Wir waren damals lediglich Klassenkameraden, mehr nicht. Doch wir waren dort zu einer Zeit unseres Lebens und der Geschichte zusammen, die man nicht vergißt. Die bloßen Namen erweckten sie zum Leben. Aus der ebenen Landschaft meiner Schuljahre ragt das PHG heraus wie eine Gebirgskette. In den ersten Jahren nach Berlin war das Leben in England für mich ohne wirkliches Interesse.
War meine Berliner Schule wirklich so wichtig, wie es mir in der Rückschau erscheint? Die Artillerie von Weimar bombardierte einen erwartungsvollen Vierzehnjährigen von allen Seiten. Die Schule brachte mir nicht die Lieder bei, die für mich noch immer »Berlin« bedeuten – von den Liedern der Dreigroschenoper Bert Brechts und Kurt Weills bis zur bronzenen Stimme Ernst Buschs, der Erich Weinerts »Stempellied« sang. Die großen Ereignisse der Zeit – der Sturz der Regierung Brüning, die nationale Präsidentenwahl und zwei Reichstagswahlen 1932, die Regierungen Papen und Schleicher, die Machtübernahme Hitlers, der Reichstagsbrand – erreichten mich nicht durch die Schule, sondern durch Straßenplakate und die Tageszeitung und die Zeitschriften daheim (auch wenn ich merkwürdigerweise weniger Erinnerungen an die Rundfunknachrichten in Berlin als die in Wien habe). Denkmäler des Designs und des Inhalts der in der Weimarer Republik produzierten Bücher: die Produkte des Malik Verlags. Ich sehe sie noch vor mir auf den Ständern in der Buchabteilung des KaDeWe, des großen Kaufhauses an der Tauentzienstraße, das eine der wenigen Verbindungen mit dem Berlin meiner Jugend darstellt: voll mit Büchern von Autoren wie B. Traven, Ilja Ehrenburg, Arnold Zweig und, auf eine andere Art, Thomas Mann und Lion Feuchtwanger.
Vieles davon muß mich offensichtlich durch die Familie erreicht haben. Onkel Sidney hatte zur Abwechslung einmal eine finanzielle Glückssträhne erwischt und arbeitete für die Universal Pictures Company, die sich als Produzentin von Lewis Milestones Im Westen nichts Neues nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque am kulturpolitischen Epizentrum der Weimarer Republik befand. Die Nationalsozialisten hatten Demonstrationen gegen diesen Antikriegsfilm organisiert und forderten sein Verbot. Damit nicht genug: der Boß der Filmgesellschaft, »Onkel« Carl Laemmle, war der einzige Hollywood-Tycoon, der aus Deutschland stammte und persönliche Kenntnis von dem hatte, was hier vorging, da er jedes Jahr einmal hierherkam, um den Kontakt zu halten. Und das tat er auch. Er war alles andere als ein Intellektueller, doch dem geschulten Auge verrieten die Filme, für die die Universal besonders bekannt war – abgesehen von Im Westen nichts Neues –, die Horrorfilme wie Frankenstein und Dracula, deutlich den Einfluß der deutschen expressionistischen Avantgarde.
Weiß der Himmel, wie Onkel Sidney ins Filmgeschäft gekommen war. Irgendwann 1929 hatte er es geschafft, jemanden bei der Universal zu beschwatzen, ihm irgendeine Stellung zu geben. Die Tätigkeit war unbestimmt und unsicher. Doch solange sie währte, wurde sie anerkannt – und sei es auch nur durch ein Geschenk von Onkel Carl persönlich in Form eines Exemplars seiner Biographie mit einem Autogramm eines englischen Literaten und vergessenen unbedeutenden Poeten namens John Drinkwater. (Laemmle hatte ihn angeheuert, nachdem H.G. Wells ihm einen Korb gegeben hatte, weil man ihm gesagt hatte, daß Drinkwater, von dem er natürlich noch nie gehört hatte, ein Stück über Abraham Lincoln geschrieben habe.) In England wurden von dem Buch 164 Exemplare verkauft.1 Unser Exemplar hat die zahlreichen Ortswechsel der Hobsbaumfamilie im 20. Jahrhundert nicht überlebt.
Worin seine genauen Aufgaben bei der Universal bestanden, habe ich nie erfahren. In einem Brief von meiner Großmutter steht etwas davon, daß man ihm im Herbst 1931 eine Stelle im Pariser Büro in Aussicht gestellt hatte, ein Angebot, das er jedoch ablehnte, da Tante Gretl gesagt hatte, die Kinder (meine Schwester und ich) hätten noch kaum die Möglichkeit gehabt, sich in die neuen Schulen in Berlin einzugewöhnen. Das Schicksal wird durch solch kurzfristige Familienbeschlüsse entschieden. Wie wäre unser Leben verlaufen, wenn wir 1931 nach Paris gegangen wären? Eine der Aufgaben, die er mit Sicherheit übernommen hat, war die Ausrüstung der Expedition für die Außenaufnahmen des Films S.O.S. Eisberg, ein Polarabenteuer mit Luis Trenker, dem Veteranen des Bergfilms, und dem Flieger-As Ernst Udet, der seinen Lebensunterhalt als Kunstflieger verdiente, bis die deutsche Aufrüstung ihm zu einer herausgehobenen Position in Hitlers Luftwaffe verhalf. Als technische Berater wirkten Mitglieder von Alfred Wegeners Expeditionen mit; einer von ihnen kam zu uns nach Hause und erzählte mir von der Theorie der Kontinentaldrift und wie er sich in einem Winter in Grönland alle Zehen abgefroren hatte. Bei mindestens einer weiteren Gelegenheit warb Onkel Sidney für Hollywoodprodukte, die in Europa unters Volk gebracht werden sollten – genauer gesagt für Frankenstein auf dem polnischen Markt. Zu seiner Werbekampagne, auf die er sehr stolz war, gehörte das gezielt verbreitete Gerücht (um das Interesse des damals sehr großen jüdischen Publikums zu wecken), daß sich hinter Boris Karloff, dessen bürgerlicher Name Pratt wenig hergab, ein Boruch Karloff verberge, der seinen Namen lediglich geringfügig entjudaisiert habe. Offenbar stand er mit Polen in Verbindung, denn irgendwann im Sommer 1932 war die Rede von einer dauerhaften Versetzung dorthin, und Onkel Sidney versuchte, uns auf das völlig andere Leben in diesem Land vorzubereiten. Wir würden in Warschau wohnen. Die Polen, sagte er mir, seien empfindliche Leute mit einem ausgeprägten Ehrgefühl und einem Hang zu Duellen. Ich hatte nie die Möglichkeit, seine Information vor Ort zu überprüfen.
Wie auch immer, wenn ich darüber nachdenke, war die Familie nicht in derselben Weise in Berlin verankert wie die Schule. Wie inzwischen deutlich geworden sein dürfte, lebte die Hobsbaumfamilie nicht in Berlin, sondern in einer transnationalen Welt, in der Menschen wie wir noch – wenngleich in den kommenden Jahren unter wesentlich erschwerten Umständen – auf der Suche nach einem Lebensunterhalt von einem Land in ein anderes zogen. Wir mochten Wurzeln in England oder in Wien haben, doch Berlin war nur eine Zwischenstation auf dem komplizierten Weg, der uns fast überallhin in Europa westlich der UdSSR führen konnte. Auch unsere Wohnverhältnisse in Berlin – drei Adressen und zwei verschiedene Zusammensetzungen des Haushalts in 18 Monaten – hatten nicht die Kontinuität der Schule. Mein Fenster zur Welt im Augenblick ihrer Krise war das Prinz Heinrichs-Gymnasium.2
Es war eine ganz und gar konventionelle Schule in der konservativen preußischen Tradition, 1890 gegründet, um dem Bedarf eines schnell wachsenden bürgerlichen Wohnviertels nachzukommen. Prinz Heinrich, dessen Namen sie trug, ein Bruder von Kaiser Wilhelm II., war ein Mann der Marine, was erklären mag, warum die Schule mit Recht stolz auf ihren Ruderklub am Kleinen Wannsee war (ein Modell seines Bootshauses »im Spreewaldstil« hatte auf der Brüsseler Weltausstellung 1908 eine Goldmedaille gewonnen). Mit Recht, weil der Klub zwar gute Trainer, jedoch anders als die Klubs in England kein spezielles Interesse an Wettkämpfen hatte und ein wunderbares Refugium darstellte, wo jüngere und ältere Schüler sich von gleich zu gleich begegnen konnten. Irgendwie war es dem Klub gelungen, an dem kleinen, nur der Fischerei vorbehaltenen Sakrower See eine Wiese zu erwerben, die »unser Gut« genannt wurde und nur mit besonderer Erlaubnis über einen schmalen Wasserweg zugänglich war. Freundesgruppen bildeten Mannschaften, die dorthin ruderten oder sich an Wochenenden dort trafen, um Gespräche zu führen, in den Sommerhimmel zu schauen und im grünen Wasser zu schwimmen, bevor wie in die abendliche Stadt zurückkehrten. Zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben vermochte ich den Sinn eines Sportklubs einzusehen. Ein Ehemaliger der Schule, Dr. Wolfgang Unger, Arzt am Spandauer Spital, kümmerte sich um das Training der Neuen. Soviel ich weiß, wurde er aus rassischen Gründen 1934 seiner Stellung am Krankenhaus enthoben und beging daraufhin Selbstmord, da er nicht bereit war, sein Land, Deutschland, zu verlassen.
Eine preußische Schule mit Verbindungen zum Militär war natürlich im Geiste protestantisch, zutiefst patriotisch und konservativ. Diejenigen unter uns, die diesem Muster nicht entsprachen – ob als Katholiken, Juden, Ausländer, Pazifisten oder Linke –, empfanden sich als kollektive Minderheit, allerdings nicht als in irgendeiner erkennbaren Weise ausgeschlossene Minderheit.3 Trotzdem war es keine nationalsozialistische Schule. (Nur wenige der Jungen, die ich kannte, zeigten viel Begeisterung für Hitler und die Braunhemden, ausgenommen Kube, der ungewöhnlich beschränkte Sohn eines Mannes, der Hitlers Gauleiter in Brandenburg war und so lange keine Ruhe gab, bis er erreicht hatte, daß ein Deutschlehrer an der Schule mit der Begründung entlassen wurde, er »begünstige« die wenigen noch verbliebenen jüdischen Schüler und behandle im Unterricht in der Hauptsache die entartete Literatur der Weimarer Republik. Er sollte der berüchtigte Reichskommissar für Weißruthenien während des Krieges werden, bis er schließlich von seiner Geliebten, einer patriotischen Weißrussin, ermordet wurde.) Im Gegenteil. Welche Sympathien die Schule auch immer für die von Hitler versprochene nationale Wiedererweckung gehegt haben mochte, damit war es (kurz nach meiner Abreise nach England) nach der erzwungenen Amtsenthebung des hochgeachteten und allseits beliebten Schulleiters, Oberstudiendirektor Dr. Walter Schönbrunn, vorbei, der unter dem neuen Regime politisch unerwünscht war. An seine Stelle trat ein von oben eingesetzter Kommissarischer Leiter, gegen den sich der erbitterte Groll der ganzen Schule richtete. Man kann das PHG der dreißiger Jahre kaum als eine Brutstätte der Regimekritik bezeichnen, aber es besagt einiges, daß Franz Marcs »Turm der blauen Pferde« – ich erinnere mich gut daran, weil es in der Eingangshalle hing –, von der neuen Obrigkeit als »entartete Kunst« verboten, von einer Klasse aus einer Abstellkammer geholt und im Klassenzimmer wieder aufgehängt wurde. Die Schüler protestierten auch gegen die Entlassung von Professor »Sally« Birnbaum, dem beliebten Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften: In der ganzen Schule wurden Unterschriften für eine Petition zu seinen Gunsten gesammelt. Noch im Winter 1936/37 stattete ihm die Unterprima geschlossen einen Besuch in seiner Wohnung in der Rosenheimer Straße ab. (Er überlebte in Berlin bis 1943, als er und seine Frau mit dem 36. Osttransport vermutlich nach Auschwitz deportiert wurden.) Es spricht sogar einiges dafür, daß die Schule sich besondere Mühe gab, die letzten jüdischen Schüler und Lehrer gut zu behandeln, solange sie noch dort waren. Wie immer politisch inakzeptabel sie einem jugendlichen Möchtegern-Revolutionär vorkam, der nicht im Traum daran gedacht hätte, die Schulmütze zu tragen (nach Art der Seglermützen mit Schirm und weichem Oberteil), es war eine anständige Schule.
Das lag zweifellos an dem, was das Hitlerregime an Dr. Schönbrunn (allgemein bekannt als »der Chef«) als den obrigkeitskritischen und gesellschaftlich suspekten Geist von Weimar erkannt hatte. Der Ruderklub war hierfür ein Ausdruck. Die Betonung der Schülerselbstverwaltung und der Beteiligung der Schüler an den Verhandlungen von Disziplinarfällen ein weiterer, ebenso die unvergeßlichen Klassenfahrten durch die Mark Brandenburg und Mecklenburg, bei denen wir in Zelten und Jugendherbergen übernachteten. (Nicht umsonst hatte Dr. Schönbrunn, der die Lehrbefähigung nicht nur für Deutsch, Latein und Griechisch, sondern auch für Mathematik erworben hatte, ein Buch mit dem Titel Jugendwandern als Reifung zur Kultur veröffentlicht.) Ich persönlich konnte mich für diesen ziemlich kleinen Mann mit scharfen Augen hinter randlosen Brillengläsern, einem zurückweichenden Haaransatz und Knickerbockern (wenn er sich seinen Schützlingen auf einem Wandertag anschloß) nicht erwärmen. (Andererseits war es damals, wie jeder Leser der Bücher von Tim und Struppi weiß, in Europa die Zeit der Knickerbocker.) Meine Bewunderung für Karl Kraus und seine Zeitschrift Die Fackel tat er mit der Bemerkung ab: »Der Fackel-Kraus, ein eitler Schwätzer«, was im Rückblick betrachtet nicht völlig daneben war. Er kritisierte meinen Prosastil, den er als übermäßig manieriert ansah.
Vielleicht hätte ich ihm vergeben, wenn ich gewußt hätte, daß er ein Bewunderer der Architektur der »neuen Sachlichkeit« war und sowohl deren klare Linienführung als auch die »bewußte Schlichtheit heutiger Dichtung« schätzte, »in der […] eine offenbar neue Klassik sich wieder bemerkbar macht«, ein apollinischer Geist, der einem Griechischlehrer sehr zusagte. Er wählte den Roman Krieg des kommunistischen Schriftstellers Ludwig Renn als ein Beispiel für den neuen Klassizismus. (Er hatte natürlich wie die meisten unserer Lehrer im letzten Krieg gedient.) Dennoch, auch wenn ich ihn nicht gerade mochte, ich hatte Respekt vor ihm. Und ich profitierte fraglos von seinen Bemühungen, die schließlich in dem Jahr, bevor ich zur Schule in der Grunewaldstraße kam, vom Erfolg gekrönt wurden: »Die Schülerbücherei wurde endlich mal mit wirklich modernen Werken versorgt.«
Mehrere dieser Bücher haben mein Leben geformt. In einem großen enzyklopädischen Führer zur deutschen Gegenwartsliteratur entdeckte ich die Gedichte (im Unterschied zu den Liedern und Theaterstücken) Bertolt Brechts. Und ein aufgebrachter Lehrer – sein Name war Willi Bodsch, das ist alles, was ich von ihm noch weiß – schickte mich in die Schulbibliothek, als ich meine kommunistischen Überzeugungen offenlegte. Er sagte zu mir mit Nachdruck (und mit Recht): »Sie wissen offenbar nicht, wovon Sie reden. Gehen Sie in die Bibliothek und informieren Sie sich über das Thema.« Das tat ich denn auch und entdeckte das Kommunistische Manifest…
Was ich in den einzelnen Unterrichtsstunden gelernt habe, ist mir nicht so klar. Ich kann erkennen, daß sie kein besonders zentraler Bestandteil der Schulerfahrung waren, es sei denn als Gelegenheiten, um eine Gruppe von schlecht verstandenen Erwachsenen zu beobachten, zu manipulieren und manchmal ihre Nerven und ihre Autorität auf die Probe zu stellen. Die meisten erschienen mir fast wie Karikaturen deutscher Lehrer, spießig, mit Brille und mit Bürstenschnitt (wenn sie keine Glatze hatten) und ziemlich alt – die meisten von ihnen waren Ende Vierzig oder Anfang Fünfzig. Alle hörten sich an wie begeisterte konservative deutsche Patrioten. Zweifellos hielten sich diejenigen, die das nicht waren, bedeckt, doch die meisten sind es sicherlich gewesen. Das galt ganz besonders für Professor Emil Simon – eine Figur, wie man sie aus den Bildern von George Grosz kannte –, dessen Griechischunterricht wir routiniert in eine andere Richtung lenkten, indem wir beispielsweise fragten, wie Wilamowitz diese Stelle interpretiert hätte (was mindestens für eine zehnminütige Lobrede auf den größten deutschen Altphilologen ausreichte), oder, was zuverlässiger funktionierte, indem wir ihn baten, uns etwas über seine Erlebnisse im Weltkrieg zu erzählen. Das führte uns unweigerlich weg von einer Übersetzung der Odyssee Homers zu einem Monolog über das Schützengrabenerlebnis des Frontsoldaten, die Pflicht eines Offiziers, die Notwendigkeit einer Nachkriegsordnung, die russische Barbarei, die Schrecken der Oktoberrevolution und der Tscheka, Lenins Prätorianergarde aus Lettischen Schützen und dergleichen mehr sowie zu der Mahnung, daß im Gegensatz zu dem, was ungebildete Arbeiter denken mochten, Spartakus alles andere als proletarischer Herkunft war, sondern einem hohen Stand angehört hatte, bevor er versklavt wurde. Es war, wie ich heute viele Jahrzehnte später erkenne, eine frühe Version der These, die in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts zur Relativierung des Dritten Reichs vorgebracht wurde, daß es nämlich notwendig gewesen sei, eine geordnete Gesellschaft gegen den Bolschewismus zu verteidigen, und jedenfalls seien die Schrecken der Hitlerzeit von den Schrecken des roten Rußlands vorweggenommen und angeregt worden. Soweit ich weiß, war Emil Simon kein Nazi, nur ein deutscher Konservativer, der sich an bessere Tage erinnerte, wie man dies an Stammtischen in bürgerlichen Lokalen wohl tun mochte. Ungeachtet unserer individuellen politischen Überzeugungen machten wir uns über ihn lustig und bedauerten seinen Sohn, einen blassen, schmächtigen Jungen, der in der vordersten Reihe der Klasse saß und die dreifache Bürde trug, Emil Simons Sohn, sein Schüler und Zeuge unseres Spotts über seinen Vater zu sein.
Wie auch immer, das Leben war zu interessant, um sich hauptsächlich auf die Schule und die Schularbeiten zu konzentrieren. Ich hatte damals keine besonders glänzenden Zeugnisse. Um die Wahrheit zu sagen, redeten die Lehrer und zumindest dieser Schüler aneinander vorbei. Ich lernte absolut nichts in den Geschichsstunden, die von einem kleinen, dicken alten Mann gehalten wurden, »Tönnchen« Rubensohn, außer den Namen und Daten aller deutschen Kaiser, die ich bis heute allesamt vergessen habe. Er schoß durch den Klassenraum, zeigte der Reihe nach mit einem Lineal auf uns und sagte etwa: »Schnell, Heinrich der Vogler, von? bis?« Ich weiß heute, daß ihn diese Übung ebenso anödete wie uns. Tatsächlich war er der hervorragendste Wissenschaftler an der Schule, Autor einer Monographie über die Mysterien von Eleusis und Samothrake, er hatte Beiträge für den Pauly-Wissowa verfaßt, die größte Enzyklopädie des klassischen Altertums, und war bereits lange vor dem Krieg ein anerkannter klassischer Archäologe in der Ägäisregion sowie ein Papyrusexperte. Vielleicht hätte ich das in der Prima entdeckt, wo der Unterricht nicht mehr auf einem vorgeschriebenen Auswendiglernen beruhte. Bis dahin bestand der Haupteffekt seines Unterrichts letztlich darin, einen potentiellen zukünftigen Historiker von diesem Fach abzubringen. Es wird niemanden wundern, daß ich in Berlin durch Absorption und nicht durch Instruktion gelernt habe. Aber gelernt habe ich natürlich.
Die Monate in Berlin machten einen lebenslangen Kommunisten aus mir oder zumindest einen Mann, dessen Leben ohne das politische Projekt, dem er sich als Schuljunge verschrieben hatte, seinen Charakter und seine Bedeutung verlieren würde, auch wenn das Projekt nachweislich gescheitert ist und, wie ich heute weiß, scheitern mußte. Der Traum der Oktoberrevolution ist immer noch irgendwo in meinem Inneren da, so wie gelöschte Dateien irgendwo auf der Festplatte eines Computers noch immer darauf warten, von Experten wiederhergestellt zu werden. Ich habe es aufgegeben, ja verworfen, aber es ist nicht zerstört worden. Bis auf den heutigen Tag beobachte ich an mir, daß ich das Gedächtnis und die Tradition der UdSSR mit einer Nachsicht und Zärtlichkeit behandle, die ich gegenüber dem kommunistischen China nicht empfinde, da ich der Generation angehöre, für die die Oktoberrevolution die Hoffnung der Welt in einer Weise repräsentierte, wie China das nie getan hat. Der Hammer und die Sichel der Sowjetunion haben diese Hoffnung symbolisiert. Doch was hat eigentlich den Berliner Schuljungen zu einem Kommunisten gemacht?
Eine Autobiographie zu schreiben heißt, über sich nachzudenken, wie man dies nie zuvor wirklich getan hat. In meinem Fall heißt es, die geologischen Sedimente von drei Vierteln eines Jahrhunderts abzutragen und einen verschütteten Fremden freizulegen oder zu entdecken und wiederherzustellen. Wenn ich zurückblicke und versuche, dieses ferne und unvertraute Kind zu verstehen, drängt sich mir der Schluß auf, daß ihm unter anderen historischen Umständen niemand ein leidenschaftliches politisches Engagement, jedoch fast jeder Beobachter eine Zukunft als Intellektueller dieser oder jener Art prophezeit hätte. Menschen interessierten ihn anscheinend nicht besonders, weder einzeln noch als Gesamtheit, auf jeden Fall weitaus weniger als Vögel. Überhaupt schien er von den Angelegenheiten der Welt ziemlich weit entfernt zu sein. Er hatte keine persönlichen Gründe für eine Ablehnung der Gesellschaftsordnung und hatte nicht das Gefühl, unter dem üblichen Antisemitismus Mitteleuropas zu leiden, da er mit seinen blonden Haaren und blauen Augen nicht als »der Jude« identifiziert wurde, sondern als »der Engländer«. Sich für den Versailler Vertrag rechtfertigen zu müssen, konnte an einer deutschen Schule unangenehm sein, aber es war nicht erniedrigend. Die Aktivitäten, denen ich an der Schule spontan zuneigte, wo ich mich fraglos glücklich fühlte, hatten nichts mit Politik zu tun: der Literaturverein, der Ruderklub, Naturkunde, die herrlichen Schulwanderfahrten durch die Mark Brandenburg und Mecklenburg, die Nächte im Zelt oder in Jugendherbergen auf Strohmatratzen, wo wir fröhlich und begeistert bis tief in die Nacht hinein miteinander redeten. Über was? Über alles, vom Wesen der Wahrheit bis zu der Frage, wer wir waren, von der Sexualität noch und noch bis zur Literatur und Kunst, vom Witz bis zum Schicksal. Aber nicht über die aktuelle Politik. Jedenfalls habe ich diese unvergeßlichen Abende und Nächte so in Erinnerung behalten. Zumindest kann ich mich an keine politischen Diskussionen oder gar Streitigkeiten mit meinen engsten Freunden, Ernst Wiemer und Hans-Heinz Schroeder, dem Dichter der Klasse – er fiel an der Ostfront –, erinnern. Was mich mit ihnen verband, liegt im Dunkeln. Ich stelle lediglich fest, daß sie auf dem Abiturfoto meiner Klasse von 1936 von 23 jungen Männern und zwei Lehrern außer zwei weiteren Schülern die einzigen waren, die einen offenen Hemdkragen trugen. Die politischen Überzeugungen waren es sicher nicht. Ob der eine nun ein überzeugter Nationalist war oder nicht, unser gemeinsames Thema waren jedenfalls die Nonsensgedichte von Christian Morgenstern und die Welt im allgemeinen. Und die traditionell preußische Verehrung des anderen für Friedrich den Großen, den man gewiß auch noch aus anderen Gründen bewundern kann, störte mich weniger, aber ich teilte sicher nicht seine Anschauungen, die dazu führten, daß er Modelle der Soldaten seiner Armeen sammelte.
Kurzum, wenn ich das Gedankenexperiment anstellen sollte, den Knaben, der ich damals war, in eine andere Zeit und/oder ein anderes Land zu versetzen – etwa in das England der fünfziger oder in die USA der achtziger Jahre –, dann kann ich mir nur schwer vorstellen, daß er sich mit demselben leidenschaftlichen Engagement wie ich damals der Weltrevolution verschrieben hätte.
Andererseits zeigt bereits die Vorstellung eines solchen anderen, unpolitischen Weges, wie undenkbar er im Berlin zu Beginn der dreißiger Jahre gewesen wäre. Fred Uhlman, beim Verlassen Deutschlands einige Jahre älter als ich, ein Flüchtling und Anwalt, der sich auf das Malen trauriger Bilder von der kargen walisischen Landschaft verlegte, schrieb eine weitgehend autobiographische und später verfilmte Novelle (Reunion) über die dramatische Auswirkung des neuen Hitlerregimes auf die Schulfreundschaft eines jüdischen Jungen, der nichts von der drohenden Katastrophe ahnt, und einem jungen »arischen« Adligen an einem süddeutschen Gymnasium, das dem meinigen nicht unähnlich war. In Stuttgart mag dies ein mögliches Szenario gewesen sein, aber in der krisengeschwängerten Atmosphäre Berlins in den Jahren 1931/32 war ein solches Maß an politischer Naivität undenkbar. Wir fuhren auf der Titanic, und jeder wußte, daß sie den Eisberg rammen würde. Das einzig Ungewisse daran war, was passieren würde, wenn es soweit war. Wer würde ein neues Schiff bereitstellen? Es war unmöglich, sich aus der Politik herauszuhalten. Doch wie sollte man die Parteien der Weimarer Republik unterstützen, die nicht einmal mehr wußten, wie man die Rettungsboote bemannte? Sie waren völlig abwesend bei den Reichspräsidentschaftswahlen 1932, bei denen Hitler, Thälmann als Kandidat der KPD und der greise Feldmarschall Hindenburg antraten, wobei der letztere von allen Nichtkommunisten unterstützt wurde, weil dies als die einzige Möglichkeit erschien, den weiteren Aufstieg Hitlers zu verhindern. (Innerhalb weniger Monate sollte er Hitler zum Reichskanzler berufen.) Doch für jemanden wie mich gab es tatsächlich nur eine Wahl. Der deutsche Nationalismus, ob in der traditionellen Form des PHG oder in der Form von Hitlers Nationalsozialismus, war keine Option für einen Engländer und Juden, auch wenn ich verstehen konnte, warum er auf Menschen, die weder das eine noch das andere waren, so attraktiv wirkte. Was blieb außer den Kommunisten übrig, vor allem für einen Jungen, der sich bereits bei seiner Ankunft in Deutschland gefühlsmäßig zur Linken hingezogen fühlte?
Als das Schuljahr 1932/33 begann, wurde der Eindruck, daß wir in einer Art Endkrise lebten oder zumindest in einer Krise, die nur in einer Katastrophe aufgelöst werden könnte, übermächtig. Die Präsidentschaftswahlen vom Mai 1932, die ersten einer ganzen Reihe von Wahlen in diesem unheilschwangeren Jahr, hatten bereits die Parteien der Weimarer Republik ausgeschaltet. Die letzte ihrer Regierungen, das Kabinett Brüning, war bald darauf gestürzt worden, und an ihre Stelle trat eine Clique von adligen Reaktionären, die ausschließlich mit Notverordnungen des Reichspräsidenten regierte, denn die Regierung unter Franz von Papen hatte praktisch keinen Rückhalt im Reichstag, geschweige denn das Format, eine Mehrheit hinter sich zu bringen. Die neue Regierung entsandte sogleich eine kleine Abordnung Soldaten zur Absetzung der Regierung des größten deutschen Bundeslands, Preußen, wo eine Koalition aus SPD und Zentrum noch eine Art demokratischer Herrschaft ausgeübt hatte. Die Minister gingen widerstandslos, da Papen in dem Versuch, Hitler in seine Regierung zu bekommen, das erst vor kurzem gegen die SA erlassene Uniformverbot auf der Straße wiederaufgehoben hatte. Die gezielt provozierenden Aufmärsche der SA wurden von da an zu einem gewohnten Bild. Fast täglich kam es zu Kämpfen zwischen den uniformierten Ordnerdiensten der verschiedenen Parteien. Allein im Juli wurden 86 Menschen getötet, hauptsächlich bei Zusammenstößen zwischen SA-Leuten und Kommunisten, und die Zahl der Verletzten ging in die Hunderte. Hitler, der um höhere Einsätze spielte, erzwang im Juli allgemeine Neuwahlen, aus denen die Nationalsozialisten mit fast 14 Millionen Stimmen (37,5 Prozent der abgegebenen Stimmen) und 230 Abgeordnetensitzen hervorgingen – kaum weniger als die vereinigten Stimmen der Weimarer Parteien (SPD, Zentrum und die inzwischen kaum noch sichtbare DDP) und der Kommunisten mit über 5 Millionen Stimmen und 89 Mandaten. Damit war die Weimarer Republik praktisch tot. Jetzt ging es nur noch darum, in welcher Form sie beerdigt werden sollte. Doch solange es keine Übereinstimmung zwischen dem Präsidenten, der Wehrmacht, den Reaktionären und Hitler gab (der das Amt des Reichskanzlers wollte oder gar nichts), konnte der Leichnam nicht bestattet werden.
Das war die Lage zu Beginn des Schuljahrs. Während ich mich an das erste Jahr in Berlin in Farbe erinnere, sind meine Erinnerungen an die letzten sechs Monate in immer dunklere graue Schatten mit roten Tupfern getaucht. Die Veränderung betraf nicht nur die Politik, sondern auch unsere familiäre Lage.
Denn im Lauf des Jahres 1932 verdüsterten sich unsere Aussichten in Berlin. Wir fielen nicht Hitler zum Opfer, sondern der »Großen Krise«, genauer gesagt einem neuen Gesetz, mit dem der vergebliche Versuch unternommen wurde, der steigenden Arbeitslosigkeit Herr zu werden, indem ausländische Filmgesellschaften (und zweifellos auch andere ausländische Firmen) verpflichtet wurden, mindestens 75 Prozent Deutsche auf ihren Gehaltslisten zu haben. Onkel Sidney war entbehrlich. Jedenfalls ist das die plausibelste Erklärung für das, was passierte. Das Projekt mit Polen hatte sich zerschlagen, doch im Herbst 1932 – seine Tätigkeit in Berlin war offenbar beendet – zogen Onkel Sidney, Tante Gretl und Peter, gerade erst sieben Jahre alt, nach Barcelona – ob im Auftrag der Universal-Filmgesellschaft oder in der Hoffnung, auf eigene Faust etwas zu finden, weiß ich nicht. Ich vermute, daß keine Aussichten auf eine feste Anstellung bestanden, denn in diesem Fall wäre die ganze Familie dorthin gezogen. Wie die Dinge jedoch lagen, blieben Nancy und ich vorläufig in Berlin zurück, um weiter die Schule zu besuchen, bis man wieder klarer in die Zukunft sehen konnte. Es war das Ende des neuen Hauses mit Garten in Lichterfelde, dem exklusiven Stadtteil, wohin wir aus der Aschaffenburger Straße gezogen waren, in die Nähe von jemandem aus der Musikwelt, der tatsächlich über den Luxus eines kleinen, aber wirklich privaten Schwimmbeckens verfügte. Nancy und ich zogen mit der dritten Schwester der Familie Grün zusammen, unserer unsteten Tante Mimi, deren Lebensweg über mehrere fehlgeschlagene Unternehmungen in englischen Provinzstädten (»wir haben zu wenig Schulden, als daß ein Bankrott sich lohnte, und müssen einfach weitermachen«4) sie zu einer untervermieteten Wohnung an der Reichsbahnlinie in Halensee geführt hatte, einem Berliner Stadtteil am westlichen Ende des Kurfürstendamms. Dort betrieb sie wie gewohnt eine Pension und bot den Engländern unter ihren zahlenden Gästen Deutschstunden an. Das war der Grund, warum wir die letzten Monate in Berlin verbrachten und das Dritte Reich noch erlebten.
Es war vermutlich das einzige Mal in meinem Leben, daß meine Schwester Nancy und ich gemeinsam außerhalb einer familiären Umgebung gelebt haben, denn Tante Mimi, die schon immer von der Hand in den Mund gelebt hatte und ohnedies nicht an Kinder gewöhnt war – sie selbst hatte nie welche gehabt –, zählte kaum als Familie. Ich kann nur Vermutungen darüber anstellen, in welcher Weise das Fehlen jeglicher elterlicher Autorität sich in diesen letzten Monaten in Berlin auf Nancy ausgewirkt hat, aber ich bin ziemlich sicher, daß meine politischen Aktivitäten wesentlich stärker beschränkt gewesen wären, wenn Tante Gretl und Onkel Sidney in Berlin geblieben wären. Da ich dreieinhalb Jahre älter war als meine Schwester, fühlte ich mich für sie verantwortlich. Außer mir gab es jetzt niemanden mehr. Ich hatte mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, wie sie zur Schule kam, mich hatte lediglich der tägliche Alptraum beschäftigt, von Lichterfelde zu meinem Gymnasium auf einem Fahrrad fahren zu müssen, dessen ich mich in einer Weise schämte, wie sie nur Heranwachsenden möglich ist, dem Geschenk meiner todkranken Mutter, dem schwarz umlackierten Fahrrad mit dem verzogenen Rahmen. (Ich kam stets eine halbe Stunde zu früh beim Fahrradschuppen an und machte mich später als die anderen auf den Heimweg, weil ich nicht damit gesehen werden wollte.) Jetzt gingen wir dagegen gemeinsam zur Schule und wieder zurück, denn Halensee war ziemlich weit von Wilmersdorf entfernt, und das PHG und die Chamissoschule lagen fast nebeneinander. Vermutlich haben wir die Bahn oder den Bus benutzt, aber ich kann mich nur noch an die endlosen Fußmärsche während des dramatischen Transportstreiks bei der Berliner Verkehrs-Gesellschaft Anfang November erinnern. Wir waren sehr jung und ganz auf uns selbst gestellt. Als Nancy ihren zwölften Geburtstag feierte, hielt ich es für meine Pflicht, sie »aufzuklären«, und sie war vermutlich zu höflich, um mir zu sagen, daß sie bereits aufgeklärt worden sei, zumindest über das, was die Menstruation betraf, was für ein Mädchen an der Schwelle zur Pubertät wohl das wichtigste war. Ich kann nicht behaupten, daß uns diese Monate einander nähergebracht hätten, als zwei Geschwister mit denselben traumatischen Erfahrungen sich ohnehin sind. Außer diesen Traumata hatten wir sehr wenig gemeinsam, und meine intellektuellen Neigungen sowie mein mangelndes Interesse an der Welt der Menschen verliehen mir einen Schutz, der ihr fehlte. Ich habe das damals nicht erkannt. Sie teilte weder meine Interessen noch mein Leben, die beide zunehmend von der Politik beherrscht wurden. Ich wußte nicht einmal, wie es ihr auf der Schule ging, wer ihre Freundinnen waren oder ob sie überhaupt welche hatte. Ich nehme an, wir tratschten über Tante Mimi und ihre zahlenden Gäste, spielten abends zusammen Karten und schickten Briefe nach Spanien. Ich dachte mir Geschichten für den kleinen Peter aus, zu denen mich Hugh Loftings Doktor Dolittle und Christian Morgensterns »Nasobem« inspiriert hatten, jenes Tier, das auf seinen Nasen einherschreitet.
In meiner Erinnerung erscheint die Friedrichsruher Straße nur in Grau oder in einem künstlichen Licht, vermutlich weil wir in diesen Monaten die meiste Zeit außer Haus waren. Abends trafen wir uns alle im Wohnzimmer, wo das Bücherregal der Hauptmieter stand. Es ermöglichte mir, zum ersten Mal Thomas Mann (Tristan) und einen kurzen Roman von Colette zu lesen. Tante Mimi, die mit solchen Situationen vertraut war, zeigte ein echtes Interesse an den Lebensgeschichten ihrer Logiergäste und wandte ihr übliches soziales Repertoire an, Handlesen und andere Formen der Wahrsagerei sowie Gespräche über die Realität übersinnlicher Phänomene mit Beispielen. Sie hatte versucht, Geld einzusparen – eines der wenigen konkreten Details unseres Lebens in Halensee, das mir im Gedächtnis geblieben ist –, indem sie die Kartoffeln zum Kochen sackweise kaufte und mich von Zeit zu Zeit in den Keller schickte, um das benötigte Quantum nach oben zu bringen. Im Lauf der Zeit begannen die Kartoffeln zu keimen und mußten sorgfältig geschält werden, damit niemand etwas merkte.