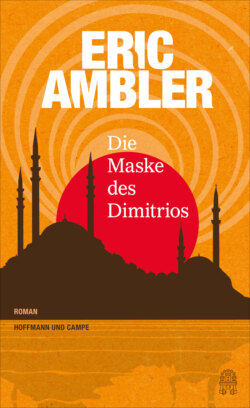Читать книгу Die Maske des Dimitrios - Eric Ambler - Страница 6
3 1922
ОглавлениеIn den Morgenstunden des 26. August 1922 griff die türkisch-nationalistische Armee unter Mustafa Kemal Pascha bei Dumlu Pinar, einem Ort auf der Hochebene dreihundert Kilometer östlich von Smyrna (Izmir), die Hauptstreitmacht der griechischen Armee an. Am nächsten Morgen waren die Griechen geschlagen und zogen sich überstürzt in Richtung Smyrna zur Küste zurück. Bald wurde aus dem Rückzug eine panische Flucht. Die Griechen, die der türkischen Armee nichts entgegensetzen konnten, gingen dabei mit unglaublicher Brutalität gegen die türkische Zivilbevölkerung vor. Von Alaschehir bis Smyrna blieb kein Dorf verschont. Unter den rauchenden Trümmern fanden die türkischen Verfolger die Leichen der Dorfbewohner. Gemeinsam mit den wenigen, vor Schmerz fast wahnsinnigen anatolischen Bauern, die überlebt hatten, übten sie Rache an den Griechen, die sie einholen konnten. Neben den toten türkischen Frauen und Kindern lagen nun die verstümmelten Leichen der griechischen Nachhut. Doch der Großteil der griechischen Armee konnte übers Meer entkommen. Die Türken, die noch immer nach dem Blut der Ungläubigen riefen, zogen weiter. Am neunten September eroberten sie Smyrna.
Zwei Wochen lang waren Flüchtlinge vor den heranrückenden Türken in die Stadt geströmt, zu den bereits vorhandenen Griechen und Armeniern, in der Annahme, die Griechen würden die Stadt verteidigen. Aber die griechische Armee hatte sich abgesetzt. Nun saßen sie in der Falle. Das Gemetzel begann.
Nachdem den Türken das Register der Armenischen Verteidungsliga in die Hände gefallen war, drang in der Nacht des 10. September ein Trupp regulärer Soldaten in das Armenierviertel ein, um all jene aufzutreiben und zu töten, deren Name im Register verzeichnet war. Die Armenier leisteten Widerstand, daraufhin liefen die Türken Amok. Das anschließende Massaker wirkte wie ein Fanal. Angespornt von ihren Offizieren, fielen die türkischen Soldaten tags darauf in die nichttürkischen Viertel Smyrnas ein und begannen mit der systematischen Ermordung der Bewohner. Männer, Frauen und Kinder wurden aus ihren Häusern und Verstecken gezerrt und abgeschlachtet, und bald waren die Straßen mit verstümmelten Leichen übersät. Die Kirchen, in die sich die Massen geflüchtet hatten, wurden mit Benzin übergossen und angezündet. Wer nicht lebendig verbrannte, sondern ins Freie gelangte, wurde mit dem Bajonett erstochen. In vielen anderen Stadtteilen wurden geplünderte Häuser ebenfalls angezündet, und die Flammen breiteten sich allmählich aus.
Zunächst versuchte man, den Brand zu isolieren. Doch dann drehte der Wind, sodass die Flammen nicht auf türkische Viertel übergriffen, und die türkischen Truppen legten weitere Brände. Bald stand die ganze Stadt, mit Ausnahme des türkischen Teils und einiger Häuser in der Nähe des Kassamba-Bahnhofs, in Flammen. Das Massaker ging mit unverminderter Brutalität weiter. Um die Eingeschlossenen am Verlassen des brennenden Izmir zu hindern, wurde ein Truppenkordon um die Stadt gelegt. Die von Panik ergriffenen Menschen wurden gnadenlos niedergeschossen oder in das Inferno zurückgetrieben. Die engen, ausgebrannten Gassen waren vor lauter Leichen so verstopft, dass irgendwelche Helfer, selbst wenn sie den üblen Gestank ausgehalten hätten, dort nicht vorwärts gekommen wären. Die Stadt war ein einziges Schlachthaus. Viele Flüchtlinge hatten versucht, den Hafen zu erreichen. Erschossen, ertrunken, von Schiffsschrauben zermalmt, trieben ihre Leichen im blutroten Wasser. Und noch immer drängten Menschen zu den Kais, während nur wenige Schritte hinter ihnen die brennenden Häuser einstürzten. Die Schreie dieser Leute sollen noch weit draußen auf See zu hören gewesen sein. Gâvur Izmir, das gottlose Smyrna, hatte für seine Sünden gebüßt.
Als der Morgen des fünfzehnten September heranbrach, waren über hundertzwanzigtausend Menschen umgekommen, aber irgendwo in dieser Hölle hatte Dimitrios überlebt.
Als Latimer sechzehn Jahre später mit dem Zug in Izmir eintraf, kam er sich reichlich töricht vor. Dies war kein Schluss, den er voreilig oder ohne sorgfältige Prüfung der vorhandenen Beweise gezogen hatte. Es war ein Schluss, der ihm ganz und gar nicht gefiel. Zwei Dinge waren jedoch nicht zu leugnen. Erstens hätte er Oberst Hakki bitten sollen, ihm zu helfen, Zugang zu den Prozessakten einschließlich der Geständnisse von Driss Mohammed zu bekommen, doch ihm war kein plausibler Vorwand eingefallen. Zweitens konnte er so wenig Türkisch, dass ihm die Dokumente, einmal angenommen, er würde sie auch ohne Oberst Hakkis Hilfe einsehen können, nicht viel nützen würden. Sich auf diese absurde und reichlich würdelose Aktion einzulassen war schlimm genug. Sich nicht entsprechend vorbereitet zu haben war die reinste Idiotie. Wäre er nicht schon eine Stunde nach seiner Ankunft in einem ausgezeichneten Hotel untergekommen, hätte sein Zimmer nicht ein sehr bequemes Bett gehabt und einen herrlichen Blick über die Bucht bis zu den ausgedörrten, sandfarbenen Hügeln am Horizont, und hätte ihn der französische Hotelbesitzer nicht mit einem trockenen Martini begrüßt, er hätte seinen kriminalistischen Versuch abgebrochen und wäre auf der Stelle nach Istanbul zurückgekehrt. Nun, da er einmal in Izmir war, konnte er sich die Stadt ruhig anschauen, Dimitrios hin, Dimitrios her. Er packte einen Teil seiner Koffer aus.
Latimer galt als zäher Charakter. Es war wohl eher so, dass er nicht jene Art geistiger Luftschleuse besaß, die ihren glücklichen Besitzer befähigt, Probleme einfach durch Vergessen zu bewältigen. Latimer mochte das Problem aus seinem Kopf vertreiben, aber es würde bald wieder zurückkehren und vorsichtig an seinem Bewusstsein nagen. Ihn würde das quälende Gefühl peinigen, dass er etwas verlegt hatte, ohne genau zu wissen, was es war. Seine Gedanken würden abschweifen. Er würde vor sich hin starren, bis das Problem plötzlich wieder da war. Ihm zu sagen, dass er es auch verscheuchen könne, da er es selbst herbeigeredet habe, wäre sinnlos. Ebenso sinnlos wäre es, ihm mit der Überlegung zu kommen, dass es überflüssig sei und die Lösung ohnehin keine Rolle spiele. Am nächsten Morgen zuckte er gereizt mit den Schultern und erkundigte sich beim Hotelbesitzer nach einem guten Dolmetscher.
Fjodor Myschkin war ein eingebildeter, kleiner Russe, etwa sechzig, dessen dicke, herabhängende Unterlippe beim Sprechen zitterte und wackelte. Er hatte ein Büro am Hafen und verdiente sein Geld mit dem Übersetzen von Geschäftsdokumenten und als Dolmetscher für Kapitäne und Zahlmeister ausländischer Frachtschiffe, die in Izmir anlegten. Er war Menschewik gewesen und 1919 aus Odessa geflohen, und obwohl er sich, wie der Hotelbesitzer spöttisch erklärte, inzwischen als Freund der Sowjets zu erkennen gab, zog er es vor, nicht nach Russland zurückzukehren. Ein Angeber, gewiss, aber ein guter Dolmetscher. Wer einen Dolmetscher benötigte, für den war Myschkin der richtige Mann.
Myschkin fand ebenfalls, dass er der richtige Mann war. Er hatte eine hohe, heisere Stimme und kratzte sich oft. Sein Englisch war gut, aber mit Slangwendungen durchsetzt, die immer etwas deplatziert wirkten. Er sagte: »Wenn ich etwas für Sie tun kann, hängen Sie sich an die Strippe, ich bin spottbillig.«
»Ich möchte die Spur eines Griechen verfolgen, der im September 1922 hier verschwunden ist«, sagte Latimer.
Myschkin zog die Augenbrauen hoch. »1922? Ein Grieche, der hier verschwunden ist?« Er kicherte atemlos. »Viele sind damals abgehauen.« Er spuckte auf einen Zeigefinger und fuhr sich damit über die Kehle. »So! Grauenhaft, wie die Türken mit den Griechen umgesprungen sind. Entsetzlich!«
»Dieser Mann entkam auf einem Flüchtlingsdampfer. Sein Name war Dimitrios. Er soll einen gewissen Driss Mohammed angestiftet haben, einen Geldverleiher namens Scholem umzubringen. Dimitrios konnte fliehen. Falls es möglich ist, möchte ich die Prozessunterlagen einsehen, das Geständnis von Driss Mohammed und die Ermittlungen zur Person Dimitrios.«
Myschkin starrte ihn an: »Dimitrios?«
»Ja.«
»1922?«
»Ja.« Latimers Herz schlug schneller. »Wieso? Kennen Sie ihn?«
Der Russe schien etwas sagen zu wollen, schüttelte dann aber nur den Kopf. »Nein. Ich dachte bloß, es ist ein verbreiteter Name. Haben Sie die Erlaubnis zur Akteneinsicht?«
»Nein. Ich hatte gehofft, Sie würden mir sagen können, wie ich am besten eine solche Erlaubnis bekomme. Ich weiß, Sie befassen sich nur mit Übersetzungen, aber wenn Sie mir in dieser Angelegenheit helfen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.«
Myschkin spielte nachdenklich mit seiner Unterlippe. »Vielleicht sollten Sie sich an den britischen Vizekonsul wenden und ihn bitten, Ihnen die Genehmigung zu besorgen …« Er hielt inne. »Entschuldigen Sie«, sagte er, »aber warum brauchen Sie diese Akte? Ich frage nicht, weil ich mich unbedingt in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen will, sondern weil die Polizei Ihnen diese Frage stellen könnte. Na ja«, sagte er langsam, »wenn es eine legale Sache ist, einwandfrei und über jeden Zweifel erhaben … ich habe einen einflussreichen Bekannten, der die Sache recht preisgünstig für Sie arrangieren könnte.«
Latimer spürte, wie er errötete. »Zufällig ist es eine legale Angelegenheit«, sagte er so beiläufig wie möglich. »Ich könnte natürlich zum Konsul gehen, aber wenn Sie so freundlich wären, die Sache für mich zu arrangieren, wäre das weniger aufwendig für mich.«
»Aber gern. Ich werde noch heute mit meinem Freund sprechen. Die Polizei ist unberechenbar, wissen Sie, und wenn ich selbst hingehe, wird es teuer. Ich möchte meine Kunden schützen.«
»Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen.«
»Keine Ursache.« Ein abwesender Ausdruck trat in seine Augen. »Ihr Engländer seid sympathisch. Ihr wisst, wie man Geschäfte macht. Ihr feilscht nicht herum wie diese Mistgriechen. Wenn Geld bei Auftragserteilung vereinbart ist, dann zahlt ihr bei Auftragserteilung. Eine Anzahlung? Okay. Die Engländer sind fair. Man vertraut einander. Unter solchen Bedingungen kann man gut arbeiten. Man spürt …«
»Wie viel?«, unterbrach ihn Latimer.
»Fünfhundert Piaster?« Zögernd nannte er den Betrag. Er guckte traurig. Ein Künstler, der kein Selbstvertrauen hatte, ein Kind in Geschäftsdingen, das nur in seiner Arbeit zufrieden war.
Latimer dachte einen Moment nach. Fünfhundert Piaster waren nicht einmal ein Pfund Sterling. Billig. Da bemerkte er ein Leuchten in den traurigen Augen.
»Zweihundertfünfzig«, sagte er entschlossen.
Myschkin warf verzweifelt die Hände hoch. Er müsse leben. Und da sei auch noch sein Freund, der großen Einfluss habe.
Schließlich einigte man sich auf dreihundert Piaster (einschließlich fünfzig Piaster für den einflussreichen Freund), Latimer zahlte einhundertfünfzig an und verabschiedete sich wenig später. Tags darauf sollte er wieder vorbeischauen, um zu hören, was bei den Verhandlungen mit dem Freund herausgekommen war. Er ging, nicht unzufrieden über die Ergebnisse dieses Vormittags, auf der Hafenstraße zurück. Lieber wäre es ihm natürlich gewesen, er hätte die Akten selbst einsehen und bei der Anfertigung der Übersetzung zugegen sein können. Er hätte sich eher wie ein Forscher gefühlt und weniger wie ein neugieriger Tourist, aber so war es nun einmal. Es bestand ja immer die Möglichkeit, dass Myschkin die einhundertfünfzig Piaster einfach in die eigene Tasche steckte, doch irgendwie glaubte er nicht daran. Er besaß ein feines Gespür, und der Russe war ihm, trotz seiner Art, als ein grundehrlicher Mensch erschienen. Und auf gefälschte Dokumente würde er, Latimer, ganz bestimmt nicht hereinfallen. Oberst Hakki hatte ihm zu viel über den Prozess gegen Driss Mohammed erzählt, als dass er einen derartigen Betrug nicht merken würde. Schiefgehen konnte eigentlich nur, dass der Freund seine fünfzig Piaster nicht wert war.
Myschkins Büro war geschlossen, als er tags darauf vorbeischaute. Eine Stunde lang wartete er draußen auf der dreckigen Stiege, doch der Dolmetscher tauchte nicht auf. Ein zweiter Versuch, etwas später, war ebenso erfolglos. Latimer zuckte mit den Schultern. Jemanden um einhundertfünfzig Piaster, also etwa fünf Shilling, zu betrügen schien kaum der Mühe wert zu sein. Aber er war doch ein wenig verunsichert.
Sein Selbstvertrauen wurde durch eine Nachricht, die er bei seiner Rückkehr im Hotel vorfand, wiederhergestellt. Auf einem Zettel teilte Myschkin ihm in einer wüsten Handschrift mit, er sei aus seinem Büro weggerufen worden, weil er bei einem Disput zwischen einem rumänischen Zweiten Offizier und der Hafenpolizei wegen des Todes eines griechischen Hafenarbeiters dolmetschen müsse, er werde sich die Fingernägel einzeln ausreißen, weil er Mister Latimer Unannehmlichkeiten bereite, sein Freund habe aber alles arrangiert, und er selbst würde die Übersetzung am nächsten Abend vorbeibringen.
Kurz vor dem Abendessen am nächsten Tag traf er ein, während Latimer gerade einen Aperitif trank. Winkend und heftig schwitzend kam Myschkin ihm entgegen, warf sich, verzweifelt mit den Augen rollend, in einen Sessel und stieß einen lauten Seufzer der Erschöpfung aus.
»Was für ein Tag! Diese Hitze!«, stöhnte er.
»Haben Sie die Übersetzung?«
Myschkin nickte müde und mit geschlossenen Augen. Mit großer Anstrengung steckte er die Hand in die Innentasche, holte ein Bündel Papiere heraus, die von einer Büroklammer zusammengehalten wurden, und drückte sie Latimer in die Hand – wie ein sterbender Kurier, der seine letzte Meldung überbringt.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte Latimer.
Der Russe schlug die Augen auf und sah sich um wie jemand, der das Bewusstsein wiedererlangt. Er sagte: »Wenn Sie wollen. Ich möchte bitte einen Absinth. Mit Eis.«
Der Kellner nahm die Bestellung entgegen, während Latimer sich zurücklehnte, um seine Erwerbung zu prüfen.
Die Übersetzung war handgeschrieben und umfasste zwölf Seiten. Latimer überflog die ersten Seiten. Kein Zweifel, es war alles korrekt. Er begann, sorgfältig zu lesen.
Nationale Regierung der Türkei
Militärgericht Izmir
Auf Anordnung des Befehlshabers der Garnison Izmir, kraft Dekret, erlassen zu Ankara am achtzehnten Tag des sechsten Monates des Jahres 1922 neuer Zeitrechnung:
Protokoll der Verhandlung unter Major Zia Hakki am sechsten Tag des zehnten Monates des Jahres 1922 neuer Zeitrechnung.
Der Jude Zakaria beschuldigt den Feigenpacker Driss Mohammed aus Budscha, seinen Cousin Scholem ermordet zu haben.
Vergangene Woche entdeckte eine Patrouille des 60. Regiments in einer namenlosen Gasse unweit der Alten Moschee die Leiche des Geldverleihers Scholem, der mit aufgeschlitzter Kehle in seinem Zimmer lag. Obwohl der Tote kein Rechtgläubiger war und keinen guten Ruf genoss, führte unsere wachsame Polizei Ermittlungen durch und stellte fest, dass sein Geld gestohlen worden war.
Mehrere Tage später teilte der Kläger Zakaria dem Polizeikommandanten mit, er habe gesehen, wie der fragliche Driss in einem Kaffeehaus ein Bündel griechischer Geldscheine vorgezeigt habe. Da er wusste, dass Driss arm war, habe ihn das überrascht. Später, als Driss betrunken war, habe er ihn damit prahlen hören, dass der Jude Scholem ihm zinslos Geld geliehen habe. Zu diesem Zeitpunkt habe er von Scholems Tod noch nichts gewusst, aber als er von seinen Verwandten davon erfuhr, erinnerte er sich, was er gehört und gesehen hatte.
Der Zeuge Abdul Hakk, Besitzer der Bar Crystal, gab an, Driss habe das griechische Geld, mehrere hundert Drachmen, herumgezeigt und damit angegeben, dass er es von dem Juden Scholem zinslos geliehen bekommen habe. Dies sei ihm merkwürdig erschienen, da er Scholem als Geizkragen kannte.
Ein Hafenarbeiter na#mens Ismail gab ebenfalls zu Protokoll, dass er dies von dem Angeklagten gehört habe.
Befragt, wie er in den Besitz des Geldes gekommen sei, leugnete der Angeklagte zuerst, das Geld je besessen zu haben oder den Scholem jemals gesehen zu haben. Er erklärte, der Jude Zakaria hasse ihn, weil er ein Rechtgläubiger sei. Abdul Hakk und Ismail hätten ebenfalls gelogen.
Nach strenger Befragung durch den Richter gab er dann zu, dass Scholem ihm das Geld für einen geleisteten Dienst gegeben habe. Worum es sich dabei gehandelt habe, könne er jedoch nicht erklären. Er wurde immer merkwürdiger und erregter. Er bestritt, Scholem getötet zu haben, und beschwor Allah in gotteslästerlicher Weise, er möge seine Unschuld bezeugen.
Der Richter verurteilte daraufhin den Angeklagten zum Tod durch den Strang, und die anderen Mitglieder des Tribunals bezeichneten dieses Urteil als recht und gerecht.
Latimer war am Ende einer Seite angekommen. Er sah Myschkin an. Der Russe hatte seinen Absinth ausgetrunken und betrachtete das Glas. Er begegnete Latimers Blick. »Absinth«, sagte er, »ist wirklich sehr gut. So erfrischend.«
»Möchten Sie noch einen?«
»Wenn Sie wollen.« Lächelnd zeigte er auf die Papiere in Latimers Hand. »Alles in Ordnung?«
»O ja, sieht so aus. Die Zeitangaben sind allerdings etwas vage, nicht? Es gibt keinen Autopsiebericht, und der genaue Todeszeitpunkt wurde auch nicht ermittelt. Und die Beweise scheinen mir ziemlich schwach. Nichts wurde wirklich bewiesen.«
Myschkin guckte überrascht. »Warum sollte man sich die Mühe machen? Driss Mohammed war offensichtlich der Täter. Also hat man ihn gehängt.«
»Aha. Na, wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich weiterlesen.«
Myschkin zuckte mit den Schultern, machte es sich bequem und gab dem Kellner ein Zeichen. Latimer blätterte um und las:
Aussage des Mörders Driss Mohammed in Gegenwart des Kommandanten der Garnison Izmir und anderer zuverlässiger Zeugen.
In der Schrift steht geschrieben, dass nicht gedeihen soll, wer lügt, und ich mache meine Aussage, um meine Unschuld zu beweisen und mich vor dem Galgen zu retten. Ich habe gelogen, aber jetzt werde ich die Wahrheit sagen. Ich bin ein guter Moslem. Es gibt keinen Gott außer Gott.
Ich habe Scholem nicht umgebracht. Ich versichere Ihnen, ich habe ihn nicht umgebracht. Warum sollte ich jetzt lügen? Ich werde es erklären. Nicht ich habe Scholem getötet, Dimitrios ist es gewesen.
Ich werde Ihnen von Dimitrios erzählen, und Sie werden mir glauben. Dimitrios ist ein Grieche. Gegenüber Griechen bezeichnet er sich als Grieche, doch gegenüber Gläubigen behauptet er, er sei auch Moslem, nur für die Behörden sei er ein Grieche, wegen irgendwelcher Papiere, die seine Pflegeeltern unterschrieben haben.
Dimitrios hat mit uns in der Packerei gearbeitet, und viele haben ihn wegen seiner Brutalität und seiner scharfen Zunge gehasst. Aber ich bin ein Mensch, der andere Menschen wie seine Brüder liebt, und ich habe manchmal während der Arbeit mit Dimitrios gesprochen und ihm vom Islam erzählt. Er hat mir immer zugehört.
Als die Griechen dann vor der siegreichen Armee der Gläubigen flohen, kam er zu mir und bat mich, ihn vor den wütenden Griechen zu verstecken. Er bezeichnete sich als Rechtgläubigen. Also habe ich ihn versteckt. Dann kam unsere siegreiche Armee uns zu Hilfe. Dimitrios ging aber nicht weg, weil er wegen dieses Papiers, das seine Pflegeeltern unterschrieben hatten, ein Grieche war und um sein Leben fürchtete. Also blieb er in meinem Haus, und wenn er auf die Straße ging, kleidete er sich wie ein Türke. Eines Tages sprach er dann zu mir. Der Jude Scholem, sagte er, besitzt viel Geld, griechische Münzen und einiges Gold, versteckt unter den Fußbodendielen. Es sei Zeit, sagte er, Rache zu nehmen an denjenigen, die unseren Gott und seinen Propheten beleidigt hätten. Ein Judenschwein, sagte er, dürfe kein Geld besitzen, welches rechtmäßig Gläubigen gehört. Er schlug vor, heimlich zu Scholem zu gehen, ihn zu fesseln und ihm das Geld wegzunehmen.
Zuerst hatte ich Angst, doch er machte mir Mut, erinnerte mich an die Schrift, in der es heißt, dass derjenige, der im Namen Gottes kämpft, ob siegreich oder nicht, reichlich belohnt wird. Das ist jetzt mein Lohn: wie ein Hund aufgehängt zu werden.
Doch weiter. In der Nacht, nach Beginn der Ausgangssperre, gingen wir zu Scholems Haus und stiegen die Treppe zu seinem Zimmer hoch. Die Tür war verriegelt. Da klopfte Dimitrios und rief, wir seien eine Patrouille, wir müssten das Haus durchsuchen. Scholem machte auf. Er hatte schon im Bett gelegen und brummte ärgerlich, dass wir ihn aufgeweckt hätten. Als er uns sah, rief er zu Gott und versuchte, die Tür zu versperren. Aber Dimitrios packte ihn und hielt ihn fest, während ich, wie verabredet, hineinging und nach der lockeren Diele suchte, unter der das Geld versteckt war. Dimitrios zerrte den alten Mann zum Bett und setzte ihm das Knie auf die Brust.
Ich hatte die lockere Diele bald gefunden und drehte mich um, um es Dimitrios zu sagen. Der hatte mir den Rücken zugewandt und erstickte Scholems Schreie mit der Decke. Dimitrios hatte gesagt, er werde Scholem mit der Schnur festbinden, die wir mitgebracht hatten. Jetzt sah ich, wie er das Messer zückte. Da ich glaubte, er wollte die Schnur aus irgendeinem Grund durchschneiden, sagte ich nichts. Und dann, bevor ich etwas sagen konnte, stieß er dem alten Juden das Messer in den Hals und schlitzte ihm die Kehle auf.
Das Blut schoss in hohem Bogen heraus, wie bei einem Springbrunnen, und Scholem fiel zur Seite. Dimitrios trat zurück und sah erst ihn, dann mich an. Ich fragte ihn, was er getan habe, und er antwortete, dass es notwendig sei, Scholem umzubringen, damit er uns nicht bei der Polizei verraten könne. Scholem bewegte sich noch immer auf dem Bett, und das Blut sickerte weiter aus der Wunde, aber Dimitrios sagte, er sei bestimmt tot. Anschließend nahmen wir das Geld.
Dann sagte Dimitrios, dass es besser sei, das Haus nicht zusammen zu verlassen, jeder sollte seinen Anteil nehmen und einzeln hinausgehen. So wurde es vereinbart. Ich hatte Angst, denn Dimitrios hatte ein Messer und ich nicht, und ich glaubte, er wird mich umbringen. Ich überlegte, warum er mir von dem Geld erzählt hatte. Er hatte gesagt, dass er einen Kumpel braucht, der nach dem Geld sucht, während er selbst Scholem festhält. Aber mir war klar, dass er Scholem von vornherein umbringen wollte. Warum hat er mich dann mitgenommen? Er hätte das Geld auch allein finden können, nachdem er den Juden getötet hatte. Aber wir haben das Geld gerecht geteilt, und er hat dabei gelächelt und nicht versucht, mich umzubringen. Wir verließen das Haus jeder für sich. Am Tag zuvor hatte er mir berichtet, dass griechische Schiffe unweit von Izmir vor Anker liegen und dass er einen Mann belauscht habe, der erzählt hatte, dass die Kapitäne dieser Schiffe zahlungskräftige Flüchtlinge mitnähmen. Ich glaube, er ist auf einem dieser Schiffe entkommen.
Ich weiß jetzt, dass ich ein großer Dummkopf war und dass er zu Recht gelächelt hat. Dimitrios wusste: Wenn mein Geldbeutel voll ist, ist mein Kopf leer. Dimitrios, möge Allah ihn verfluchen, hat gewusst, dass ich mich nicht mehr im Zaum habe, wenn ich betrunken bin. Ich habe Scholem nicht umgebracht. Es war der Grieche Dimitrios, der ihn umgebracht hat. Dimitrios … (es folgte ein Schwall von obszönen Ausdrücken, die hier nicht wiedergegeben werden können) … was ich gesagt habe, ist wahr. Ich schwöre bei Allah und Mohammed, seinem Propheten, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ich flehe euch an, seid barmherzig!
Ein Vermerk wies darauf hin, dass Driss Mohammed diese Aussage durch Daumenabdruck bestätigt habe. Weiter hieß es dann:
Der Mörder gab folgende Beschreibung von Dimitrios: Er sieht aus wie ein Grieche, aber ich glaube nicht, dass er einer ist, weil er seine Landsleute hasst. Er ist kleiner als ich, hat langes und glattes Haar. Sein Gesicht ist sehr ruhig, und er spricht wenig. Seine Augen sind braun und sehen müde aus. Viele Menschen fürchten sich vor ihm, was ich aber nicht verstehe, denn er ist nicht stark. Ich könnte ihn mit zwei Händen fertigmachen.
PS: Driss Mohammed ist 1,85 m groß.
In der Packerei wurden Erkundigungen über Dimitrios eingezogen. Er ist dort bekannt und nicht sehr beliebt. Seit einigen Wochen wurde nichts mehr von ihm gehört, und man vermutet, dass er bei dem Brand ums Leben gekommen ist. Das ist durchaus denkbar.
Der Mörder wurde am neunten Tag des zehnten Monats des Jahres 1922 neuer Zeitrechnung hingerichtet.
Latimer nahm sich das Geständnis vor und las es noch einmal sorgfältig durch. Es klang authentisch, keine Frage. Es war sehr ausführlich. Driss war offenkundig ein sehr dummer Mensch gewesen. Hätte er die ganzen Einzelheiten der Szene in Scholems Wohnung erfinden können? Ein Schuldiger, der sich eine Story ausdenkt, hätte sie gewiss anders ausgeschmückt. Da war ja auch seine Angst, Dimitrios könne ihn umbringen. Wenn er den Mord begangen hätte, wäre er kaum auf diesen Gedanken gekommen. Laut Oberst Hakki war es eine Geschichte, wie sie ein Mensch erfindet, der seine Haut retten will. Angst konnte tatsächlich noch den phantasielosesten Tölpel beflügeln, aber auf diese Weise? Den Behörden war es offensichtlich egal gewesen, ob die Geschichte stimmte oder erfunden war. Sie hatten nachlässig ermittelt; trotzdem hatte sich die Darstellung von Driss Mohammed bestätigt. Man vermutete, Dimitrios sei bei dem Feuer ums Leben gekommen. Ein Beweis für diese These wurde nicht beigebracht. Bestimmt war es einfacher gewesen, Driss Mohammed zu hängen, als in dem schrecklichen Chaos jener Oktobertage nach einem Griechen namens Dimitrios zu suchen. Damit hatte Dimitrios natürlich gerechnet. Und wäre der Oberst nicht zum Geheimdienst versetzt worden, wäre in dieser Angelegenheit nie ein Bezug zu Dimitrios hergestellt worden.
Latimer erinnerte sich an einen befreundeten Zoologen, der aus dem Splitter eines fossilisierten Knochens das vollständige Skelett eines prähistorischen Tiers rekonstruiert hatte. Fast zwei Jahre hatte der Mann dafür gebraucht, und Latimer, der Wirtschaftswissenschaftler, hatte über die unerschöpfliche Begeisterung des Zoologen für seine Sache gestaunt. Jetzt verstand er diese Begeisterung. Er hatte ein Fragment aus der Gedankenwelt dieses Dimitrios ausgegraben und wollte das Bild nun vervollständigen. Es war ein kleines, aber wichtiges Fragment. Der arme Driss hatte keine Chance gehabt. Dimitrios hatte seine Dummheit ausgenutzt, sich seines religiösen Fanatismus bedient, seiner Einfalt, seiner Habgier – und zwar mit beängstigendem Geschick. »Wir haben das Geld gerecht geteilt, und er hat dabei gelächelt und nicht versucht, mich umzubringen.« Dimitrios hatte gelächelt. Und Driss’ Angst vor dem Mann, dem er die Knochen hätte brechen können, war viel zu groß, als dass er über dieses Lächeln hätte nachdenken können, solange es noch nicht zu spät war. Die braunen, müde wirkenden Augen hatten Driss Mohammed beobachtet und durchschaut.
Latimer faltete die Seiten zusammen, steckte sie in ein Kuvert und wandte sich wieder Myschkin zu.
»Ich schulde Ihnen noch einhundertfünfzig Piaster.«
»Stimmt«, sagte Myschkin in sein Glas. Er trank seinen dritten Absinth aus. Er setzte das Glas ab und nahm das Geld. »Ich finde Sie sympathisch«, sagte er ernst. »Sie sind kein Snob. Kann ich Sie jetzt zu einem Drink einladen?«
Latimer sah auf seine Uhr. Es war schon spät, und er hatte noch nichts gegessen. »Gern«, sagte er, »aber zuerst sollten wir etwas essen, ich lade Sie ein.«
»Ausgezeichnet!« Myschkin stand mühsam auf. »Ausgezeichnet!«, wiederholte er, und Latimer sah, dass seine Augen unnatürlich glänzten.
Auf Vorschlag des Russen gingen sie in ein Restaurant mit französischer Küche, gedämpftem Licht, rotem Plüsch und Gold und fleckigen Spiegeln. Das Lokal war voll und verräuchert. Viele Gäste waren Schiffsoffiziere, aber die meisten trugen Militäruniform. Es gab ein paar unangenehm aussehende Zivilisten und nur sehr wenige Frauen. In einer Ecke mühte sich eine Kapelle mit einem Foxtrott ab. Ein schlecht gelaunter Kellner führte sie zu einem Tisch. Sie setzten sich in gepolsterte Stühle, aus denen Wolken von altem Parfüm hochstiegen.
»Also«, sagte Myschkin und sah sich um. Er griff nach der Speisekarte und entschied sich nach einigem Überlegen für das teuerste Gericht. Zum Essen tranken sie einen süßlichen, geharzten Smyrna-Wein. Myschkin begann, von seinem Leben zu erzählen. Odessa 1918. Istanbul 1919. Izmir 1921. Die Bolschewiken. Wrangel-Armee. Kiew. Eine Frau, die überall nur ›die Schlächterin‹ hieß. Der Schlachthof, der als Gefängnis diente, weil das Gefängnis ein Schlachthof geworden war. Furchtbare, entsetzliche Gräueltaten. Die alliierten Besatzungstruppen. Die anständigen Engländer. Die amerikanischen Hilfslieferungen. Wanzen im Bett. Typhus. Vickers-Geschütze. Die Griechen – Gott, diese Griechen! Reichtum, der auf der Straße lag. Die Kemalisten. Seine Stimme dröhnte immer weiter, während sich draußen, hinter dem Zigarettenrauch, hinter dem roten Plüsch und dem Gold und den weißen Tischtüchern, das amethystfarbene Dämmerlicht in Nacht verwandelte.
Noch eine Flasche süßlichen Weins wurde gebracht. Latimer fühlte sich schläfrig.
»Und nach so viel Wahnsinn, wo sind wir jetzt?«, rief Myschkin. Sein Englisch war immer schlechter geworden. Mit feuchter und zitternder Unterlippe fixierte er Latimer mit dem starren Blick des Betrunkenen, der im nächsten Moment zu philosophieren beginnt. »Wo?«, wiederholte er und schlug mit der Hand auf den Tisch.
»In Izmir«, sagte Latimer, und plötzlich merkte er, dass auch er zu viel getrunken hatte.
Myschkin schüttelte gereizt den Kopf. »Wir fahren schnell zur Hölle«, erklärte er. »Sind Sie Marxist?«
»Nein.«
Myschkin beugte sich vertraulich vor. »Ich auch nicht.« Er zupfte Latimer am Ärmel. Seine Lippe zitterte heftig. »Ich bin ein Betrüger.«
»Ach ja?«
»Ja.« Tränen traten ihm in die Augen. »Ich habe Sie betrogen.«
»Wirklich?«
»Ja.« Er wühlte in seiner Tasche. »Sie sind kein Snob. Sie müssen die fünfzig Piaster zurücknehmen.«
»Wieso denn?«
»Nehmen Sie.« Die Tränen liefen ihm über die Wange und vermischten sich mit dem Schweiß, der sich an seiner Kinnspitze gesammelt hatte. »Ich habe Sie betrogen, Monsieur. Es gibt gar keinen Bekannten, den ich bezahlen musste, keine Erlaubnis, nichts.«
»Soll das heißen, Sie haben dieses Protokoll erfunden?«
Myschkin richtete sich auf. »Ich bin doch kein Urkundenfälscher!«, erklärte er mit mahnend ausgestrecktem Zeigefinger. »Vor drei Monaten kam dieser Typ zu mir. Durch massive Bestechung« – der Finger wackelte heftig –, »mit viel Geld hatte er sich die Genehmigung besorgt, im Archiv nach der Akte im Mordfall Scholem zu suchen. Die Akte war in der alten arabischen Schrift geschrieben, und er brachte Fotografien der Seiten, die ich dann übersetzen sollte. Die Fotografien hat er wieder mitgenommen, aber die Übersetzung habe ich behalten. Verstehen Sie? Ich habe Sie betrogen. Sie haben mir fünfzig Piaster zu viel bezahlt. Pfui!« Er schnipste mit den Fingern. »Ich hätte Ihnen fünfhundert Piaster abknöpfen können, Sie hätten bezahlt. Ich bin zu weich.«
»Was wollte er mit der Information?«
Myschkin schaute pikiert. »Das geht mich doch nichts an!«
»Wie hat er ausgesehen?«
»Wie ein Franzose.«
»Was für ein Franzose?«
Aber Myschkins Kopf war vornübergesunken. Er antwortete nicht. Nach einer Weile hob er den Kopf und starrte Latimer ausdruckslos an. Sein Gesicht war blass, und Latimer schien es, als würde ihm jeden Moment schlecht werden. Seine Lippen bewegten sich.
»Bin doch kein Urkundenfälscher«, murmelte er. »Dreihundert Piaster, spottbillig!« Plötzlich stand er auf und flüsterte: »Entschuldigen Sie mich«, und eilte zur Toilette.
Latimer wartete eine Weile, bezahlte dann und beschloss, nachzusehen. Es gab noch einen zweiten Eingang zur Toilette. Myschkin war verschwunden. Latimer ging zu Fuß zu seinem Hotel zurück.
Von dem Balkon vor seinem Zimmer konnte er über die Bucht bis zu den Hügeln am Horizont sehen. Der Mond stand am Himmel, und sein Licht schimmerte durch das Kranengewirr am Hafen, wo die Schiffe lagen. Die Suchscheinwerfer eines türkischen Kreuzers draußen vor der Reede streiften wie lange weiße Finger über die Gipfel der Berge und verloschen. Im Hafen und an den Berghängen oberhalb der Stadt flimmerten winzige Lichter. Eine leichte warme Brise vom Meer her bewegte die Blätter des Gummibaums im Garten. In einem anderen Hotelzimmer lachte eine Frau. Irgendwo in der Ferne spielte ein Grammophon einen Tango. Der Plattenteller drehte sich zu schnell, die Musik klang schrill und verzerrt.
Latimer zündete sich eine letzte Zigarette an und überlegte zum hundertsten Mal, was der Mann, der wie ein Franzose aussah, mit der Akte zum Mordfall Scholem wollte. Schließlich warf er die Zigarette achselzuckend weg. Eines stand fest: Er konnte unmöglich an Dimitrios interessiert sein.