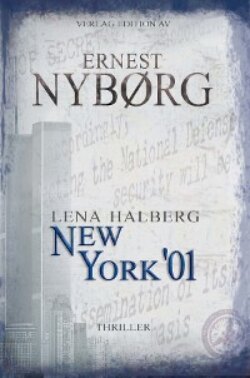Читать книгу LENA HALBERG - NEW YORK '01 - Ernest Nyborg - Страница 11
3
Оглавление»Cesare Ducca, mein Bankier. Sarah, meine Entwicklungschefin, kennen sie ja«, stellte Bronsteen die beiden General Ndogar vor, als sie in den Room Kotangou kamen, so der klingende Name für den kleinen Sitzungssaal, den sie für das Meeting reserviert hatten. Wie üblich standen mehrere schwere Ledersessel mit gepolsterten Armlehnen rund um den Konferenztisch. Die dunklen Wandtäfelungen und das indirekte Licht verbreitete eine gediegene Atmosphäre, nur der Teppichboden mit dem braunen Kreismuster wirkte billig.
Der General nickte kurz, gab allerdings keinem die Hand. Er deutete auf die beiden Männer, die hinter ihm standen.
»Minister Tounambani vom Bergbauministerium, Mérou mein persönlicher Sicherheitsberater.«
Bronsteen deutete auf die Stühle und man setzte sich. Nur Ndogars Sicherheitschef machte zwei Schritte zurück und blieb neben der Tür stehen. Sarah wunderte sich über ihn, denn er wirkte überhaupt nicht wie die üblichen Securitys. Er war schlank und sportlich, hatte ein schmales Gesicht mit einer feinen Narbe vom linken Auge bis hinunter zum Hemdkragen und längeres, vorne leicht schütteres Haar. Vor allem aber: Mérou war weiß.
Ndogar lehnte sich zurück und machte eine große Geste.
»Unser Land ist voll von Rebellen, versprengten Splittergruppen und organisierten Aufständischen – eine schwer zu kontrollierende Situation. Unsere Truppe ist klein und schlecht ausgerüstet«, er sprach Englisch ohne jeden Akzent, »ein Drittel davon sind überhaupt nur Gendarmen, die wir nach Erfordernis eingliedern. Deshalb sind wir, unabhängig was Sie in humanitärer Absicht für unsere Kinder vorhaben, interessiert an Ihrem Zusatzangebot, was die Modernisierung unserer Streitkräfte betrifft.«
Bronsteen schmunzelte kurz und nickte Ndogar zu. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können, dachte er dabei.
Ndogar hob sich von den anderen Militärs des Landes ab. Er wirkte gebildet und redegewandt und trug auf seiner Uniform keine bunten Orden, sondern nur die goldenen Rangabzeichen. Der junge schwarze Zweimetermann mit Glatzkopf gehörte zweifellos zur Elite des Landes und war von einem mächtigen Clan gefördert worden. Sie schickten ihn nach Paris, um ein Studium der Rechte zu absolvieren, bevor er in die Armee eintrat, wo er gleich als höherer Offizier begann. Der erkaufte Rang war nicht billig, machte sich für den Clan aber schon nach kurzer Zeit bezahlt, denn Ndogar schützte seine Leute während des Bürgerkriegs mit einer beachtlichen Privatarmee.
Er selbst wurde bei den Kämpfen schwer verletzt und nach der Vertreibung des Rebellenregimes direkt als General der Bodentruppen eingesetzt. Nun saß er an der Quelle der Macht und laut Bronsteens Informationen war er – durch Geschäfte in der Grauzone zwischen staatlicher Erfordernis und einem ausgeprägten Verlangen nach hohen Schmiergeldern – in den letzten Jahren zu einem wohlhabenden Mann aufgestiegen.
»Es wäre daher freundlich«, unterbrach Ndogar Bronsteens Gedanken, »wenn Sie Ihre Offerte etwas präzisieren würden.«
»Vor allem die Finanzierungsmöglichkeiten, die sie mir angedeutet haben«, warf Tounambani ein, was ihm einen abschätzigen Blick von Ndogar eintrug. Der Politiker wich dem Blick aus und begann in seiner Aktentasche zu kramen – er stand also eindeutig eine Stufe unter dem Militär.
»Nun, General, es wäre eine spannende Aufgabe für mein Unternehmen, Ihnen bei der Neuausstattung Ihrer Armee in waffentechnischer Hinsicht unter die Arme zu greifen«, sagte Bronsteen. »Die Details sind für Sie vorbereitet.«
Er deutete auf Sarah, die für jeden der Anwesenden eine Mappe mit Aufstellungen und Fotografien ausgedruckt hatte und nun in der Runde verteilte. Dabei handelte es sich um Rüstungsgerät für Bodentruppen aus ehemaligen Beständen der Warschauer-Pakt-Staaten, das im südlichen Ural lagerte. Im Wesentlichen standen dort zweihundert Jagdpanzer, ein Dutzend Kampfhubschrauber mit Raketenbestückung, bewegliche Artillerie und an die hunderttausend Landminen. Einen Großteil der Gerätschaften hatte Bronsteens Vater seinerzeit an Moskau geliefert. Nun war über den Mittelsmann eines russischen Oligarchen der Rückkauf angeboten worden.
»… gesamt wäre der Preis vierhundert Millionen Dollar, dafür bekämen Sie normalerweise nicht einmal die Helikopter«, beendete Bronsteen seine Erklärungen zu der Aufstellung. »Außerdem bestünde im Normalfall auch das Problem einer Lieferung in ein Krisengebiet.«
»Für Sie kein Problem?«, wollte Tounambani wissen.
»Nein, wir haben da als Bank sehr gute Beziehungen in die Länder Südamerikas«, warf Ducca ein, »dort ist man wesentlich ungezwungener in der Abwicklung derartiger Aufträge, unsere Partner sind da sehr diskret.«
»Und das Finanzierungsmodell?«
»Ist ganz einfach ein Barter-Deal, ein einfacher Tauschhandel, also ganz afrikanisch.« Der gezwungene Scherz kam nicht an. Ndogar zog nur verständnislos eine Augenbraue hoch. Ducca beeilte sich sachlich fortzufahren. »Die Banco Merini gewährt Ihnen am Papier ein Darlehen über die vierhundert Millionen für den Waffenkauf und wir erhalten dafür einen gleichwertigen Anteil an den Uran-Schürfrechten. Unsere Gewinne aus dem Weiterverkauf dieser Rechte, abzüglich der üblichen Unkosten, sind dann die Rückzahlung des Kredites. Somit genügt für die Finanzierung Ihre Unterschrift.«
»Und wie wäre der Rücklauf?«, erkundigte sich Ndogar ungeduldig, da ihm die Details der Finanzierung nicht interessierten, das war die Angelegenheit von Politikern.
»Fünf Prozent auf ein neutrales Nummernkonto in der Schweiz oder wo Sie sonst möchten. Die Provision ist zahlbar nach erfolgtem Beginn des Uranabbaus.«
»Nach Beginn des Abbaus?«, wurde Ndogar hellhörig. »Wäre da nicht im Voraus eine gewisse Summe …«
»Das machen wir nicht einmal beim Präsidenten der Vereinigten Staaten«, unterbrach ihn Bronsteen sofort mit einem feinen Lächeln. »Wenn das ein Problem ist, dann sollten wir die Waffenlieferung auf Eis legen und uns nur auf das Projekt mit den Kindern konzentrieren.«
Ndogar fixierte Bronsteen mit einem harten Blick, der diesen jedoch mit seinem verbindlichen Lächeln auf den Lippen standhielt. Die Stimmung war eisig geworden. Ducca stand aber dennoch der Schweiß auf der Stirn.
Das einzige Geräusch in der momentanen Stille war ein verlegenes Räuspern von Tounambani, der auf einen positiven Ausgang hoffte, immerhin würde er die Hälfte des Schmiergeldes kassieren. Die Verträge für das Uran waren mit Ducca schon vorweg besprochen und von Tounambani ausgestellt worden.
Ndogar schob mit einer forschen Bewegung den Stuhl zurück und stand auf.
»Fünf Prozent in der Schweiz sind ausgezeichnet«, sagte er und streckte Bronsteen die Hand hin.
»Ich weiß, General«, antwortete dieser.
Nach der Besprechung verließ Ndogar, begleitet von seinem Sicherheitsberater Mérou, der ihm wie ein Schatten folgte, das Hotel, Tounambani ging alleine Richtung Hotelbar und Sarah ging auf ihr Zimmer. Sie war froh aus den Klamotten und unter kaltes Wasser zu kommen. Bronsteen gab Ducca einen Wink, er möchte noch bleiben.
»Ausgezeichnet Cesare«, meinte er, als sie alleine waren, »und Tounambani hat die Verträge für uns ausgestellt?«
»Ja, die Vorgespräche mit ihm liefen problemlos und er hat mir die Entwürfe nach Rom gemailt«, antwortete Ducca und goss sich ein Glas Eiswasser ein. »Es war nur noch offen, ob wir hier ohne viel Aufsehen agieren können, was jetzt mit dem UNICEF-Projekt kein Problem ist, und ob Ndogar der Sache zustimmt.«
»Was auch kein Problem war«, grinste Bronsteen und legte die Füße gemütlich auf den Nebenstuhl. »Immerhin winken sehr viele Millionen, wenn das Geschäft einmal läuft. Da war die langfristige Gier dann doch größer …«
Ducca stand auf, ging um den Tisch und nahm eine der Mappen mit den Details.
»Che bello«, sagte er, »die eigenen Lieferungen von den Russen billig zurückzukaufen und den Afrikanern nochmals zu verhökern.«
»Na billig sind sie nicht. Raskonow will zweihundertfünfzig dafür, der ist wahnsinnig. Der muss erst jemanden finden, der ihm den Schrott abkauft. Die Panzer sind dreißig Jahre alt, den Deal hat noch mein Vater abgeschlossen. In den Achtzigerjahren! Deshalb fährst du Ende nächster Woche zu der Besichtigung und den Verhandlungen nach Meschgorje. Mehr wie hundertachtzig zahlen wir nicht dafür.«
»Für den Termin hab ich Julio …«, versuchte Ducca das noch abzuwenden.
»Du fährst nach Russland, Cesare, nicht dein Consigliere, haben wir uns da verstanden?« Bronsteen nahm die Füße vom Stuhl und stand auf. »Du musst den Preis um siebzig Millionen drücken, das sind auch deine siebzig Millionen und das ist nicht der Job eines Anwalts.«
»Okay, okay!« Ducca hob beschwichtigend die Hand. »Ich fahre ja.«
Alles Idioten, dachte Bronsteen, wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen. Nur weil er lieber zu Hause Maserati fährt, als bei den Russen nach dem Rechten zu sehen, will er einen Angestellten schicken.
»Ich bin im Fitness-Center«, brummte er verärgert und ging grußlos hinaus.
»Dio, mio!« fauchte Ducca, nachdem die Tür wieder zugefallen war. »Erst Afrika, dann Russland, langsam fühle ich mich zu alt für so einen Scheiß.«
Er leerte den Rest des Eiswassers hinunter. Dann griff er zum Telefon und bestellte ein Chateaubriand, medium rare, mit gebratenen grünen Bohnen, Kräuterbutter und Kresse, von der Steakkarte aufs Zimmer. Dazu eine Flasche Rotwein – südafrikanischen Pinotage, den die Küche dazu empfahl. Er würde duschen und den positiven Abschluss des Vertrages mit einem ausgiebigen Essen feiern. Hunger hatte er ausreichend, denn er war seit dem Frühstück unterwegs und der Snack im Flugzeug war mager gewesen.
Langsam leerte sich nun auch die Terrasse des Hauses, als Bronsteen zu seiner Suite ging um sich frisch zu machen. Verschiedene Gruppen saßen noch plaudernd im Schatten der großen Sonnenschirme, hauptsächlich die Frauen der Politiker. Sie nutzen das Treffen für einen ausgiebigen Smalltalk über Mode und die neuesten Faceliftings der afrikanischen Society.
Die Journalisten und Redakteure der Zeitungen hatten sich ins improvisierte Pressefoyer zurückgezogen, schrieben ihre Artikel oder luden die Fotos des Events auf die Websites ihrer Agenturen. Nur einer saß schwer angetrunken im Vorraum und grinste blöd in sein Handy, auf dem er offensichtlich versuchte eine SMS zu tippen.
Vor dem Hotel war ein Tumult zu hören. Bronsteen verhielt den Schritt vor einer Fensterwand. Draußen, zwischen der Umzäunungsmauer und dem Eingang, drängte sich eine Gruppe von Aktivisten. Sie hatten Sprüche wie: Keine Kinder für Waffenschieber, Wir haben genug vom Krieg oder Ami go home auf Papptafeln gemalt und auf lange Holzlatten genagelt. Die hielten sie schimpfend hoch und drohten mit den Fäusten in Richtung Hotel. Die kleine Menge bestand fast nur aus Frauen mit Kindern, darunter auch Weiße.
Manche Leute sind eben gegen alles, sogar wenn man als Wohltäter ins Land kommt, die demonstrieren immer, dachte Bronsteen. Insgeheim verfluchte er das Internet. Früher sprachen sich Besuche erst herum, wenn die Zeitungen am nächsten Tag darüber berichteten. Jetzt, mit der globalen Vernetzung, standen diese penetranten Aufrührer, die versuchten jeglichen Fortschritt zu blockieren, bereits am Flugfeld, wenn man ankam. Wahrscheinlich waren es auch diesmal seine Intimfeinde, die er unter dem Begriff Grüne zusammenfasste.
Zwei graue Armee-Hummer bogen in die Einfahrt und hielten in einer Staubfahne rechts und links von den Demonstranten. Mehrere Soldaten sprangen heraus und begannen mit Schlagstöcken wahllos auf die Gruppe einzudreschen. Die Frauen ließen die Tafeln fallen und flüchteten zum Tor zur Straße.
Eine der weißen Frauen stolperte über eine schmiedeeiserne Einfassung, die eine Grünfläche vom Beton trennte, und fiel der Länge nach aufs Gesicht. Mühsam rappelte sie sich auf. Der Soldat, der neben ihr stehengeblieben war, schlug ihr weit ausholend mit dem Knüppel auf den Hinterkopf. Sie rannte taumelnd weiter, während Blut aus ihrem hellen Haar zu rinnen begann.
Es dauerte keine fünf Minuten und die Auffahrt des Hotels war geräumt. Der Auflauf war vorbei. Ein Hotelboy kam dienstbeflissen, sammelte die Papptafeln ein und säuberte die Grünflächen.
»Das sollten unsere Unruhestifter einmal sehen«, murmelte Bronsteen und ging weiter durch den Flur zur Suite, »dann wüssten sie, wie human wir sie in den Staaten behandeln.«
Es war gegen Abend, als Tounambani vor dem vereinbarten privaten Treffen mit Bronsteen in die Bar Ambassadeur des Hotels kam. Obwohl das Licht angenehm gedämpft brannte, war sie nicht besonders gemütlich. Die großen dunklen Holzsäulen, die einen indirekt beleuchteten Himmel trugen, strahlten einen protzigen Charme aus. Und auch die durchgehenden Sitzbänke an den Wänden rundum wirkten nicht sehr einladend.
Tounambani sah sich um, dann winkte er dem Kellner und bestellte einen Whisky sauer, den er direkt ins angrenzende Billardzimmer bringen ließ, das er für das Treffen reserviert hatte. Er legte darauf Wert, bei einer Verabredung von Dingen abseits der regulären Angelegenheiten, ohne unliebsame Zuhörer zu sein. Die Vorsicht war ihm angeboren. Tounambanis Eltern stammten ursprünglich aus Zaire, dort war auch er noch geboren worden. Sein Vater, ein einfacher Lehrer, flüchtete bei Beginn der verheerenden Bürgerkriege und über mehrere Umwege landete die Familie schließlich in Bangui. Niemand hätte vermutet, dass aus dem kleinen Einwanderer einmal ein bekannter Politiker des Landes werden würde.
Alles, wovon er geträumt hatte – eine Position mit Einfluss und den Zugang zur privilegierten Schicht – erfüllte sich mit seiner Ernennung zum Minister. Dem kleinen, unscheinbaren und nicht sehr klugen Kind gelang es als Erwachsener, nachdem er eine politische Laufbahn als passend für sich entdeckt hatte, diese Eigenschaften zu seiner Stärke zu wandeln. Er begriff, dass man rascher auf eine entscheidende Position kam, wenn andere dachten, man wäre leicht zu beeinflussen. Mit einer ungeheuren Bauernschläue und großem Opportunismus manövrierte er sich geschickt nach oben. Binnen weniger Jahre baute er mit einigen treu Ergebenen eine brauchbare Seilschaft auf, die man zu fürchten begann. Wer sich nicht im akzeptierten Kreis bewegte, wurde gnadenlos verfolgt – entweder denunziert oder gleich eliminiert.
Bei der Vertreibung der Rebellen stärkte Tounambani gerade noch rechtzeitig die Seite Ndogars, der sich dafür revanchierte und ihn als Leiter des Ministeriums für Bergbau und Energiegewinnung vorschlug. Von den anderen wagte es niemand, dem Rat des neuen starken Mannes der Armee zu widersprechen. Ndogar erkaufte sich mit dem Schachzug ein komplettes politisches Netzwerk zur eigenen Absicherung.
Das Ministerium war klug ausgewählt, denn Tounambani erhielt damit die Kontrolle über alle wesentlichen Rohstoffe und Bodenschätze. Mit Hilfe von Ndogars Milizen waren die beiden ein gefährliches Gespann und machten inzwischen ein kleines Vermögen mit Diamantenschieberei und undurchsichtigen Landvergaben an windige ausländische Investoren. Der Deal mit Bronsteen und die Neuordnung der Schürfrechte an den Uranvorkommen, bislang exklusiv in den Händen eines staatlichen französischen Konzerns, war die vorläufige Krönung ihrer Aktivitäten, da ein finanzieller Rücklauf in zweistelligen Millionenbeträgen zu erwarten war. Die möglichen Gewinne aus korrupten Unternehmungen erreichten ein bis dahin ungeahntes Ausmaß.
»Guten Abend, Herr Minister«, sagte Bronsteen.
Tounambani, der mit seinem Whiskyglas in der Hand auf einem der Marmortische an der Seitenwand lehnte, war so in Gedanken gewesen, dass er kurz zusammenzuckte.
»Guten Abend.«
Bronsteen nickte kurz und schob dann einen Stuhl aus hellgrauem Samt zur Seite, der ihm den Weg zur Glasvitrine mit den Billard Queues verstellte. Bronsteen war ein Liebhaber des Spiels und hatte auch einen eigenen Tisch in seiner Residenz in Baltimore. In technischer Hinsicht konnte er es locker mit Profis aufnehmen und liebte das Spiel über die Bande, eine besonders schwierige Variante des Billards. Er öffnete den Schrank, fuhr prüfend über die Schäfte und wählte dann einen Karambol Queue aus marmoriertem Ahorn mit heller Spitze und Einlagen aus Ebenholz, den er prüfend in der Hand wog.
»So muss sich fremdgehen anfühlen, denke ich«, schmunzelte er, der selbst eine Sammlung erlesener handgefertigter Queues besaß, wovon manche mehrere tausend Dollar gekostet hatten, »aber ich bin zum Glück weder verheiratet noch anderweitig liiert.«
»Ah, ich dachte Madame Sarah …«
»Sie ist meine Entwicklungschefin und ich pflege keine intimen Verhältnisse mit Angestellten«, beendete Bronsteen die Fragen nach seinem Privatleben knapp.
Er bestellte einen doppelten Espresso. Bei dienstlichen Anlässen und Gesprächen behielt er gerne einen klaren Kopf und trank nie Alkohol. Überdies lockte ihn das Spiel als Entspannung nach dem vollen Tag. Er war nach elf Stunden Flug im Privatjet erst mittags aus Baltimore gekommen und genoss die ruhige konzentrierte Atmosphäre des abgegrenzten Lichts über dem grünen Tisch.
»Spielen Sie eine Partie mit?«, fragte er in Richtung Tounambani, während er die Kugeln auf den Anstoß legte.
»Ich sehe Ihnen lieber zu«, beeilte sich dieser zu sagen, denn er hatte noch nie im Leben so einen Holzstock in der Hand gehabt und fand es auch sinnlos damit eine Kugel anzustoßen, um zwei andere zu treffen. Er hatte auch nicht angenommen, dass Bronsteen das Spiel beherrsche, sondern den Ort nur gewählt, weil er als einziger Gesellschaftsraum die Möglichkeit bot, die Tür zu schließen und unbeobachtet zu sein.
Bronsteen stieß an und trieb mit den ersten Spielzügen die Kugeln an der Bande entlang.
»Es kommt darauf an, nicht über die Bewegung nachzudenken, sie geschieht von selbst, wenn man bereit ist.« Er fixiert Tounambani über den Queue gebeugt und führte den Stoß aus ohne hinzusehen. Sanft über eine Seitenbande gespielt lief die Kugel über den Tisch und touchierte dann mit einem leisen Ton die beiden anderen. »Der Punkt der Berührung steht fest bevor der Lauf beginnt. Haben Sie sich je mit Zen beschäftigt?«
Tounambani schüttelte den Kopf, ohne wirklich zu wissen was Bronsteen meinte. Eigentlich war er hier um die Details wegen des Kinderprojekts zu besprechen. Er sah auf die Uhr.
Bronsteen war scheinbar vollkommen in das Spiel versunken, in Wahrheit jedoch ließ er Tounambani nur ein wenig zappeln. Er spielte ohne Eile noch eine Runde um den Tisch, dann stellte er den Queue ab und ging zu Tounambani hinüber.
»Aber warum wir hier sind«, sagte er knapp. »Sie erhalten wie angekündigt die fünf Millionen Dollar als offiziellen Betrag für das Projekt und wickeln es als Vertrauensmann in unserem Sinne ab.«
Tounambani nickte heftig. Er war dankbar, dass es nun zur Sache ging.
»Fünfhunderttausend sind für das Freikaufen der ersten fünfzig Kindersoldaten«, fuhr Bronsteen fort, »Zehntausend pro Kind, das muss reichen, mehr zahlen wir den Rebellen nicht, und fünfhunderttausend sind für Ihre persönlichen Aufwendungen. Für die restlichen vier Millionen, bekomme ich die vereinbarte Ware.«
»Verstanden, alles wie ich es schon mit Senator Prow abgemacht habe. Schade, dass er heute nicht hier sein kann.«
»Vom Senator musste ich mich leider trennen, der arbeitet nicht mehr für mich«, sagte Bronsteen knapp und senkte die Stimme. »Nach außen hin darf von unserer Vereinbarung nichts durchdringen, sonst zerreißt uns die Presse.«
»Das wird es nicht, keinesfalls. Es bleibt unter uns!«, versicherte Tounambani schnell, um nachdrücklich fortzufahren. »Auch Sie, bitte, kein Wort zu General Ndogar, er bekommt seine Ausrüstung für die Armee, das ist sein Hauptinteresse. Alles andere ist allein unsere Sache!«
Bronsteen nickte. Wusste ich’s doch, dachte er dabei, es ist zu verlockend und du teilst dein Schmiergeld nicht.
»Leben Sie wohl, Herr Minister, einen angenehmen Abend noch«, sagte er und wendete sich dem Billardtisch zu.
Nachdem Tounambani die Tür hinter sich geschlossen hatte und rührte Bronsteen Zucker in seinen kalten Kaffee.
»Die Krähen hacken sich doch gegenseitig die Augen aus«, murmelte er amüsiert. »Aber sie fürchten sich davor, dabei überrascht zu werden.«
Er nahm den Queue wieder auf.