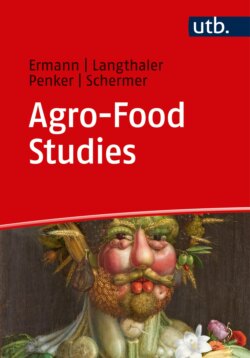Читать книгу Agro-Food Studies - Ernst Langthaler - Страница 10
Оглавление3. Globalisierung und Regionalisierung
Globalisierte Wertschöpfungsketten verknüpfen arbeitsteilige Produktions- und Verarbeitungsschritte in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Die Liberalisierung und Öffnung nationaler Märkte, technische Innovationen und die Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung nach günstigen und vielfältigen Lebensmitteln haben zu immer längeren Wertschöpfungsketten geführt. Gleichzeitig bemühen sich immer mehr KonsumentInnen, Betriebe und Initiativen, aber auch ganze Regionen aus unterschiedlichsten Motiven um kurze, regionale Wertschöpfungsketten und deren stärkere Einbettung in regionale Sozialstrukturen. Das Konzept der sozialen Einbettung hilft, Lebensmittelketten und ihre AkteurInnen hinsichtlich der Intensität ihrer sozialen Interaktion zu betrachten. Es verdeutlicht, dass die Zahl der entlang der Wertschöpfungskette interagierenden AkteurInnen sowie deren soziale und geografische Nähe zueinander unterschiedliche Formen der Organisation, Regulierung und Kontrolle bedingen. Das Kapitel präsentiert aus der Perspektive der sozialen Einbettung zunächst Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse getrennt voneinander, um dann die vermeintliche Dichotomie als Kontinuum sozialer Einbettung zusammenzuführen. International vertriebene Lebensmittel mit bekannter geografischer Herkunft zeigen, wie sich Vorteile der Einbettung in regionale Sozialstrukturen mit dem globalen Handel verbinden lassen.
3.1 Einführung anhand des Konzepts der sozialen Einbettung
Supermärkte bieten uns das ganze Jahr günstige Lebensmittel aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Was viele als großartige Errungenschaft bewerten, motiviert andere, besonderes Augenmerk auf regional produzierte Lebensmittel zu legen. Galten früher exotische Speisen als Statussymbol, wurden in den letzten Jahren regionale Lebensmittel zur Ausdrucksform eines nachhaltigen Lebensstils besser verdienender und höher gebildeter Gruppen. Aber macht es einen Unterschied, ob wir Lebensmittel von Betrieben aus der Region oder aus anderen Teilen der Welt beziehen? Mithilfe des Konzepts der Einbettung soll der Verknüpfung zwischen Essen und den in konkreten Regionen verankerten menschlichen Beziehungen, ökologischen und institutionellen Strukturen der Lebensmittelversorgung auf die Spur gegangen und eine Auflösung des Gegensatzes zwischen global und regional versucht werden.
Das von Karl Polanyi (2001) geprägte und von der Wirtschaftssoziologie und den kritischen Food Studies neu gedeutete Konzept der Einbettung (→ embeddedness) wird breit genutzt, um Produktions- und Distributionssysteme (auch solche von Lebensmitteln) hinsichtlich ihrer Verankerung in sozialen und institutionellen Strukturen zu beurteilen. Polanyi argumentiert, dass ökonomisches Handeln in vormarktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften in Sozialbeziehungen wie Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Solidarverpflichtungen eingebettet sei. Der Kapitalismus würde – in enger Kooperation mit dem Nationalstaat – wirtschaftliches Handeln zunehmend von sozialen Beziehungen entbetten. Damit kontrastiert er in soziale Beziehungen eingebettete (vorkapitalistische) und entbettete (kapitalistische) Gesellschaften und hinterfragt die auch durch die → Globalisierung vorangetriebene Dominanz des Marktes über die Gesellschaft. Laut Giddens (1995, 33) geht die Globalisierung, welche u. a. durch die Ausweitung der Reichweite individuellen Handelns gekennzeichnet ist, einher mit einer „Entbettung“ des Lebens (disembedding). Darunter versteht er das Herausheben sozialer Beziehungen aus örtlich begrenzten und normativ verfestigten Interaktionszusammenhängen. Zusätzlich wird das Vertrauen in abstrakte Systeme zu einer Voraussetzung für das Funktionieren des Alltags (Giddens 1995).
Granovetter (1985) stellt das untersozialisierte Menschenbild des homo oeconomicus der neoklassischen Ökonomie und einer von sozialen Beziehungen entbetteten kapitalistischen Produktion auf der einen Seite dem übersozialisierten Strukturalismus der Soziologie und dessen Verständnis eines in Verwandtschafts-, Nachbarschafts- und Freundschaftsbeziehungen eingebetteten Warenaustauschs auf der anderen Seite gegenüber. Er argumentiert, dass letztlich alle ökonomischen Transaktionen auf sozialen Beziehungen beruhen und es daher nicht um die Frage geht, ob ein Produktionssystem in soziale Beziehungen eingebettet ist oder nicht, sondern um den Grad und die Art der sozialen Einbettung. Auch unterstreicht er die Bedeutung sozialer Beziehungen für die Schaffung von Vertrauen als Voraussetzung für ökonomische Transaktionen (Granovetter 1985).
In einem gewissen Widerspruch zu Granovetters Argument, dass alle Produktionssysteme sozial eingebettet seien, werden alternative Lebensmittelsysteme, wie Lebensmittelkooperativen, → solidarische Landwirtschaft oder kurze Bio-Wertschöpfungsketten (→ Wertschöpfungsketten), auch als „Wiedereinbettung“ der Lebensmittelversorgung in regional verankerte soziale Beziehungen interpretiert (Raynolds 2000; Hinrichs 2000; Murdoch et al. 2000; Barham 2003; Penker 2006; Morris und Kirwan 2011). Hinrichs (2000) wiederum fordert mit Verweis auf Granovetter (1985), das Konzept differenziert zu verwenden und Einbettung nicht als freundliche Antithese zum Markt zu simplifizieren. Dieses Kapitel folgt Granovetters Argumentation und diskutiert globale und regionale Lebensmittelsysteme entlang unterschiedlicher Gradienten sozialer Einbettung, anstatt sie als entbettet und (wieder) eingebettet gegenüberzustellen.
Demnach gliedert sich dieses Kapitel in drei Teile. Nach einem Einblick in die Globalisierung und die damit einhergehende graduelle Entbettung der Lebensmittelproduktion aus ihrem sozialen, regionalen und ökologischen Kontext widmen wir uns der → Regionalisierung und der stärkeren Wiedereinbettung von Produktions- und Konsumvorgängen in soziale und ökologische Strukturen konkreter Regionen. Zum Abschluss diskutiert dieses Kapitel die wechselseitige Dynamik und Kontinuität zwischen mehr oder weniger eingebetteten Lebensmittelsystemen und greift geografische Herkunftsangaben als Mischform auf, die die Einbettung der Lebensmittelproduktion in regionale Strukturen mit dem internationalen Handel verknüpft.
3.2 Globalisierung – Lebensmittel mit loser Einbettung
Die Globalisierung ist eine vielschichtige Entwicklung, die – je nach Standpunkt und Begriffsverständnis – einige Jahrzehnte, eineinhalb Jahrhunderte oder ein halbes Jahrtausend zurückreicht; eine ihrer Facetten sind die zunehmenden internationalen Verflechtungen entlang der Wertschöpfungskette. In funktionaler Hinsicht besteht die Lebensmittelwertschöpfungskette aus den Stufen der landwirtschaftlichen Produktion, der Verarbeitung, des Handels und des Konsums, welcher in den Haushalten selbst oder außer Haus erfolgen kann. Zur erweiterten Wertschöpfungskette zählen zudem noch Inputs wie Saatgut, Energie oder Mineralstoffdünger sowie Outputs wie Abwässer, Abfälle und Abgase (siehe Abb. 3.1).
Globalisierte Warenketten (→ Wertschöpfungskette) verbinden Wertschöpfungsstufen in verschiedenen Ländern, häufig auch auf unterschiedlichen Kontinenten. Der Warenaustausch entlang globalisierter Ketten erfolgt in der Regel über anonymisierte Austauschbeziehungen; soziale Beziehungen zwischen den AkteurInnen der Wertschöpfungskette treten in den Hintergrund bzw. führen aus der Perspektive der Ökonomie höchstens zu verpönten Preisabsprachen oder anderen Wettbewerbsverzerrungen (Granovetter 1985). Die ökologischen und sozialen Produktionsbedingungen global gehandelter Lebensmittel sind für die KonsumentInnen, wenn überhaupt, nur über Labels oder die von Unternehmen selektiv bereitgestellten Informationen nachvollziehbar.
Abb. 3.1: Lebensmittelwertschöpfungskette (eigene Darstellung in Anlehnung an Strecker et al. 1996)
Die folgenden Abschnitte gehen auf drei wesentliche Triebfedern der Globalisierung ein: technische Innovationen, Liberalisierung des Welthandels und die Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung nach ganzjährig verfügbaren, günstigen und vielfältigen Produkten. Im Anschluss widmen wir uns den Voraussetzungen und Folgen globalisierter Lebensmittelsysteme.
3.2.1 Triebkräfte der Globalisierung
Technische Innovationen
Seit Tausenden von Jahren gibt es transkontinentale Handelswege für den Austausch wertvoller Gewürze. Der zunächst mit Zugtieren betriebene Transport über Land und Kanäle wurde im 19. Jahrhundert durch dampfbetriebene Lokomotiven und Hochseeschiffe ergänzt und schließlich weitgehend durch den motorisierten Massentransport auf der Straße, den Weltmeeren und in der Luft abgelöst. Erst diese technischen Innovationen und die damit in Verbindung stehende Verbilligung des Transports haben den Handel großer Mengen und vielfältiger Lebensmittel ermöglicht.
Abb. 3.2: Handel ermöglicht die Spezialisierung von Regionen auf spezifische Produkte (erste Phase der Globalisierung)
Durch den Austausch von Massengütern konnten sich in der ersten Phase der Globalisierung (etwa von den 1870er Jahren bis in die 1920er Jahre, vgl. Kapitel 2) Betriebe spezifischer Regionen auf jene Produkte spezialisieren, die sie am besten und billigsten bereitstellen konnten (Weizenregion, Zuckerregion; siehe auch Abb. 3.2). Agrarbörsen und große Warenumschlagsplätze unterstützten diesen Spezialisierungsprozess, der auf der Nutzung von Standortvorteilen beruht, wie etwa für ein bestimmtes Produkt besonders günstige Kostenstrukturen, besonders geeignete Böden oder klimatische Bedingungen. Zudem erlaubte diese Spezialisierung die Nutzung von Skalenvorteilen. Je größer die produzierte Menge eines spezifischen Produktes, desto billiger wird die einzelne Einheit aufgrund der anteilsmäßig abnehmenden Fixkosten und desto eher können Betriebe in spezialisiertes Personal und neue Technologien investieren und ihren Wettbewerbsvorsprung ausbauen.
In der zweiten Phase der Globalisierung (etwa seit den 1950er Jahren) haben Entwicklungen in der EDV-gestützten Logistik und noch effizientere Transportsysteme die optimierte Erzielung von Kostenvorteilen in den einzelnen Schritten der Produktion, Verarbeitung, Lagerung und Paketierung ermöglicht. So können regionale Wettbewerbsvorteile – absolute oder auch relative (komparative) – für einzelne Schritte der Wertschöpfungskette genutzt werden, sodass eine Wertschöpfungskette Betriebe verschiedener Länder oder unterschiedlicher Kontinente verbinden kann. Regionen und ihre Betriebe spezialisieren sich auf bestimmte Funktionen und nicht mehr auf bestimmte Produkte (vgl. Box 3.1).
Box 3.1: Rind- und Kalbfleischproduktion als Beispiel für arbeitsteilige Wertschöpfungsketten in der zweiten Phase der Globalisierung
Ein Stierkalb einer bayerischen Milchkuh hat u. U. einen amerikanischen oder niederländischen Vater. Besamungszucht-Unternehmen in diesen Ländern sind spezialisiert auf den Export von Stiersamen, der die Aufzucht von Kühen mit einer hohen Milchleistung verspricht. Dieses männliche Kalb findet im spezialisierten bayerischen Milchbetrieb keine Verwendung und wird daher z. B. nach Frankreich exportiert, dort mit nährstoffreichem Milchaustauscher gemästet und schließlich als Kalbfleisch vermarktet. Dasselbe Kalb könnte aber auch nach Spanien exportiert und dort mit aus Südamerika importiertem, gentechnisch verändertem Sojaschrot gemästet, geschlachtet und zu Rindfleisch verarbeitet werden. Während die Edelteile in Spanien oder Frankreich bleiben, kommen weniger begehrte Teile nach Afrika, Osteuropa oder Asien, von wo allenfalls wieder Verarbeitungsprodukte wie Gelatine, Collagen oder Fleischextrakte nach Europa exportiert werden.
Außer durch neue Transporttechnologien wurde der Warenaustausch auch durch Innovationen der Lebensmitteltechnologie unterstützt. Neue Konservierungstechniken und Zusatzstoffe wie Stabilisatoren, Antioxidantien, Emulgatoren, Feuchthaltemittel oder Säureregulatoren ermöglichten den Austausch verderblicher Waren auch über längere Distanzen und Zeiträume unter weitgehender Beibehaltung der Konsistenz, des Geschmacks und Geruchs des Lebensmittels.
Van der Ploeg (2010) weist darauf hin, dass multinational agierende Agrarunternehmen über einen bevorzugten Zugang zu technologischen Innovationen verfügen, was einer Industrialisierung und Standardisierung der Lebensmittelproduktion sowie einer weiteren Machtverschiebung Vorschub leistet. Der Handlungsspielraum der bäuerlichen Betriebe verengt sich, da sie von beiden Seiten, durch mächtige und transkontinental agierende Zulieferunternehmen von Vorleistungen für die landwirtschaftliche Produktion (Saatgut, Dünger, Medikamente etc.) und durch den hoch konzentrierten Handel, unter Druck geraten. Kontextspezifisches, informelles Wissen der Bäuerinnen und Bauern wird entwertet und durch standardisierte Praktiken der Landnutzung und Tierhaltung ersetzt. Bäuerliche Betriebe finden sich in einem „technologischen Hamsterrad“ wieder (Levins und Cochrane 1996). Neue Technologien führen zu Überproduktion und fallenden Preisen. Landwirtschaftliche Betriebe müssen kontinuierlich investieren, um ihre Produktion weiter zu steigern, ohne je selbst ausreichend vom Produktivitätszuwachs zu profitieren (Morgan und Murdoch 2000). Der Anteil des Endverbraucherpreises, der der Landwirtschaft zufällt, sinkt so zugunsten der konzentrierten Zuliefer- und Handelsunternehmen (Foresight 2011).
Liberalisierung des Handels
Multinational agierende Unternehmen der Agrar- und Lebensmittelindustrie und Verfechter des Freihandels haben über international abgestimmte Verfahren der Welthandelsorganisation (WTO) den Abbau von Handelshemmnissen und die Liberalisierung bzw. Neuregulierung (supra)nationaler Agrarpolitiken vorangetrieben. Im Zuge dessen wurden in der EU produktbezogene Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe schrittweise durch flächenbezogene Zahlungen und Agrarumweltzahlungen abgelöst, Preisinterventionen reduziert und Marktordnungen liberalisiert (z. B. Abschaffung der Milchkontingentierung, welche vorher die Milchabsatzmenge regelte).
Zusätzlich zu multilateralen Abkommen über die WTO verfolgte die EU – getrieben von europäischen Unternehmen, die Zugang für ihre Güter und Dienstleistungen auf internationalen Märkten suchten, und den ins Stocken geratenen WTO-Verhandlungen – auch bilaterale Handelsabkommen mit zahlreichen Ländern in der ganzen Welt (z. B. CETA mit Kanada). Standen bis in die 1970er Jahre der Abbau von Zöllen (englisch: tariffs) im Vordergrund, so ging es in den letzten Jahrzehnten vorwiegend um den Abbau nichttarifärer Handels- und Investitionshindernisse. Zu diesen zählen Importquoten und -lizenzen, Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften, Beeinflussung der KonsumentInnen zum Kauf einheimischer Produkte, unterschiedliche technische Normen, Sozial- und Umweltstandards, Ausschreibungsmodalitäten öffentlicher Aufträge, Zulassungen für ausländische Dienstleistungsanbieter oder andere marktbezogene Regulative. Insbesondere gerieten auch die Regeln für die öffentliche Beschaffung, wie etwa für Großküchen in Krankenhäusern, Altersheimen, Schulen und Kindergärten, für die Katastrophen-, Flüchtlings- und Entwicklungshilfe oder öffentliche Dienstleistungen wie die Trinkwasserversorgung ins Visier der Verhandlungspartner.
Diese von Freihandelsvertretern als nichttarifäre Handelshemmnisse qualifizierten Regeln sind jedoch nicht unbedingt auf die Beschränkung des Wettbewerbs ausgerichtet. Sie können auch primär zum Schutz von VerbraucherInnen vor schlechter Ware oder minderwertigen Dienstleistungen sowie von ArbeitnehmerInnen und der Umwelt dienen. Da es bei der Harmonisierung von Standards häufig um eine Nivellierung nach unten und nicht um eine Angleichung nach oben geht, bedeutet der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse in der Regel eine Beschneidung des Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzes. Dieses race to the bottom kann auch die öffentliche Ausschreibung von Großaufträgen und Dienstleistungen betreffen und damit die Qualität öffentlicher Dienstleistungen beeinträchtigen (Billigstbieter- versus Bestbieterprinzip).
Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung
Der zunehmende Güter- und Leistungsaustausch im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr und die voranschreitende internationale Arbeitsteilung führten gemeinsam mit der Technisierung zu enormen Produktivitätszuwächsen. So konnten mehr und kostengünstigere Lebensmittel für eine in fast allen Teilen der Welt wachsende Bevölkerung produziert werden. Die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung ist daher ein wesentliches Argument der GlobalisierungsbefürworterInnen und zentrales Ziel der Vereinten Nationen. In den letzten Jahrzehnten, die durch starke Globalisierungsprozesse gekennzeichnet waren, konnte zwar der Anteil der unterernährten Menschen weltweit reduziert werden; in absoluten Zahlen hat sich aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung aber wenig an der Dramatik der Situation geändert (siehe Abb. 3.3).
Abb. 3.3: Anzahl und Anteil unterernährter Personen weltweit (basierend auf Daten der FAO 2015)
Fluktuierende Lebensmittelpreise, die in liberalisierten, deregulierten Lebensmittelmärkten von einzelnen Nationalstaaten kaum beeinflusst werden können, treffen Haushalte im → Globalen Süden weit stärker als im Globalen Norden, weil Erstere einen höheren Anteil des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aufwenden (siehe Abb. 3.4).
Der Anteil der Haushaltsausgaben für Lebensmittel ist insbesondere in den Ländern des Globalen Nordens in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gefallen. In Mitteleuropa gab der durchschnittliche Haushalt in den 1970er Jahren noch etwa ein Viertel seines Einkommens für Lebensmittel aus, gegenwärtig ist es nur mehr etwa ein Zehntel. Im weltweiten Vergleich divergieren die Anteile der Lebensmittelausgaben am Haushaltsbudget stark; so liegen diese in den USA bei 7 % und in Ländern südlich der Sahara bei über 40 % (vgl. Abb. 3.4).
Abb. 3.4: Anteil des Haushaltseinkommens (in %), welcher 2014 für zu Hause konsumiertes Essen ausgegeben wurde (ERS 2017)
Während in vielen Teilen Europas immer weniger für Lebensmittel ausgegeben wird, die zu Hause konsumiert werden, steigt der Außer-Haus-Konsum. Dieses Phänomen wird u. a. mit Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel der Genderrollen erklärt. Der Anteil außer Haus konsumierter Lebensmittel ist tendenziell in nordeuropäischen Ländern höher als in jenen des Südens und beträgt zwischen 11 % und 28 % der nahrungsbezogenen Energie (Orfanos et al. 2007). Der steigende Anteil des Außer-Haus-Konsums verdrängt das Kochen daheim und trägt auch dazu bei, dass KonsumentInnen noch weniger nachvollziehen können, wer wo an der Produktion, Verarbeitung und Zubereitung ihrer Nahrung beteiligt war. Man denke an zentrale Großküchen, die gleich mehrere Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten, Gefängnisse, Flüchtlingsheime oder Schulen mit Essen beliefern.
In vielen Gastronomiebetrieben hat sich eine standardisierte ‚Weltküche‘ durchgesetzt. Global agierende Gastronomieunternehmen und fast-food-Ketten versuchen weltweit ähnliche Produkte unter vereinheitlichten Herstellungsbedingungen mit möglichst standardisierter Qualität und Präsentation zu vertreiben und tragen so zu einer Homogenisierung von Ernährungskulturen bei. Gleichzeitig profitieren westliche KonsumentInnen vom vielfältigen Angebot ganzjährig verfügbarer Waren, die sonst aufgrund klimatischer Bedingungen oder durch Ernteausfälle gar nicht oder nur saisonal erhältlich wären.
3.2.2 Standardisierung, Dokumentation und Kontrolle statt Vertrauen
Entlang globalisierter Wertschöpfungsketten gehen Lebensmittel durch die Hände zahlreicher den KonsumentInnen nicht persönlich bekannter ProduzentInnen, deren Standorte oft weit voneinander entfernt liegen. Langfristige, auf Vertrauen und auf Gegenseitigkeit im sozialen Austausch (Reziprozität) angelegte Beziehungen zwischen den Unternehmen sowie mit den KonsumentInnen treten in den Hintergrund. Aus der Perspektive des neoliberalen Paradigmas scheinen soziale Beziehungen jenseits reiner Marktbeziehungen mitunter sogar wettbewerbshinderlich (z. B. Preisabsprachen). Rationale, auf Eigennutz ausgerichtete und am Gewinn orientierte individuelle Unternehmensentscheidungen gelten als Voraussetzung für einen funktionierenden Markt (Granovetter 1985).
Unterschiedliche regional geprägte Wuchsformen, Größen, Geschmacksnoten, Qualitäten etc. erschweren die auf Effizienz und Flexibilität ausgerichteten Transaktionen entlang langer Warenketten mit zahlreichen einander und den KonsumentInnen nicht persönlich bekannten Marktteilnehmern. Entlang globalisierter Wertschöpfungsketten werden daher bevorzugt standardisierte Massenwaren (commodities) mit homogener Qualität gehandelt, die von regionalen Besonderheiten bereinigt ist. Nur so können Händler commodities auf Börsen handeln, ohne die Ware jemals persönlich zu sehen, anzugreifen oder zu prüfen.
In sozial weniger eingebetteten und langen Warenketten, die durch eine Vielzahl einmaliger Transaktionen charakterisiert sind, lässt sich Fehlverhalten kaum verorten und Konsumentenvertrauen schwer aufbauen. Damit der internationale Warenaustausch zwischen individuell und weitgehend isoliert agierenden MarktteilnehmerInnen dennoch funktionieren kann, sollen abstrakte Systeme der Lebensmittelsicherheit (→ Nahrungsmittelsicherheit) mit einheitlichen und klaren Standards, Aufzeichnungspflichten, Etikettierungsregeln und Rückverfolgbarkeitsmechanismen sowie staatliche Kontrolle die Qualität sichern und Fehlverhalten verhindern. Diese Regulative substituieren das Vertrauen, das viele KonsumentInnen – zu Recht oder Unrecht – ihnen persönlich bekannten LebensmittelproduzentInnen entgegenbringen. So können Sicherheit und Qualität auch für jene Lebensmittel vermittelt werden, die durch die Hände unzähliger einander und den KonsumentInnen nicht persönlich bekannter AkteurInnen in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten gehen.
Über staatliche Lebensmittelvorschriften hinausgehende Qualitätsstandards werden in komplexen Zertifizierungssystemen garantiert, durch unabhängige Kontrollstellen überprüft und durchgehend bis zu den KonsumentInnen dokumentiert und kommuniziert (z. B. Biolandbau und Fair Trade). Branchenstandards, d. h. zwischen Agrar- und Lebensmittelunternehmen vereinbarte Regeln zur Hygiene- und Qualitätssicherung, ergänzen staatliche Reglementierungen.
Auch mit ausgefeilten Kontrollsystemen lassen sich Lebensmittelskandale nicht gänzlich verhindern (siehe Abschnitt 5.6). In betrügerischer Absicht neu etikettierte Produkte (Stichwort „Gammelfleisch“ oder Pferdefleischskandal) bzw. mit Pestiziden oder pathogenen Keimen verunreinigte Lebensmittel gelangen immer wieder in die Supermarktregale, in private Kühlschränke, in den menschlichen Körper und schließlich in die Schlagzeilen.
3.2.3 Globalisierungsfolgen und Kritik
Die Handelsbedingungen sind nicht für alle Länder gleich. Entwicklungsländer (→ Globaler Süden) können aufgrund von Handelsbeschränkungen oder von Industrieländern einseitig definierten Standards die Chancen der Globalisierung nur sehr beschränkt nutzen. Zudem steht ihre Agrarproduktion unter dem Konkurrenzdruck subventionsgestützter Billigimporte aus Industrieländern. Während die Rohstoffproduktion oft in Ländern mit niedrigen sozialen und ökologischen Standards angesiedelt ist, bleiben die lukrativeren Verarbeitungsschritte den Industrieländern vorbehalten (z. B. die Röstung und Mischung von Kaffeesorten unterschiedlicher Herkunft oder Verarbeitung von Kakao zu Schokoriegeln). Die Markenbildung bei Lebensmitteln wie Kaffee, Schokoriegeln oder Cerealien erfolgt vorwiegend ohne Bezug zum Ort der landwirtschaftlichen Produktion und der Mehrwert der Marke bleibt in der Regel in den reichen Ländern des Nordens. Das ‚freie Spiel der Kräfte‘ auf ‚liberalisierten‘ – d. h. durch WTO und multinationale Konzerne re-regulierten – Märkten führt zu neuen Formen der Ausbeutung benachteiligter Länder: Landraub, Patentierung genetischer Ressourcen, Vertragslandwirtschaft.
Als Folge der Globalisierung geriet aber auch das regionalwirtschaftliche, soziale und agrarökologische Gefüge vieler ländlicher Regionen Europas unter Druck. Europaweit ist seit den 1970er Jahren ein starker Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe zu verzeichnen. Wachstums- und Spezialisierungsprozesse kennzeichnen die Mehrheit der verbliebenen Betriebe. Flächen, die nur manuell oder unter großem Aufwand zu bewirtschaften, weniger produktiv und abgelegen sind, werden aufgegeben. Das hat weitreichende Folgen für das Landschaftsbild und die Agrarökosysteme, welche sich in einer Koevolution mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung entwickelt hatten (siehe Kapitel 4). Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft problematisieren den Verlust von Landschaftsvielfalt, → Biodiversität und kultureller Vielfalt sowie eine Homogenisierung von Ernährungskulturen.
Die ‚Liberalisierung‘ der Agrarmärkte hat Betrieben der Agrar- und Ernährungswirtschaft einerseits größere Entscheidungsspielräume und neue Märkte eröffnet, sie andererseits direkt mit den Risiken schwankender Weltmarktpreise konfrontiert. Auch wenn die Menge weltweit gehandelter Agrargüter anteilsmäßig gering ist, etablieren sich Weltmarktpreise, die auch auf die lokalen Agrar- und Lebensmittelmärkte rückwirken. Sinkt die Nachfrage nach Milchprodukten in Russland oder China, so fallen auch die Milchpreise in Europa. Durch die ‚Liberalisierung‘ der Agrargüterpreise müssen sich auch europäische Betriebe auf stark schwankende Preise einstellen. Zudem hat die ‚Liberalisierung‘ weitere Optionen für Spekulationen auf Rohstoff- und Agrarbörsen eröffnet (siehe Box 3.2).
Box 3.2: Tortilla-Krise (Keleman und Rañó 2011)
Am 31. Jänner 2007 wandten sich in Mexiko Zigtausende Demonstranten gegen die teilweise Vervierfachung des Tortillapreises. 50 Mio. Mexikaner konsumieren täglich über 600 Mio. Tortillas. Die aus Maismehl produzierte Tortilla ist nicht nur für die ärmere Bevölkerung Mexikos ein wesentlicher Kalorienlieferant, sondern auch wesentlicher Teil der mexikanischen Kultur. Das zeigt die Parole sin maiz no hay país („ohne Mais kein Mexiko“). Die Regierung reglementierte schließlich den Tortillapreis und setzte verschiedene Maßnahmen gegen Spekulation und Preisfluktuation.
Die Krise in Mexiko dürfte durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren hervorgerufen worden sein: steigender globaler Bedarf, auch getrieben durch die forcierte Produktion von Agrotreibstoffen aus Mais in den USA, Spekulationen auf internationalen Märkten, die Import-abhängigkeit Mexikos sowie Machtkonzentrationen in Teilen der Wertschöpfungskette. Preisschocks in internationalen Lebensmittelmärkten zeigen die Verletzlichkeit von Ländern, die stark von Lebensmittelimporten abhängig sind. Besonders verletzlich gegenüber Preisschwankungen bei Grundnahrungsmitteln sind die Ärmsten, die den größten Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden müssen (vgl. Abb. 3.4).
Der globalisierungsbedingte Strukturwandel in weiten Teilen Europas machte sich in den letzten Jahrzehnten auch außerhalb der Landwirtschaft durch den Verlust von Arbeitsplätzen bemerkbar. So gingen z. B. in den kleinstrukturierten Betrieben der Lebensmittelverarbeitung allein zwischen 1970 und 1999 etwa die Hälfte der Arbeitsplätze verloren (Favry et al. 2004). Ebenso wurden Einzelhandelsstandorte aufgelassen, sodass viele ländliche Gemeinden über kein eigenes Lebensmittelgeschäft mehr verfügen.
Durch globalisierte Wirtschaftsbeziehungen können transnational agierende Unternehmen divergierende Sozial- und Umweltstandards sowie Steuervorteile in unterschiedlichen Ländern auszunutzen. Für kleinere, regional verankerte Betriebe steigt der Konkurrenzdruck, da sie mit hohen Arbeitskosten, Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Umweltauflagen konfrontiert sind. Jene, die diesem Druck nicht standhalten, geben auf. Andere versuchen, Ausnahmen von Sozial- oder Umweltauflagen durchzusetzen, indem sie den Druck an die Politik weitergeben und drohen, die Produktion zu schließen oder in ein anderes Land zu transferieren. Handelsabkommen, aber auch durch unterschiedliche Produktionsauflagen verzerrte Wettbewerbsbedingungen können so zur Nivellierung hart erkämpfter nationaler Umwelt- und Sozialstandards beitragen (race to the bottom).
Transportstromanalysen zeigten, dass die für die Lebensmitteldistribution zurückgelegten Kilometer (Transportleistung der gesamten Kette) in den letzten Jahrzehnten um mehr als das Doppelte stiegen, während sich die Menge der transportierten Güter nur geringfügig erhöhte (Favry et al. 2004). Das heißt, das Essen legte wesentlich längere Wege „vom Feld zum Teller“ zurück (für ein konkretes Beispiel siehe Box 3.3). Mehr zu Umweltwirkungen des Transports ist im Abschnitt 4.3.1 nachzulesen.
Box 3.3: Beispiel einer langen Wertschöpfungskette
Lastkraftwagen transportieren regelmäßig gekühlte Nordseekrabben 6000 km bis nach Marokko und zurück. Dadurch lässt sich das arbeitsintensive Schälen der Krabben nach Marokko auslagern. Die Transportkosten fallen im Vergleich zu den Ersparnissen aufgrund der geringen Arbeitskosten in Marokko kaum ins Gewicht. Nur durch die Ausnutzung des Lohngefälles zwischen Deutschland und Marokko können deutsche KonsumentInnen so preisgünstig ‚heimische‘ und ‚frische‘ Nordseekrabben erwerben.
3.3 Regionalisierung – die verstärkte Einbettung von Lebensmitteln in regionale Strukturen
In Reaktion auf die Globalisierung der Lebensmittelversorgung und aus dem Wunsch nach überschaubareren Strukturen, der sich oftmals gerade nach medial aufbereiteten Lebensmittelskandalen breitmacht, versuchen AktivistInnen, einzelne Betriebe und regionsübergreifende Initiativen die Lebensmittelversorgung ‚wieder‘ stärker in regionale Sozialstrukturen einzubetten (siehe Kapitel 9). Neben der Wiederbelebung von Wochenmärkten oder dem Ab-Hof-Verkauf und Bauernläden verbreiten sich auch alternative Formen regionaler Lebensmittelversorgung, wie etwa die ‚Biokiste‘ (eine regelmäßig zugestellte Auswahl an saisonalem, biologisch produziertem Obst und Gemüse), die solidarische Landwirtschaft (vgl. Box 3.4) oder Lebensmittelkooperativen (Box 3.5). Auch globale Initiativen wie die → slow-food-Bewegung oder Via Campensina tragen zur Bewusstseinsentwicklung bei und stärken kurze qualitätsorientierte Warenketten in den Regionen.
Im Vergleich zu globalen Produktionssystemen sind regionale Warenketten kürzer und zeichnen sich durch die geografische und/oder soziale Nähe vergleichsweise weniger Betriebe und Personen aus. Noch weniger AkteurInnen umfasst nur die → Prosumption (siehe Abschnitt 9.5.3). Beim Selbstanbau in Eigen- und Gemeinschaftsgärten bzw. in Selbsternteprojekten erfolgen Produktion und Konsum durch dieselbe Person.
LebensmittelaktivistInnen und vermehrt auch Marketingabteilungen des Lebensmitteleinzelhandels verknüpfen Regionalität argumentativ mit sozialer Nähe, mit Mitsprachemöglichkeiten bei der Definition von Qualitätsstandards (→ Ernährungssouveränität, Kapitel 9) oder mit der Förderung ‚authentischer‘, an die regionalen naturräumlichen und soziokulturellen Verhältnisse angepasster Lebensmittel und konstruieren damit Versprechen, die weit über kürzere Transportwege und entsprechende Klimaeffekte hinausgehen. Sie implizieren kausale Verknüpfungen zwischen der „Wo-Frage“ und der „Wie-Frage“, die so faktisch nicht bestehen (Ermann 2015).
Ohne Rechtsdefinition wird Regionalität bei Lebensmitteln sehr unterschiedlich interpretiert und lässt je nach Interessenlage viel Definitionsspielraum (Hinrichs 2003; Ermann 2005; Sonnino 2013). Dass Regionalität sehr subjektiv ist, zeigen auch VerbraucherInnenbefragungen. Während einige den Begriff „regional“ sehr eng auf die nähere Umgebung mit einer maximalen Entfernung oder den Landkreis/Kanton/Bezirk festlegen, bestimmen ihn andere mit den Grenzen des Bundeslands oder des Nationalstaats. Viele assoziieren mit Regionalität aber auch eine kurze Wertschöpfungskette, direkte Interaktion mit den ProduzentInnen, Wissen über die Herkunft, bessere Qualität oder höhere soziale und ökologische Produktionsstandards. Hier seien beispielhaft vier überlappende, teilweise aber auch widersprüchliche Definitionsinhalte veranschaulicht:
Lebensmittel, bei denen die KonsumentInnen die Bedingungen von Produktion, Verarbeitung oder Vertrieb mitbestimmen können (selbstproduzierte Lebensmittel, Lebensmittelkooperativen, solidarische Landwirtschaft; siehe Box 3.4).
Lebensmittel persönlich gut bekannter ProduzentInnen, die den KonsumentInnen sozial (aber nicht unbedingt räumlich) nahestehen (die Marmelade der Großeltern oder der Schnaps des befreundeten Bauern am Urlaubsort).
Lebensmittel, die in räumlicher Nähe produziert, verarbeitet und konsumiert werden; die räumliche Nähe definiert sich über einen bestimmten Kilometerumkreis (z. B. max. 50 km), die Länge der Transportwege entlang der gesamten Warenkette oder die Zugehörigkeit zum selben soziokulturellen Identifikationsraum (z. B. aus demselben Bundesland).
Lebensmittel mit Herkunftsnachweis, die u. U. auch für internationale Märkte und weit entfernte KonsumentInnen produziert werden (z. B. rechtlich geschützte Herkunftsbezeichnungen wie Schweizer Gruyère oder Steirisches Kürbiskernöl) (siehe Abschnitt 3.4.3).
Box 3.4: Solidarische Landwirtschaft
Mitglieder, die üblicherweise in einem Verein organisiert sind, schließen mit Bäuerinnen und Bauern einen Vertrag ab, in dem sie sich verpflichten, die kalkulierten Kosten für die Jahresproduktion inklusive eines ausgehandelten Stundenlohns für die anfallenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten anteilig zu bezahlen. Im Gegenzug erhalten sie einen entsprechenden Anteil der Ernte, der je nach Wetter und Bewirtschaftungsgeschick unterschiedlich groß ausfallen kann. Die Risiken von Missernten werden so zumindest teilweise von der Landwirtschaft zu den Mitgliedern verschoben. Die Vereinbarung regelt auch, was in welcher Menge und wie angebaut wird. Teilweise helfen Mitglieder bei landwirtschaftlichen Arbeiten oder übernehmen Aufgaben der Administration oder Warenverteilung. Diese erfolgt an vereinbarten Abholplätzen und zu festgelegten Zeiten. Man vertraut darauf, dass die Mitglieder nicht mehr nehmen, als ihnen zusteht, und die Betriebe tatsächlich die entsprechenden Ernteanteile an die Mitglieder weitergeben und bei der Produktion die vereinbarten Tierschutz- oder Umweltauflagen erfüllen. Auf eine Bio-Zertifizierung und externe Kontrollen wird oftmals verzichtet.
Im Gegensatz zu Lebensmitteln, von denen man nicht weiß, woher sie kommen (food from nowhere; Campbell 2009), verfügen all die oben angeführten Lebensmittelkategorien über eine den KonsumentInnen bekannte Herkunft (food from somewhere; Campbell 2009).
3.3.1 Triebfedern der Regionalisierung
Regionalisierung als Gegenbewegung oder als Teil der Globalisierung
Infolge von Globalisierungsprozessen, der steigenden Außer-Haus-Verpflegung und des erhöhten Verarbeitungsgrads gekaufter Lebensmittel haben Menschen teilweise die Kontrolle darüber verloren, was sie sich mehrmals täglich – im wahrsten Sinne des Wortes – einverleiben. Die Qualität hoch verarbeiteter und verpackter Produkte ist nur schwer über den Geruchs- und Geschmackssinn bzw. über Form oder Farbe zu beurteilen. KonsumentInnen verlassen sich auf ExpertInneninformationen, die Angaben auf Etiketten und Speisekarten sowie auf das staatliche System der Lebensmittelkontrolle. Diese Regulative produzieren oder substituieren aber nur bedingt das Vertrauen, das durch medial aufbereitete Lebensmittelskandale immer wieder erschüttert wird. Eine sehr kleine, aber wachsende Gruppe von Menschen hinterfragt die Folgen globalisierter Lebensmittelsysteme und beklagt Vertrauens- und Kontrollverlust, den Strukturwandel in der Landwirtschaft und im Gewerbe, die Ausbeutung von Mensch und Natur oder die Dominanz des Preisarguments über jenem der Qualität. Stattdessen legen sie Wert auf langfristige und möglichst persönliche Beziehungen zu ProduzentInnen in der eigenen Region. Insbesondere in den Monaten nach größeren internationalen Lebensmittelskandalen bietet Regionalität Orientierung und subjektive Sicherheit im globalisierten und für den einzelnen Menschen nicht zu überschauenden Lebensmittelmarkt (Großsteinbeck 2012).
Box 3.5: Lebensmittelkooperative (siehe Kapitel 9)
In diesem stark durch KonsumentInnen gesteuerten Versorgungssystem organisiert eine Gruppe von Mitgliedern den gemeinsamen Einkauf und die Verteilung meist regionaler Bioprodukte. Bauernhöfe des Vertrauens liefern die bestellten Lebensmittel, die dann aus den Lagerräumlichkeiten der Kooperative abgeholt werden. Aufgaben der Selbstverwaltung und Lebensmittelverteilung werden durch ehrenamtlich tätige Mitglieder arbeitsteilig bewerkstelligt. Die Abholung basiert oft auf Vertrauen (selbst abwiegen, verpacken und den entsprechenden Geldbetrag hinterlegen). Mitglieder akzeptieren auch nicht zertifizierte Bauernhöfe als Biobetriebe. Aufgrund der persönlichen Beziehung vertrauen sie darauf, dass diese nachhaltig produzieren, auch wenn sie nicht extern kontrolliert werden.
Regionale Lebensmittel werden oftmals als Gegengewicht zu durchgreifenden Standardisierungs- und Homogenisierungsprozessen in der internationalen Lebensmittelindustrie verstanden. Die Vielfalt regionaler Ess- und Speisekulturen, die etwa von der slow-food-Bewegung propagiert wird, schlägt sich auch in einer Vielfalt von Kulturlandschaften, Sorten und Nutztierrassen nieder (z. B. die Lüneburger Heide mit ihren typischen Heidschnucken). In einer globalisierten Welt bindet sich Identität oftmals genau an diese Heterogenität regionstypischer Nutztierrassen, Speisekulturen und Landschaftsräume. Kurze Lebensmittelketten können durch eine Verankerung in regionalen → Ökosystemen, Landschafts- und Kulturräumen zu Aufhängern regionaler Identitätsentwürfe werden sowie zur biokulturellen Vielfalt, zur Erhaltung regionsspezifischer Produktionsstrukturen, Fertigkeiten und Arbeitsplätze beitragen.
Nicht zuletzt werden regionale Lebensmittel aber auch von Agrarmarktorganisationen und dem Lebensmitteleinzelhandel beworben. Der Lebensmittelmarkt im deutschsprachigen Raum und in weiten Teilen des Globalen Nordens ist gut gesättigt, zudem drängen durch die Öffnung der Märkte neue, oftmals preisgünstigere Produkte auf die bisher von heimischen Produkten dominierten Lebensmittelmärkte. Um neue Produkte vermarkten zu können, müssen sich diese aus der preisgünstigen Masse hervorheben, indem sie den KundInnen einen zusätzlichen Nutzen wie Nachhaltigkeit, ‚Authentizität‘ oder ‚Regionalität‘ versprechen. Heimische Produkte mit hoher Reputation lassen sich auch auf internationalen Märkten als hochpreisige Qualitätsprodukte positionieren. Regionalisierung lässt sich somit nicht nur als Gegenbewegung zur, sondern auch als komplementärer Prozess der Globalisierung erklären (mehr dazu im Abschnitt 3.4).
Vielfältige Motive regionaler Ernährung
Obwohl „Regionalität“ in Konsumerhebungen oftmals unterschiedlich bzw. gar nicht definiert wird, zeigen verschiedene Studien dennoch, dass der Trend zu regionalen Lebensmitteln auf sehr ähnlichen und vielfältigen Motiven beruht (Tab. 3.1). Natürlich erfüllen sich diese vielfältigen Erwartungen nicht in jedem Einzelfall (siehe Abschnitt 3.3.3).
Tab. 3.1: Motive regionaler Ernährung (basierend auf Dorandt und Leonhäuser 2001; Zepeda und Leviten-Reid 2004; Roininen et al. 2006; Chambers et al. 2007; Brown et al. 2009)
Wenn sich Regionalität und Saisonalität paaren, verfügen Obst und Gemüse aus der Region über Qualitätsmerkmale hinsichtlich Frische und Geschmack, die sonst durch frühzeitige Ernte oder lange Transportwege bzw. Glashauskultur verloren gehen. Andererseits kommt ein im Frühling konsumierter Apfel aus regionaler Lagerware geschmacklich nicht an den kürzlich geernteten Apfel aus Übersee heran. Aber selbst das Bewusstsein, dass bestimmte regionale Lebensmittel nur saisonal verfügbar sind, wird kultiviert: Wer fast das ganze Jahr auf die ersten Erdbeeren, den frischen Spargel, die ersten Aprikosen wartet, erfreut sich ganz besonders am Genuss dieser saisonalen Lebensmittel.
Während Frische vor allem bei Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren eine Rolle spielt, werden andere Qualitätsmerkmale vor allem durch Fertigkeiten der Verarbeitung geprägt. Lebensmittel können einen entscheidenden Qualitätsvorteil aufweisen, wenn wiederholte Transaktionen sowie die Bekanntheit der Betriebe und ihrer Produktionsbedingungen einen Qualitätsdruck erzeugen, der zu stetiger Innovation und Weiterentwicklung führt. VerarbeiterInnen, die KundInnen nicht bekannt sind bzw. diese nicht langfristig beliefern, können sich diesem Qualitätsdruck u. U. leichter entziehen.
Angesichts der oftmals beklagten Intransparenz und der mangelnden nationalstaatlichen Steuerbarkeit langer, globaler Warenketten versprechen kurze regional verankerte Produktionssysteme subjektive Sicherheit. KonsumentInnen schenken ProduzentInnen, deren Tun sie zumindest teilweise (und möglicherweise auch nur potenziell) selbst beobachten können, die sie vielleicht sogar persönlich kennen, größeres Vertrauen. Zudem lassen sich ökologische und soziale Standards über demokratische bzw. gesellschaftspolitische Prozesse (z. B. Tierschutzstandards, Gentechnikfreiheit) und die direkte Interaktion mit bäuerlichen Betrieben (solidarische Landwirtschaft, Lebensmittelkooperativen, Ab-Hof-Verkauf usw.) zumindest teilweise mitgestalten.
Auch wenn Umweltschutz ein ganz wesentliches Motiv für den Kauf regionaler Lebensmittel darstellt, bedarf es diesbezüglich eines differenzierten Blicks. Kürzere Transportwege müssen sich nicht zwingend in niedrigeren Emissionen niederschlagen (man denke an die Glashaustomate oder die gegenüber der CO2-Effizienz des Überseeschiffs ungleich niedrigere des Pkws für die Direktvermarktung). Umgekehrt ist davon auszugehen, dass der Druck für eine ökologisch und sozial verantwortungsvolle Produktion ungleich größer ist, wenn KonsumentInnen das Produkt mit dem Ort seiner Produktion direkt in Verbindung bringen können. Wer kauft schon gern Produkte, von denen bekannt ist, dass sie aus einer Region mit kontaminierten Böden, verschmutzten Gewässern oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen stammen? Weitere Motive neben Umwelteffekten im engen Sinne sind auch die Erhaltung bedrohter Nutztierrassen bzw. Kulturpflanzensorten und das Vermeiden unerwünschter Landschaftsveränderungen.
Viele KonsumentInnen geben an, die regionale Landwirtschaft und das regionale Lebensmittelgewerbe unterstützen zu wollen, um zur oben erwähnten Landschafts- und Speisenvielfalt beizutragen. Manche erinnern sich aber auch an Lebensmittelskandale (siehe Abschnitt 5.6) oder kriegsbedingte Lebensmittelknappheiten. Sie hoffen, dass die Erhaltung der Produktionsflächen, -strukturen und -fertigkeiten die → Resilienz der Lebensmittelversorgung gegenüber Pandemien, Kriegen, Terroranschlägen oder internationalen Lebensmittelskandalen erhöht.
Regionale Lebensmittel werden oftmals direkt ab Hof, über Lebensmittelkooperativen, Selbsternteprojekte, Eigen- oder Gemeinschaftsgärten bezogen. Das verspricht andere Erlebnisse, andere Lerneffekte und eine andere Befriedigung als beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt.
3.3.2 Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Alternative Formen der regionalen Lebensmittelversorgung, wie Lebensmittelkooperativen oder die solidarische Landwirtschaft, aber auch der traditionelle Ab-Hof-Verkauf, setzen stark auf Vertrauen. Vertrauensbasierte Transaktionen sind vor allem dort zu finden, wo Personen bereits wiederholte Male positive persönliche Austauscherfahrungen gemacht haben. RegionalisierungsverfechterInnen gehen davon aus, dass langfristige persönliche Beziehungen und ihnen inhärente gegenseitige Verpflichtungen und Abhängigkeiten opportunistisches Verhalten eindämmen.
Da der Qualitätsdruck durch die persönliche Bekanntheit der ProduzentInnen größer ist, wird gerade bei in kleinen Mengen produzierten regionalen Lebensmitteln ein Qualitätsvorsprung erwartet. Die Lebensmittelproduktion am Ort des Konsums ist durch „dichtere ökologische Rückkoppelungen“ charakterisiert und ermöglicht so raschere Anpassungsmaßnahmen bei unerwünschten ökologischen Effekten (Campbell 2009). Außerdem kennen KundInnen in der Regel eher die ökologischen und sozialen Standards, die im nationalen Umwelt-, Lebensmittel- und Arbeitsrecht definiert sind und von nationalen Behörden kontrolliert werden, als jene anderer Länder.
3.3.3 Kritik an der Regionalisierungsdiskussion
Die wenigsten Produkte aus der Region können all die vielfältigen Erwartungen einlösen, die in Tab. 3.1 aufgelistet sind. Nicht alle Betriebe, die Regionalprodukte vermarkten, arbeiten nach den Regeln des → Ökolandbaus oder erfüllen über das Tierschutzrecht hinausgehende Standards einer artgerechteren Tierhaltung. Manche bringen sogar qualitativ minderwertige oder nicht mehr frische Produkte in Umlauf. Auf Bauernmärkten finden sich teilweise auch zugekaufte, von weither importierte oder minderwertige Lebensmittel. Die „Wo-Frage“ gibt also keine verlässliche Antwort auf die „Wie-Frage“ nach den Produktions- und Handelsbedingungen (Ermann 2015).
Die Mitglieder von Lebensmittelkooperativen (Box 3.5) oder der solidarischen Landwirtschaft (Box 3.4) sind oftmals BesserverdienerInnen und (angehende) Akademiker-Innen. Personen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Gruppen haben oftmals keinen Zugang zu Qualitätsprodukten aus der Region. Somit bleibt regionale Ernährung das Privileg eines exklusiven Clubs der weißen Mittelklasse (DuPuis und Goodman 2005), die sich so von den anderen abgrenzt (siehe Kapitel 8).
Zudem wird mit dem Regionalisierungsprozess die Verantwortung von der Politik zu einzelnen KonsumentInnen und ihren Kauf- und Ernährungsentscheidungen verschoben, anstatt staatliche, gesamtgesellschaftliche Lösungen oder internationale ökologische und soziale Standards der Lebensmittelproduktion zu verankern (Hartwick 2000; van der Ploeg 2010; Sage 2012).
Die Unterstützung lokaler Firmen kann rasch in Skepsis und Angst gegenüber allem „Nicht-Regionalen“ umschlagen (Winter 2003; DuPuis und Goodman 2005). Auch zu hinterfragen ist, wieso heimische Bauernfamilien schutzbedürftiger sein sollen als solche in Südosteuropa oder im Globalen Süden. Zum Beispiel schützt auch die reformierte Zuckermarktordnung die europäische Zuckerproduktion, womit weitgehend verhindert wird, dass wesentlich preisgünstigerer Zucker aus dem Globalen Süden importiert und damit dort Einkommen geschaffen wird. Unter dem Motto trade not aid beanstanden NGOs und die Fair-Trade-Bewegung die Abschottung europäischer Märkte von Importen aus Entwicklungsländern. Morgan und Sonnino (2010) plädieren daher für einen cosmopolitan localism, bei dem sich Regionalität als Teil einer nationalen oder internationalen Gemeinschaft regionaler LebensmittelaktivistInnen versteht.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass – wie bereits oben dargelegt – heimische Lagerware oder Produkte aus Glashauskultur bezüglich Klima und Energie negativere Umwelteffekte aufweisen können als Importware aus Übersee. Aus der engen Perspektive des Energieverbrauchs und des Klimaschutzes ist wohl auch im Supermarkt angebotene Massenware in der Regel Produkten aus dezentralen, kleinstrukturierten und ineffizienten Produktions- und Logistiksystemen überlegen.
Die Präferenz für Lebensmittel aus der Region ist bei jenen Produkten am stärksten, bei denen die Kaufentscheidung von Frische, Vertrauen und Sicherheit abhängt. Das sind u. a. Fleischwaren, Brot und Gebäck sowie Obst und Gemüse. Je höher der Verarbeitungsgrad eines Lebensmittels, desto niedriger werten VerbraucherInnen die Bedeutung der Herkunft des Produkts (Sauter und Meyer 2003). Nur eine kleine Minderheit folgt Ernährungstrends wie z. B. jenem der Lokavoren oder der 100-Meilen-Diät, die beide auf eine Ernährung mit Lebensmitteln abzielen, die ausschließlich im nahen Umkreis produziert und verarbeitet wurden. Eine solche zwangsweise saisonal ausgerichtete Ernährung kann in Gebieten mit einer kurzen Vegetationszeit und einem langen Winter sehr eintönig werden. Außerdem braucht es viel Zeit, spezifische Kenntnisse und weitreichendes Wissen, um regionale Saisonware, die oftmals nicht im Supermarkt als hoch verarbeitetes → Convenience-Produkt zu finden ist, zu besorgen, zu verarbeiten, zu lagern und zuzubereiten. Darüber hinaus legen die wenigsten Kantinen, Gastbetriebe oder Hotels die Herkunft ihrer Zutaten offen. Angesichts knapper Zeitressourcen und steigender Außer-Haus-Verpflegung ist für viele Haushalte der Wunsch nach Regionalität in der Praxis daher nur bedingt realisierbar.
3.4 Kontinuum statt Dichotomie
3.4.1 Stärker und schwächer eingebettete Lebensmittelsysteme
Die beiden vorangehenden Abschnitte haben globale und regionale Lebensmittelsysteme aufgrund ihrer unterschiedlich intensiven Einbettung in soziale Beziehungen kontrastiert. Global gehandelte Massenware mit geringer sozialer Einbettung ist gekennzeichnet durch frei zirkulierende standardisierte und somit vorwiegend über den Preis vergleichbare Güter, welche VerkäuferInnen und KäuferInnen in kurzfristigen und flexiblen Transaktionen austauschen. KonsumentInnen können die geografische Herkunft der Produkte und die am Produktionsort geltenden sozialen und ökologischen Standards in der Regel nicht in Erfahrung bringen. Regionale kurze Wertschöpfungsketten fußen hingegen oft auf sozialer und geografischer Nähe, Reputation, lokalen Traditionen und einer Vielfalt von regional differenzierten Qualitäten und Produktionsstilen. VerbraucherInnen können durch direkte Interaktion mit regionalen Betrieben Einblick in die Herkunft und die konkreten Bedingungen der Lebensmittelproduktion erlangen.
Sowohl in globalen als auch in regionalen Lebensmittelsystemen gibt es Fehlverhalten und Betrug. Der Umgang damit ist jedoch unterschiedlich. Während in der Logik der globalisierten Märkte auf formalisierte Regeln, einheitliche Standards, Dokumentationspflichten, Zertifizierungen und externe Kontrollen gesetzt wird, geht es bei regionalen Lebensmittelsystemen um Vertrauen, gegenseitige Verpflichtungen, soziale Kontrolle und Reputation, die durch wiederholte persönliche Beziehungen gewachsen sind.
Sowohl in globalen als auch in regionalen Systemen gibt es eine kleine, aber wachsende Gruppe von AkteurInnen, die sich um eine ökologisch und sozial nachhaltigere Lebensmittelversorgung bemühen; allerdings verfolgen sie Nachhaltigkeitsziele mit unterschiedlichen Instrumenten. Globale Systeme setzen auf extern kontrollierte Zertifizierungssysteme wie Bio oder Fair Trade und damit auf weltweit sehr ähnlich implementierte ökologische und soziale Standards. Regionale Lebensmittel punkten mit kurzen Transportwegen, Erhaltung der Biodiversität und der kulturellen Vielfalt sowie Transparenz und Mitbestimmung bei sozialen und ökologischen Standards.
Die Globalisierung hat dazu beigetragen, dass vormalige Luxusprodukte wie Fleisch, Südfrüchte, Kaffee, Lachs oder Schokolade für die Mehrheit der Bevölkerung in der industrialisierten Welt erschwinglich wurden. Die Versorgung mit regionalen Qualitätsprodukten hingegen scheint in Nordamerika und weiten Teilen Europas bis dato eher ein Privileg der besser verdienenden und höher gebildeten Schichten.
Globalisierte und regionalisierte Wertschöpfungsketten lassen sich als die beiden Seiten ein und derselben Medaille interpretieren. Regionalisierte Systeme wie Lebensmittelkooperativen oder die solidarische Landwirtschaft werden mitunter aber auch als Nischen gesehen, die das vorherrschende → Nahrungsregime herausfordern und so zu einem Regimewechsel beitragen könnten (→ transition theory). Im folgenden Abschnitt werden globale und regionale Lebensmittelsysteme allerdings als zwei dynamisch in Austausch stehende und sich ergänzende Pole eines Kontinuums unterschiedlicher Einbettung diskutiert.
3.4.2 Kontinuum sozialer Einbettung
Die hier auch aus didaktischen Überlegungen skizzierte Dichotomie globaler und regionaler Lebensmittelsysteme ist weitgehend analytisch und entspricht nicht der vielfältigen Realität und Dynamik der realen Interaktionen von MarktteilnehmerInnen entlang unterschiedlicher Warenketten. Was für die wissenschaftliche und analytische Betrachtung hilfreich sein mag, beschreibt sehr idealisierte Formen der Lebensmittelproduktion, die in dieser Reinform in der Realität kaum zu finden sind.
Auch entlang internationaler Wertschöpfungsketten gibt es langfristige Beziehungen, die auf einem engen persönlichen Kontakt zwischen VerkäuferIn und KäuferIn beruhen. Nicht alle internationalen Transaktionen stützen sich auf formale Lieferverträge, die alles im kleinsten Detail unter Androhung von Strafzahlungen regeln. Manche beruhen auch auf vertrauensbasierten und langfristigen Austauschbeziehungen. Sind einmal gut funktionierende Wirtschaftsbeziehungen zu einem Zulieferbetrieb aufgebaut, wollen Betriebe auch weiterhin mit ihm kooperieren, um jene Kosten und Risiken zu vermeiden, die mit der Suche und Etablierung neuer Lieferbeziehungen verbunden sind. Erfahrungen zeigen also, dass die Verkaufs- und Einkaufsbeziehungen entlang globalisierter Ketten nur selten dem Ideal des neoklassischen Spotmarkt-Modells entsprechen, d. h. nur in wenigen Fällen kurzfristige, automatisierte und anonymisierte Transaktionen basierend auf standardisierten Verträgen darstellen.
Umgekehrt verlassen sich auch regionale Lebensmittelsysteme nicht ausschließlich auf langfristig etablierte Wirtschaftsbeziehungen und positive Erfahrungen vergangener Zusammenarbeit. Auch eine Person, die zum ersten Mal auf einem lokalen Markt einkauft oder in einem neuen Restaurant zu Gast ist, will sich darauf verlassen können, dass die am Marktstand oder auf der Speisekarte beworbenen Lebensmittel tatsächlich mit jenen im Einkaufskorb oder auf dem Teller übereinstimmen. Umgekehrt können auch langfristige Austauschbeziehungen enttäuscht werden bzw. sich vorwiegend am Preis orientieren und instrumentell auf den persönlichen Vorteil ausgerichtet sein (Hinrichs 2000). Persönliche Beziehungen mögen zwar eine Voraussetzung für Vertrauen sein, sie sind jedoch keine hinreichende Bedingung dafür, dass Fehlverhalten, Opportunismus und Betrug auch tatsächlich in jedem Fall verhindert werden können (Granovetter 1985). So profitieren wohl auch KonsumentInnen regionaler Lebensmittel von der staatlichen Lebensmittelaufsicht, die Hygiene- und Qualitätsstandards in Verkaufsstätten und Gastronomiebetrieben kontrolliert oder überprüft, ob die angepriesenen Lebensmittel mit den tatsächlich verkauften übereinstimmen. Strenge Qualitäts-, Sozial- und Umweltstandards – gekoppelt mit externen Kontrollen – können ebenso zu Sicherheit und Vertrauen beitragen wie langfristige, auf wiederholte persönliche Interaktionen ausgerichtete Austauschbeziehungen.
Zudem kombinieren landwirtschaftliche Betriebe Regionalisierungsstrategien wie etwa die Direktvermarktung mit der Ablieferung von Produkten an Großhändler zur Verbreitung auf internationalen Märkten. Die wenigsten KonsumentInnen ernähren sich ausschließlich von regionalen Lebensmitteln (Lokavoren oder 100-Meilen-Diät). Die meisten kombinieren Produkte unterschiedlichster Herkunft bzw. wissen gerade beim Außer-Haus-Konsum gar nicht, woher die von ihnen verzehrten Lebensmittel kommen.
Global und regional organisierte Wertschöpfungsketten sind nicht voneinander abgeschottete Systeme, vielmehr beeinflussen sie sich gegenseitig. So bieten auch ProduzentInnen regionaler Spezialitäten Online-Versand bis ins Ausland und Convenience-Produkte, die sonst vor allem von etablierten Vertriebsformen angeboten werden. Umgekehrt greifen international agierende Supermarktketten das Bedürfnis nach Regionalität auf, indem sie Regionalregale einrichten oder regionale ProduzentInnen einladen, ihre Produkte im Supermarkt persönlich vorzustellen. Multinationale fast-food-Ketten greifen das Bedürfnis nach Regionalität auf, indem sie mit der regionalen Herkunft ihrer Zutaten werben oder ihre Speisen an die jeweiligen lokalen Geschmackspräferenzen und Kulturen anpassen (Heterogenisierung; Robertson 1995). Global leicht kommunizierbare kulinarische Highlights wie etwa Pizza, Burger oder asiatische Wok-Gerichte werden beliebig mit Versatzstücken diverser „Ethnoküchen“ kombiniert (siehe Box 3.6). Umgekehrt werden bisher nur in einer konkreten Region produzierte und konsumierte Produkte so adaptiert, dass sie attraktiv für globale Märkte und den Massengeschmack einer breiten internationalen KonsumentInnenschaft werden (Homogenisierung). Aus diesem Verständnis heraus sind Regionalisierung und Globalisierung kein Gegensatz, sondern bedingen sich gegenseitig. → „Glokalisierung“ – also die Gleichzeitigkeit von Homogenisierungs- und Heterogenisierungsprozessen, von Globalisierung und „Re-Regionalisierung“ – wurde in den 1980ern von japanischen Ökonomen als Marketingbegriff geprägt und später von Robertson (z. B. 1995) auch in den sozialwissenschaftlichen Diskurs eingebracht.
Box 3.6: „McWorld“ vor Ort als Beispiel für Glokalisierung
McDonald’s steht für die globale Standardisierung der Esskultur. Doch u. U. stellt sich die → fast-food-Kette auch auf lokale Geschmacksvorlieben ein. So etwa werden in Norwegen McLaks, Sandwiches aus Vollkornbrot mit gegrilltem Lachs und Dillsauce, angeboten. In den Niederlanden wirbt der Groenteburger, ein vegetarischer Hamburger, um Kundschaft. In Uruguay gibt es McHuevos, Hamburger mit pochiertem Ei, und McQuesos, Sandwiches mit Käse. Japanische KundInnen können Chicken Tatsuta Sandwich, gebratenes Huhn mit Sojasauce, Ingwer, Kohl und Senfmayonnaise, bestellen. In Russland wird für Pirozhok, Kartoffeln mit Champignons und Käsekuchen, geworben. In Großbritannien äußert sich die Vorliebe für indische Küche in Gerichten wie McChicken Korma Naan und Lamb McSpicy. Nicht nur die McDonald’s-Produkte, sondern auch die sozialen Konsumpraktiken variieren nach lokalen Kulturen. So etwa gelten McDonald’s-Lokale in Beijing nicht als Orte des schnellen Essens, sondern als Treffpunkte, wo man stundenlang ‚herumhängt‘. Derartige Verbindungen von Globalem und Lokalem lassen sich als Ausdruck der „Glokalisierung“, der lokalen Aneignung globaler Einflüsse, begreifen (Ritzer 2006, 263–266).
Zwischen den beiden Polen der globalisierten Produktion und der sehr kurzen, regionalen Ketten gibt es eine Vielzahl mehr oder weniger eingebetteter Zwischenformen. Als ein Beispiel dieser Mischformen seien rechtlich geschützte Herkunftsangaben vorgestellt, die auf Vertrauen und Langfristigkeit basierende regionale Wirtschaftsbeziehungen mit externen Kontrollen und internationalem Handel verbinden.
3.4.3 Geschützte Herkunftsangaben als Beispiel regional eingebetteter und dennoch international ausgerichteter Produktionssysteme
Angaben zur geografischen Herkunft kommunizieren den Ort und die Standards der dortigen Produktion auch zu weit entfernten KonsumentInnen (Quiñones-Ruiz et al. 2016). Sie schützen regionale Betriebe vor der missbräuchlichen Verwendung der geografischen Bezeichnung durch Trittbrettfahrer außerhalb der Region (z. B., wenn Käse, der nicht aus dem Allgäu stammt, als Allgäuer Bergkäse vertrieben wird). Auch KonsumentInnen, die ein Produkt mit geschützter Herkunftsangabe weit entfernt vom Ort der Produktion kaufen, erhalten über das Label verlässliche Informationen zur Produktherkunft und können über die veröffentlichte Produktspezifikation die jeweiligen Standards der Produktion nachlesen, welche bei arbeitsteilig hergestellten und international gehandelten Lebensmitteln ansonsten in der Regel nicht nachvollziehbar sind.
Während sich beim Wein die Verknüpfung von Qualität und Herkunft bis in die Antike zurückverfolgen lässt und weltweit inzwischen auch rechtlich durch die WTO anerkannt ist, waren geschützte Herkunftsangaben für andere Lebensmittel lange Zeit nur in einzelnen Ländern Südeuropas gebräuchlich. Nationalstaatliche Herkunftsbezeichnungen sind beispielsweise das französische AOC-Siegel (Appellation d’Origine Contrôlée) oder das DOC-Siegel (Denominazione di origine controllata) in Italien. Seit 1992 schützt auch die EU geografische Herkunftsangaben für Lebensmittel. Gruppen von ProduzentInnen eines klar zu definierenden Produktionsgebiets, die einen Antrag auf Herkunftsschutz stellen, argumentieren für die herausragende Qualität ihres Produktes mit spezifischen Bodencharakteristika oder Klimabedingungen, mit regional angepassten Züchtungen und Sorten oder den hohen regionsspezifischen Produktionsstandards, den Fertigkeiten und dem traditionellen Wissen der regionalen ProduzentInnen und VerarbeiterInnen. Ist die geografische Bezeichnung einmal EU-rechtlich geschützt, darf sie nur noch für Produkte verwendet werden, die von in der ausgewiesenen Region angesiedelten zertifizierten und extern kontrollierten Betrieben unter Einhaltung der regionalen Qualitätsstandards produziert wurden.
Das Register der EU-rechtlich geschützten Herkunftsangaben enthält Hunderte geschützte Ursprungsbezeichnungen (g. U.), d. h. Herkunftsangaben für Produkte, deren Produktionsschritte alle im abgegrenzten Gebiet erfolgen müssen, und ebenso Hunderte geschützte geografische Angaben (g. g. A.), die garantieren, dass einer der Produktionsschritte (meist die Verarbeitung) in der Herkunftsregion erfolgt. Bei der geografischen Angabe reicht es folglich aus, dass etwa Pökelware im ausgewiesenen Gebiet verarbeitet worden ist. Das Fleisch kommt daher oftmals aus einem ganz anderen Gebiet. Woher genau, bleibt den KonsumentInnen in der Regel verborgen.
Abgesehen vom registrierungspflichtigen Herkunftsschutz einzelner geografischer Produktbezeichnungen sehen das europäische Recht und viele nationale Gesetze die verpflichtende Kennzeichnung für unverarbeitetes Obst und Gemüse, Eier, Fisch, Bioprodukte sowie für frisches, gekühltes oder gefrorenes Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch vor. Auf dem Etikett ist anzugeben, wo das Tier aufgezogen und wo es geschlachtet wurde. Darüber hinaus sind jene Fleischteile, die gleichzeitig verarbeitet wurden, mit einer Partienummer zu deklarieren, um den Konnex zwischen Fleisch und Tier zu wahren. Die Herkunftskennzeichnung stößt allerdings bei verarbeiteten Lebensmitteln oder bei Produkten, die aus mehreren Rohstoffen bestehen, sehr rasch an die Grenzen der Kommunizierbarkeit.
Neben den registrierten Herkunftsbezeichnungen und den rechtlich geregelten und staatlich kontrollierten Herkunftsangaben am Etikett gibt es noch eine unüberschaubar große Anzahl von Regionalmarken und mehr oder weniger fantasievoll gestalteten Labels, die eine Verbindung des Produkts zu einem bestimmten Ort suggerieren. Bei den meisten dieser Labels gibt es aber weder externe Kontrollen noch transparente Qualitätsstandards.
Auf persönlichen Beziehungen beruhendes Vertrauen und Kontrolle
Erzeuger rechtlich geschützten Herkunftsangaben wie Rioja-Wein oder Darjeeling-Tee argumentieren, dass biophysikalische und klimatische Bedingungen, aber auch die Anbau- und Verarbeitungstradition der im Produktionsgebiet arbeitenden Betriebe ‚authentische‘, regionstypische Qualitäten hervorbringen Mit dem Kauf dieser Produkte wollen auch weit entfernte KonsumentInnen dazu beitragen, dass es sich für die regionalen Betriebe auch weiterhin lohnt, auf Qualität zu setzen.
Bei rechtlich geschützten Herkunftsangaben definieren nicht Behörden oder multinational agierende Unternehmen die Qualitätsstandards, sondern selbstorganisierte Gruppen von ProduzentInnen in der Herkunftsregion (Quiñones-Ruiz et al. 2015). Diese gemeinschaftlich definierten Standards sollen dazu dienen, die Reputation des Produkts zu erhalten bzw. auszubauen. Externe Zertifizierungsorganisationen prüfen die Einhaltung der Standards. Somit verbindet dieses System langfristige Beziehungen zwischen Firmen in der Produktionsregion, die gemeinsame Lernprozesse und regionsspezifische Produktcharakteristika hervorbringen, mit staatlicher Registrierung, Zertifizierung und externen Kontrollen.
Kritik an Herkunftsangaben
Herkunftsbezeichnungen werden u. a. wegen ihrer heterogenen Qualitätsstandards kritisiert. Diese sind anders als bei international abgeglichenen Biostandards nicht generell gültig, sondern eigens für jedes Produkt in sehr unterschiedlich ausgestalteten Produktspezifikationen definiert, deren Zusammenfassung zwar auf einem EU-Web-portal publiziert, aber aufgrund ihrer Heterogenität für KonsumentInnen schwer zu durchschauen sind. Zumal sind auch diese Produktspezifikationen wie jegliche Information, die den KonsumentInnen über ein Essen, ein Lebensmittel oder ein Agrarerzeugnis vonseiten der HerstellerInnen zur Verfügung gestellt wird, „eine ‚Präsentation‘ von Herkunft, Qualität und/oder Produktionsweise […], die zwar nach bestimmten Regeln erfolgt, die aber niemals in der Lage sein kann, die Wirklichkeit vollständig und objektiv widerzuspiegeln“ (Ermann 2015, 78). Diese Heterogenität der Qualitätsstandards, welche von den regional organisierten ProduzentInnen selbst definiert werden, erschwert Kaufentscheidungen, aber auch die externe Zertifizierung und Kontrolle. Umgekehrt ermöglicht sie – anders als im Ökolandbau – ein gehöriges Maß an regionaler Selbstbestimmung und die Anpassung der Produktionsstandards an regionale Besonderheiten und Bedürfnisse, was zu vielfältigen Produktionskulturen beiträgt.
Umweltstandards waren nicht Inhalt traditioneller Herkunftssysteme und sind auch im europäischen Herkunftssystem nicht zwingend vorgesehen. Untersuchungen zeigen, dass insgesamt nur sehr wenige Produktspezifikationen auf ökologische Aspekte der Produktion eingehen (Belletti et al. 2015).
Regional stark eingebettete Lebensmittelsysteme werden in der Regel mit südeuropäischen Ländern wie Frankreich oder Italien assoziiert, wo die Produktqualität, etwa von Wein, schon in der Antike mit konkreten Regionen verknüpft wurde. Champagner, Parmaschinken oder Parmesan stehen für eine hohe Qualität und profitieren von ihrer Reputation. Hingegen hinterfragen FreihandelsverfechterInnen, ob Herkunft tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist oder lediglich dem Protektionismus (→ Liberalismus) und der Beeinflussung von KonsumentInnen dienen soll, um diese dazu zu bringen, heimische gegenüber ausländischen Firmen zu bevorzugen.
Während Herkunftssysteme, die jenem der EU ähnlich sind, auch in Ländern Lateinamerikas und Asiens implementiert werden, lässt sich im angloamerikanischen Kulturraum eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Herkunftsangaben ausmachen. Charakteristisch für die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland sind vielerorts weniger weit zurückreichende Herstellungstraditionen, eine Skepsis gegenüber zusätzlichen staatlichen Regulierungen, eine höhere Mobilität der Firmen und vor allem eine starke Markentradition. Während Marken in der Regel im Eigentum eines einzelnen Unternehmens sind und auch an Firmen in anderen Ländern verkauft werden können, sind Herkunftsangaben unveräußerlich. Rechtsprobleme ergeben sich dort, wo geografische Namen in verschiedenen Ländern unterschiedlich geschützt sind. Wer in den USA „Budweiser“-Bier kauft, erhält ein in Amerika produziertes Lagerbier einer amerikanischen Firma, die diesen Namen bereits 1870 markenrechtlich geschützt hat. Wer in Deutschland „Budweiser“-Bier kauft, kann hingegen davon ausgehen, dass dieses Bier in der tschechischen Stadt Budweis gebraut wurde. Die Bezeichnung „Parmesan“, welche seit 2008 in der EU ausschließlich für ‚echten‘ Parmigiano Reggiano (g. U.) aus Parma verwendet werden darf, gilt in den USA als generischer Name für eine bestimmte Art der Käsezubereitung, der von unterschiedlichsten Firmen an verschiedensten Standorten verwendet wird.
Die rechtlichen Divergenzen bezüglich der Bezeichnung von Lebensmitteln beeinträchtigten auch die Verhandlungen über bilaterale Handelsabkommen zwischen Nordamerika und der EU. In diesem Zusammenhang zeigen sich auch sehr unterschiedliche Paradigmen der Lebensmittelqualität. Überspitzt formuliert könnte man resümieren, dass nordamerikanische Regierungen auf Lebensmittelhygiene, standardisierte und kontrollierte Qualität setzen und krankmachende Keime auf ungechlorten Hühnern oder in Rohmilchkäse fürchten (Kontrolle der Endproduktqualität). Die Europäische Union legt hingegen besonderen Wert auf die Kontrolle der Herstellungsweise, auf Herkunftsinformation und ‚regionale‘, ‚authentische‘ Lebensmittel und europäische KonsumentInnen nehmen genetisch veränderte Organismen, Chlorhuhn- und Hormonfleischimporte tendenziell als Bedrohung wahr. Regionalisierte Lebensmittelsysteme können jeweils auf lokal vorherrschende Qualitätserwartungen eingehen; globalisierte Ketten sind mit unterschiedlichen Paradigmen und kontextbezogenen Qualitätsmaßstäben konfrontiert.
3.5 In Zukunft: regional, global oder glokal?
Dieses Kapitel erläutert die Triebfedern, Charakteristika und Folgen der parallel ablaufenden, sich gegenseitig bedingenden Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse in der Lebensmittelversorgung. Die Polarität zwischen regional und global soll jedoch nicht zu einer vereinfachten Diskussion von „entweder – oder“ führen, sondern vielmehr die wechselseitigen Dynamiken und Abhängigkeiten regionaler und globaler Lebensmittelsysteme verdeutlichen. Geänderte Praktiken der Lebensmittelversorgung können zu Verschiebungen beitragen, sei es bei der Definitionsmacht über die Produktqualität, bezüglich des Verhältnisses von sozialen Beziehungen und Markt oder bei der Verteilung von Rechten und Verpflichtungen zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Herkunft, AkteurInnen im Globalen Norden und Süden, Industrielobbys und KonsumentInnenverbänden.
Eine simplifizierende Gleichsetzung von „regional = gut“ ist nicht geboten. Auch vor der eigenen Haustür produzierte Lebensmittel können Erwartungen bezüglich Umweltschutz, Arbeitsbedingungen oder Tierschutz enttäuschen. Zudem ist aus ethischen Überlegungen zu hinterfragen, warum heimische Betriebe gegenüber bäuerlichen Familien aus dem Globalen Süden bevorzugt werden sollen. Im Gegensatz zu anonymer Massenware ohne Herkunftsbezug haben wir bei regional produzierten Lebensmitteln jedoch eher Einblick in die Produktionsprozesse und können diese bis zu einem bestimmten Grad auch mitgestalten und so zur Vielfalt der Produktionskulturen beitragen.
Die Diversität von mehr oder weniger globalisierten oder regionalisierten, sozial unterschiedlich eingebetteten, langen und kurzen Ketten kann auch als Chance für Synergien und ein resilientes Lebensmittelsystem (siehe Abschnitt 4.2.4) gesehen werden. International gehandelte Lebensmittel mit bekannter geografischer Herkunft zeigen, wie sich Vorteile sozialer Einbettung und heterogener Produktionsstandards mit jenen des internationalen Handels verbinden lassen.
Kontrollfragen
Was sind die Errungenschaften globalisierter Lebensmittelmärkte? Was würde sich für Sie ändern, wenn Sie sich ausschließlich von Lebensmitteln ernähren müssten, die im Umkreis von 100 km produziert werden?
Was waren/sind die wesentlichen Triebfedern und Phasen der Globalisierung?
Was erwarten sich KonsumentInnen von in der eigenen Region produzierten Lebensmitteln? Welche dieser Erwartungen könnten enttäuscht werden und warum?
Diskussionsfragen
Preisgünstige standardisierte Lebensmittel für die breite Masse oder hochpreisige regionale Premiumprodukte für die Eliten?
Bekämpfung des Welthungers durch die Liberalisierung der Agrarmärkte oder durch eine weitgehend auf Selbstversorgung ausgerichtete und national reglementierte Landwirtschaft?
Versorgungssicherheit in Krisen- und Kriegszeiten durch globale Vernetzung oder durch regionale Selbstversorgungsstrukturen?
Wie fair sind globale bzw. regionale Lebensmittelmärkte in Bezug auf soziale Ungleichheit oder Umweltfragen?
Wem oder worauf vertrauen Sie in Hinblick auf Lebensmittelqualität?