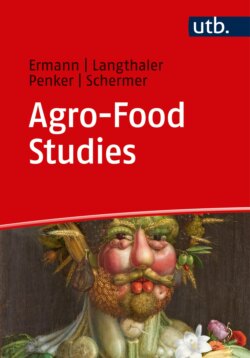Читать книгу Agro-Food Studies - Ernst Langthaler - Страница 9
Оглавление2. Tradition und Moderne
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Landwirtschaft und Ernährung jenseits des Gegensatzes von Tradition und Moderne. Es stützt sich dabei auf das Konzept des Nahrungsregimes, des aufeinander abgestimmten Wechselspiels von Wertschöpfungskonzentration entlang von Warenketten (Produktion, Distribution und Konsum) und deren Steuerung durch Akteure (Nationalstaaten, Unternehmen, Gewerkschaften usw.). Das Hauptaugenmerk gilt dem Zeitalter der Globalisierung, das Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung von Weltmärkten für Grundnahrungsmittel auf Basis neuer Transport- und Kommunikationstechnologien begann. Seitdem formierten sich mehrere globale Nahrungsregime und dazwischen gelagerte Übergänge. Für das erste oder UK-zentrierte Nahrungsregime (1870er–1920er Jahre) war der Handel von Getreide und Fleisch von Siedlerkolonien in Nord- und Südamerika und Australien in die europäischen Metropolen charakteristisch. Das zweite oder US-zentrierte Nahrungsregime (1940er–1970er Jahre) zeichnete sich durch den Handel von Agrarüberschüssen aus den USA nach Westeuropa und Japan (Futtermittel) sowie in die ‚Dritte Welt‘ (Getreide) aus. Das dritte oder WTO-zentrierte Nahrungsregime (1990er–2010er Jahre) ist vor allem durch den Handel von Futtermitteln aus den USA und Südamerika nach Europa, Japan und Ostasien sowie von Getreide aus Industrie- in Entwicklungsländer gekennzeichnet. Abschließend werden die Konturen eines künftigen Nahrungsregimes erörtert.
2.1 Einbahnstraße in die Moderne?
Wir sind gewohnt, das Früher vom Heute zu unterscheiden: Früher sei vieles oder alles anders gewesen als heute. Oft verbinden wir damit auch Wertungen: Das Früher sei ‚schlechter‘ oder ‚besser‘ gewesen als das Heute. Solche wertenden Unterscheidungen beziehen sich etwa auf die Landwirtschaft: Früher war das bäuerliche Arbeiten und Leben mühselig und ärmlich; heute genießen auch die Landwirte und Landwirtinnen dank des technischen Fortschritts Bequemlichkeit und Wohlstand. Oder umgekehrt: Früher wirtschafteten Bauernfamilien im harmonischen Einklang mit Dorfgemeinschaft und Naturkreisläufen; heute verursachen hoch technisierte Agrarunternehmen Landflucht und Umweltschäden. Auch die Ernährung bildet einen Bezugspunkt wertender Unterscheidungen: Früher verursachten Unwetter, Schädlinge und Kriege regelmäßige Hungersnöte; heute steht den Menschen im Durchschnitt genügend Nahrung zur Verfügung. Oder umgekehrt: Früher versorgten sich die Menschen selbst mit saisonaler und regionaler Nahrung; heute sind die Konsumenten von den gesundheits- und umweltschädigenden Produkten der Lebensmittelindustrie abhängig. Die Wertungen wechseln, eine Grundvorstellung bleibt gleich: Die Geschichte sei eine Zeitreise von einem – teils oder gänzlich anderen – früheren Zustand zum heutigen Zustand.
In den Sozial- und Kulturwissenschaften begegnen uns derart zielgerichtete („teleologische“) Geschichtsbilder etwa in Gestalt der Modernisierungstheorie. Die Modernisierungstheorie umfasst ein Bündel an Vorstellungen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Wandels von der „traditionalen“ zur „modernen“ Gesellschaft. Als „traditional“ gilt: agrarisch, manuell, feudalistisch, absolutistisch, gemeinschaftlich, religiös usw. Als „modern“ gilt: industriell, technisch, kapitalistisch, demokratisch, gesellschaftlich, säkularisiert usw. (Wehler 1975). Die Hauptakteure dieses Spiels der Gegensätze bilden der ‚Westen‘, repräsentiert durch die Länder (Nordwest-)Europas und ihre amerikanischen und australischen Ableger, als Vorreiter auf dem Weg zur Moderne und der ‚Rest der Welt‘ als Nachzügler. Die damit verbundene Vorstellung von Entwicklung orientiert sich am im ‚Westen‘ erreichten Stand als Zielmarke für den ‚Rest der Welt‘. Dieses ethnozentrische Geschichtsbild erlebte seine Blüte zwischen dem in den 1950er Jahren abhebenden Wirtschaftsboom und der Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre. Damit war die Vorstellung der Überlegenheit der kapitalistischen Industrieländer (‚Erste Welt‘) gegenüber sozialistischen Industrieländern (‚Zweite Welt‘) und Entwicklungsländern (‚Dritte Welt‘) (→ Globaler Süden) verbunden (Raphael und Doering-Manteuffel 2008).
Dieses Kapitel sucht den von der Modernisierungstheorie behaupteten Gegensatz von Tradition und Moderne zu umschiffen. Es entwirft die Geschichte von Landwirtschaft und Ernährung nicht als zielgerichtete Entwicklung von einem „traditionalen“ zu einem „modernen“ Zustand; vielmehr beschreibt es eine zieloffene Abfolge von Entwicklungsweisen in Gestalt weltumspannender → Nahrungsregime. Zunächst wird das Leitkonzept des Nahrungsregimes erläutert; danach werden Nahrungsregime vor und in der → Globalisierung samt ihren Übergängen skizziert; schließlich werden mögliche Zukunftsentwicklungen vor dem Hintergrund der Vergangenheit erörtert.
2.2 Nahrungsregime als Leitkonzept
Wir folgen dem von Harriet Friedmann und Philipp McMichael (1989) geprägten Konzept des Nahrungsregimes (food regime), einer Anwendung von Weltsystemanalyse (Wallerstein 2004) und Regulationstheorie (Boyer und Saillard 2002) auf Landwirtschaft und Ernährung. Ein Nahrungsregime umfasst das dauerhafte Zusammenspiel von Wertschöpfungskonzentration („Akkumulation“) und Steuerung („Regulation“) entlang transnationaler Warenketten (→ Wertschöpfungskette), die von der Produktion über die Distribution bis zum Konsum (einschließlich der Entsorgung) von Nahrung reichen. Zwischen den mehrere Jahrzehnte langen Regimephasen liegen oft durch Wirtschaftskrisen oder Staatenkonflikte hervorgerufene Übergänge, die alte, widersprüchlich gewordene Akkumulations- und Regulationsweisen durch neue, in sich stimmigere Regime überwinden. Die Literatur unterscheidet drei globale Nahrungsregime: das erste, UK-zentrierte oder extensive food regime von den 1870er bis zu den 1920er Jahren, das zweite, US-zentrierte oder intensive food regime von den 1940er bis zu den 1970er Jahren und das dritte, WTO-zentrierte oder corporate food regime seit den 1990er Jahren. Jedes Nahrungsregime zeichnet sich durch ungleiche Tausch- und Machtbeziehungen zwischen Zentren und (Semi-)Peripherien innerhalb des Weltsystems aus (McMichael 2009, 2013; Atkins und Bowler 2001, 23 ff.; Magnan 2012; Le Heron 2013; Bernstein 2016).
Zu den Stärken des Nahrungsregime-Konzepts zählen erstens die Verbindung von Produktions- und Konsumfragen, zweitens die transnationale, den Nationalstaat als Untersuchungsrahmen überwindende Ausrichtung und drittens die zieloffene, nicht auf einen Endzustand verengte Entwicklungsperspektive. Dem stehen einige Schwächen des anfänglichen Konzepts gegenüber: erstens der Westzentrismus, der den ‚Rest der Welt‘ an den Rand rückt; zweitens der Soziologismus, der ökologische Dimensionen ausblendet; drittens der Strukturfunktionalismus, der die Denk- und Handlungsmacht von Akteuren unterbelichtet. Um diese Schwächen zu überwinden, suchen aktuelle Ansätze vor allem postkoloniale, sozialökologische und akteurorientierte Perspektiven zu stärken (Langthaler 2015, 2016c).
2.3 Nahrungsregime vor der Globalisierung
Nahrung ist ein für Menschen existenzielles, aber knappes – und daher umkämpftes – Gut. Folglich suchen Gesellschaften seit der Einführung von Ackerbau und Viehzucht in verschiedenen Weltregionen vor zwölf bis drei Jahrtausenden („neolithische Revolution“) den Ressourcenfluss zwischen Landwirtschaft und Ernährung nach bestimmten Maßstäben zu regeln – und errichten auf diese Weise Nahrungsregime mit regionaler oder überregionaler Reichweite. Während die Angehörigen von Agrargesellschaften überwiegend selbstproduzierte Nahrung konsumierten, traten in Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften Nahrungsproduktion und -konsum auseinander; damit gewann die Distribution von Nahrung an Stellenwert. Der Handel mit großen Mengen an Grundnahrungsmitteln (Weizen, Mais, Reis usw.) blieb in den europäischen Agrargesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit aufgrund beschränkter Energie- und Transportkapazitäten auf kleine Räume und begünstigte Standorte an Flüssen oder Seehäfen beschränkt; die Märkte waren meist regional segmentiert (siehe Kapitel 3; Tauger 2011; Pilcher 2006; Flandrin und Montanari 1999; Kiple und Ornelas 2000; Cerman et al. 2008).
Freilich verbreiteten sich auch in vorindustrieller Zeit Nutztiere und Kulturpflanzen über die Grenzen von Regionen, Reichen und Kontinenten hinweg. Die Expansion europäischer Seemächte in die „Neue Welt“ nach der Landung der Spanier unter Christoph Kolumbus in Amerika 1492 auf der Suche nach einer Westroute nach Indien – als Alternative zum schwer kontrollierbaren Landweg in Richtung Osten als Lebensader des eurasischen Gewürzhandels – fachte den wechselseitigen Transfer von Tier- und Pflanzenarten an („Kolumbianischer Austausch“). So etwa gelangten Maisund Kartoffelpflanzen über den Atlantik nach Europa, wo sie jedoch zunächst nur in den Gärten von Schlössern und Klöstern gezogen wurden. Erst im 18. und 19. Jahrhundert verbreiteten sich Mais und Kartoffeln im Zuge wiederkehrender Hungerkrisen und obrigkeitlicher Förderung, vor allem unter der ärmeren Bevölkerung, als Grundnahrungsmittel (Crosby 1990). In die Gegenrichtung wanderte – neben europäischen Infektionskrankheiten, denen die indigenen Völker Amerikas mangels Abwehrkräften massenhaft erlagen – das von Indien in den Mittelmeerraum vorgedrungene Zuckerrohr. Der Zucker und seine Produkte standen vom späten 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert im Zentrum des atlantischen Dreieckshandels (siehe Box 2.1).
Box 2.1: Zucker im Zentrum des atlantischen Dreieckshandels
Der Atlantische Ozean bildete seit dem 16. Jahrhundert das wichtigste Operationsgebiet der militärischen und kommerziellen Expansion europäischer Seemächte. Da die indigene Bevölkerung Amerikas weitgehend dezimiert war, mobilisierten die Kolonisatoren Arbeitskräfte aus anderen Weltregionen. So begannen europäische Handelsunternehmen an der westafrikanischen Küste in großem Umfang Waffen, Metallwaren und Textilien gegen gefangene AfrikanerInnen zu tauschen. Nach der Überfahrt über den Atlantik – bis 1870 wurden etwa 10 Mio. Menschen verschifft – veräußerten sie in der Karibik die zur Plantagenarbeit bestimmten SklavInnen gegen Rohrzucker, den daraus gebrannten Rum und andere Waren. Schließlich verkauften sie ihre Schiffsladungen in England und anderen Küstenstaaten Europas, wo der karibische Zucker – in Kombination mit dem indischen Tee – als billiger Kalorienlieferant für die wachsende Industriearbeiterschaft diente. Auf diese Weise schuf der atlantische Dreieckshandel Wirkungsketten zwischen westafrikanischen Dörfern, karibischen Plantagen und europäischen Arbeiterküchen (Mintz 1985).
Afrikanische Sklaven bei der Arbeit auf einer Zuckerplantage auf der Karibikinsel Antigua 1823 (Wikimedia Commons)
Der atlantische Dreieckshandel umfasste bereits Elemente eines globalen Nahrungsregimes: die Akkumulation von Gewinnen und die Regulation von Warenflüssen – einschließlich der zu ‚Waren‘ degradierten Menschen aus Afrika – zwischen mehreren Kontinenten durch europäische Handelsunternehmen. Doch ein Kernelement fehlte ihm: globale Märkte für Grundnahrungsmittel. Erst Dampfmaschine und Telegraf als Technologien der industriellen Revolution befeuerten ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Transport- und Kommunikationsrevolution, die die Welt gleichsam schrumpfen ließ (time-space compression; Harvey 1990, 284 ff.). Nun wurde auch der großvolumige Agrarhandel zwischen europäischen Nationalstaaten und davon abhängigen Gebieten in Übersee erschwinglich. Damit entstanden erstmals transkontinentale Märkte für Grundnahrungsmittel. Zwar hatten Tier- und Pflanzentransfers bereits seit Jahrtausenden und verstärkt ab dem „Kolumbianischen Austausch“ verschiedene Kontinente miteinander verflochten; doch erst ab den 1870er Jahren erfasste die Globalisierung Landwirtschaft und Ernährung im großen Umfang (siehe Kapitel 3; Langthaler 2010, 2016c; Kaller-Dietrich 2011).
2.4 UK-zentriertes Nahrungsregime (1870er–1920er Jahre)
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstand um das Vereinigte Königreich (United Kingdom, UK) ein globales Nahrungsregime, das die wachsenden Industriezentren der Britischen Inseln und Kontinentaleuropas mit Grundnahrungsmitteln aus agrarischen Randlagen außerhalb des Kontinents versorgte. Getreide und, nach Entwicklung der Kühltechnik, Gefrierfleisch gelangten aus den klimatisch gemäßigten Siedlerkolonien Nord- und Südamerikas, Ozeaniens und Zentralasiens mittels Dampfeisenbahn und Dampfschiff auf dem wachsenden Schienen- und Wasserwegenetz (z. B. Suezkanal 1869) in die europäischen Metropolstaaten. Auf dem globalen Getreidemarkt traten vor dem Ersten Weltkrieg Russland, Argentinien und die USA als Hauptexporteure sowie Großbritannien, Deutschland, Belgien und die Niederlande als Hauptimporteure auf (siehe Box 2.2). Das institutionelle Regelwerk dieser Handelsströme umfasste die Freihandelspolitik (z. B. Aufhebung der britischen Getreidezölle 1846) und den Goldstandard mit dem Britischen Pfund als internationaler Leitwährung.
Box 2.2: Globaler Getreidehandel vor dem Ersten Weltkrieg
Vor dem Ersten Weltkrieg war Russland der bei Weitem größte Getreideexporteur. Danach folgten von europäischen Siedlern kolonisierte Gebiete in Übersee: Argentinien, USA, Kanada sowie Australien und Neuseeland. Zudem waren auch Rumänien und Indien wichtige Exportländer. Die wichtigsten Importeure von Getreide waren europäische (Kolonial-)Staaten: Allen voran lagen Großbritannien und Irland, gefolgt vom Deutschen Reich, Belgien und den Niederlanden, Frankreich und Italien. Die Importländer unterschieden sich nach dem Anteil der Getreideeinfuhren am Inlandsverbrauch. Auf der einen Seite standen Kolonialmächte, die ihren Getreideverbrauch zu fast zwei Dritteln über Importe deckten: Großbritannien und Irland sowie Belgien und die Niederlande. Auf der anderen Seite lagen die fast autarken Länder, darunter die kontinentalen Vielvölkerreiche Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Die übrigen Staaten verzeichneten Importanteile zwischen rund einem Zehntel (Frankreich) und einem Viertel (Dänemark). Dass Industrialisierungsgrad und Importabhängigkeit bei Nahrungsmitteln zusammenhängen, legen die Beispiele des hoch industrialisierten Großbritanniens und des (vor allem im Osten des Reiches) noch stark agrarisch geprägten Österreich-Ungarns nahe. Gegen diesen Zusammenhang spricht das hoch industrialisierte, aber vergleichsweise importunabhängige Deutsche Reich, das eine protektionistische Handelspolitik mittel Getreideeinfuhrzöllen verfolgte (Langthaler 2010).
Grundzüge des Weltgetreidehandels 1909/13 (eigene Darstellung nach Langthaler 2010, 145)
Die britischen Getreide- und Fleischeinfuhren dienten vor allem den Interessen von Nationalstaat und Industriekapital: Billige Grundnahrungsmittel für die wachsende Industriearbeiterschaft in der britischen „Werkstatt der Welt“ vermochten deren Protestpotenzial einzudämmen und Lohnkosten zu verringern (Koning 1994, 11 ff.; Tanner 1999). In den stetig sinkenden Brotpreisen Londons wirkten mehrere Glieder der transkontinentalen Wertschöpfungskette zusammen: billige Land- und Arbeitskraftressourcen – nährstoffreiche Graslandflächen und verzichtgewohnte Siedlerfamilien – an den überseeischen und zentralasiatischen Pionierfronten; billiger Ferntransport mittels Dampftechnologie zu Lande und zu Wasser; billige Massengüter der aufblühenden Lebensmittelindustrie; schließlich billige Arbeitskräfte, einschließlich Frauen und Kinder, in den nordwesteuropäischen Industrierevieren. Kurz, die interessengeleitete „Vermarktlichung“ entlang der Nahrungskette gliederte Gesellschaft und Umwelt in verschiedenen Weltregionen in das UK-zentrierte Nahrungsregime ein (McMichael 2013, 26 ff.).
Das UK-zentrierte Nahrungsregime beschleunigte nicht nur den Niedergang der zuvor hoch entwickelten Landwirtschaft auf den Britischen Inseln, sondern auch das Vorrücken der intensiven Getreidebau-Rindermast-Mischwirtschaft nach europäischem Maßstab in Übersee, das der indigenen Bevölkerung und deren extensiver Landnutzung (z. B. Wanderfeldbau) die Lebensgrundlage entzog (Barbier 2011, 368 ff.). Zur Rechtfertigung dieser Widersprüche diente die westliche Ideologie der „Zivilisation“, die europäische Herrschafts-, Besitz- und Deutungsansprüche über die politischen, ökonomischen und kulturellen Rechte der „Primitiven“ erhob – und damit die Ungleichheit zwischen den Weltregionen zementierte (Davis 2002).
In die Krise geriet das UK-zentrierte Nahrungsregime jedoch weniger durch innere als durch äußere Widersprüche: Unter dem Preisdruck der „Getreideinvasion“ (O’Rourke 1997) aus Übersee suchten kontinentaleuropäische Staaten, beginnend mit Deutschland und Frankreich, ihre nationalen Agrarsektoren mittels Einfuhrzöllen zu schützen. Dies galt für bäuerlich geprägte Formen der Landwirtschaft im Westen wie für die Gutsbetriebe im Osten Europas. Hinter der Zollschutzpolitik standen meist Koalitionen aus Großgrundbesitz, Bauernverbänden und Industriekapital, die wirtschaftliche und politische Interessen – etwa die Sorge vor dem revolutionären Potenzial der Industriearbeiterschaft – verbanden. Hinzu kam die Sorge vieler in nationalistische Konflikte verstrickter Staaten um die → Ernährungssicherheit im Kriegsfall. Diese protektionistische Bewegung legte im Gefolge des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre das Freihandelsregime unter britischer Führung letztlich lahm (siehe Abb. 2.1; Aldenhoff-Hübinger 2002).
Abb. 2.1: Übersicht zum UK-zentrierten Nahrungsregime (eigene Darstellung)
2.5 US-zentriertes Nahrungsregime (1940er–1970er Jahre)
Das US-zentrierte Nahrungsregime, das sich während der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs formierte, verlagerte die globalen Handelsbeziehungen. Nicht mehr Peripherien versorgten mit ihren Überschüssen das Zentrum, wie im UK-zentrierten Nahrungsregime außereuropäische Siedlerkolonien die britische Metropole. Stattdessen exportierten die USA als neues Zentrum ihre Überschüsse in westlich orientierte Industrie- und Entwicklungsländer als neue (Semi-)Peripherien (McMichael 2013, 32 ff.). Die US-Regierung suchte die ökonomisch-ökologische Doppelkrise der 1930er Jahre – den Rentabilitätseinbruch während der Weltwirtschaftskrise gepaart mit der katastrophalen Winderosion auf den Ackerflächen des Mittleren Westens (Worster 1982; Cunfer 2005) – durch staatliche Preisstützungen und Produktionsbeschränkungen zu bewältigen. Der Ausbau der Preisstützungen und der Wegfall der Produktionsbeschränkungen trieben den US-amerikanischen Agrarsektor während des Krieges zu Höchstleistungen; dabei galt es, zunächst die übrigen Alliierten, dann auch die US-Armee im Mehrfrontenkrieg zu versorgen (Winders 2012, 51 ff.). Die frei werdenden Rohstoffe – etwa die im Krieg für Sprengstoffe reservierten, nun als Mineraldünger verfügbaren Stickstoffverbindungen – regten den Übergang von einem Sonnenenergie und Fotosynthese nutzenden zu einem Fossilenergie verbrauchenden Agrarsystem an (siehe Kapitel 4). Das agroindustrielle Modell wurde nicht nur auf Europa und Japan, sondern im Zuge der → „Grünen Revolution“ auch auf Lateinamerika, Asien und – mit weitaus geringerem Erfolg – Afrika übertragen. Mittels intensiven Einsatzes arbeits- und landsparender Technologien (siehe Box 2.3), etwa von Hochleistungssaatgut, Mineraldünger und Pestiziden, wurde die Arbeits- und Landproduktivität nach oben katapultiert (Anderson 2009; Djurfeldt et al. 2005; Cullather 2010).
Box 2.3: Internationale Agrarentwicklung 1880–1980
Pfade der Agrarentwicklung ausgewählter Staaten 1880–1980 (eigene Darstellung nach Langthaler 2010, 148)
Wenn auch die Wege der Agrarentwicklung von Land zu Land unterschiedlich ausgeprägt waren – die Richtungen ähnelten einander: kapitalintensives Wachstum mittels wissenschaftlich-technischer Neuerungen. Technische Innovationen können in unterschiedlicher Weise Agrarwachstum auslösen: über die Steigerung der Arbeitsproduktivität mittels arbeitssparender Technologie (z. B. Mähdrescher) einerseits, der Flächenproduktivität mittels landsparender Technologie (z. B. Mineraldünger) andererseits. Beide Wege der Technisierung erfordern eine Reihe institutioneller Innovationen, die den Einsatz der jeweiligen Technologie regeln (z. B. Forschungs- und Bildungseinrichtungen). Auf welche Weise technische und institutionelle Innovationen in Gang gesetzt („induziert“) wurden, lässt sich am internationalen Vergleich der Agrarentwicklung 1880 bis 1980 ablesen. Auffällig ist zunächst, dass die nationalen Wachstumspfade auf unterschiedlichen Niveaus verliefen. Dafür waren die unterschiedlichen pro Arbeitskraft verfügbaren Flächen verantwortlich – mit dem Spitzenreiter USA. In den europäischen Staaten lagen die entsprechenden Werte erheblich niedriger. Japan wies die geringsten Pro-Kopf-Flächen auf. Zudem fällt auf, dass die Wachstumspfade zwar in etwa derselben Richtung – von links unten nach rechts oben –, jedoch mit unterschiedlicher Steigung fortschritten. Auf dieser Grundlage lässt sich die Frage, wie technischer und institutioneller Wandel induziert wurde, knapp beantworten: In Weltregionen mit geringer Arbeitskraftdichte und großer Fläche pro Landarbeitskraft wie den USA wurde der im Vergleich zu Boden teure Produktionsfaktor Arbeit primär durch mechanische, die Arbeitsproduktivität steigernde Technologie ersetzt. In Weltregionen mit hoher Arbeitskraftdichte mit kleiner Fläche pro Landarbeitskraft wie Japan und, mit einigem Abstand, Europa wurde der im Vergleich zu Arbeit teure Produktionsfaktor Boden in höherem Maß durch landsparende, die Bodenproduktivität steigernde Technologie ersetzt. Die Industrialisierung induzierte im Agrarsektor – je nach Ausstattung mit Arbeit und Boden – den Ersatz des jeweils knapperen, folglich teureren Produktionsfaktors durch Kapital, indem sie ein billiges Angebot an arbeits- und landsparenden Technologien sowie die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigerte. Umgekehrt erhöhte das landwirtschaftliche Produktivitätswachstum die Nachfrage nach industriellen Inputs sowie – im Fall von arbeitssparender Technologie – das Angebot an Industriearbeitskräften. Kurz, Agrar- und Industrieentwicklung trieben einander wechselseitig an (Hayami und Ruttan 1985).
In der Nachkriegszeit suchten die USA ihre Agrarüberschüsse nicht abzubauen, sondern – in Vorwegnahme von Welternährungsplänen der Vereinten Nationen – in hungergefährdeten, der westlichen Hemisphäre zugerechneten Staaten mit kriegerischen oder kolonialen Erblasten abzusetzen. Nahrung diente angesichts von Entkolonialisierung und „Kaltem Krieg“ als Waffe zur Eindämmung von Welthunger und Weltkommunismus. Die ideologische Rechtfertigung dieser doppelten Eindämmungsstrategie lieferte die produktivistische Vision, jeglichen Mehrbedarf durch ein Mehrangebot decken zu können. Das entsprechende Regelwerk umfasste einerseits das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) von 1947, das entsprechend der im „Kalten Krieg“ aufgewerteten Ernährungssicherheit den Agrarbereich aus der Handelsliberalisierung ausklammerte und protektionistische Maßnahmen gestattete. Andererseits sicherte das Abkommen von Bretton Woods von 1944 stabile Wechselkurse mit dem US-Dollar als Ankerwährung.
Zunächst forcierte das European Recovery Program („Marshallplan“) von 1947 den Wiederaufbau der westeuropäischen Landwirtschaft mittels Technologie- und Wissenstransfers nach produktivistischem Muster. Nahrungshilfen wurden dabei nur zum Ausgleich der kriegsbedingten Einbrüche gewährt. In dem Maß, in dem Westeuropa den Grad seiner Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln steigerte, verengte sich der Absatzmarkt für die US-amerikanischen Agrarüberschüsse. Umgekehrte Akzente setzte das Food for Peace Program von 1954, das die US-Regierung zur Entwicklungshilfe für bedürftige Länder – einschließlich Japans, das bereits seit 1946 US-Nahrungshilfe erhalten hatte – ermächtigte. Damit erschlossen die USA auf Betreiben heimischer Farmerverbände staatssubventionierte Absatzmärkte für die Agrarüberschüsse – vor allem für Weizen, aber auch für Baumwolle, Ölfrüchte und Milchprodukte (Winders 2012, 146 ff.).
Dieses Hilfsprogramm konzentrierte sich auf Nahrungslieferungen an hungergefährdete und militärstrategisch wichtige Entwicklungsländer; doch ein breit angelegter (Wieder-)Aufbau der Landwirtschaft in diesen Staaten war nicht beabsichtigt. Auch die „Grüne Revolution“ – als Gegengift zur ‚roten‘, kommunistischen Revolution – kam beim Transfer westlicher Hochleistungstechnologie und der damit verbundenen Abhängigkeit von Expertenwissen und Bankkrediten vor allem den herrschenden und kapitalistisch orientierten Klassen im jeweiligen Land zugute (Cullather 2010). Dies erzeugte neokoloniale Abhängigkeiten: Einerseits forcierten Nahrungshilfen zu billigen Preisen den Wandel der bäuerlichen → Landwirtschaftsstile von der Subsistenz- und Binnenmarktproduktion zur Weltmarktproduktion. Andererseits trieben sie den Wandel der → Ernährungsstile von regional angepassten zu am westlichen Standard orientierten voran. Nutznießer beider Entwicklungen waren transnational operierende Unternehmen mit Sitz in Nordamerika oder Westeuropa, die den Fernhandel mit tropischen Rohprodukten und die industrielle Lebensmittelverarbeitung kontrollierten (McMichael 2013, 32 ff.).
Während die USA überschüssiges Brotgetreide vor allem als Nahrungsmittelhilfen in die ‚Dritte Welt‘ lenkten, exportierten sie die im Rahmen des GATT zollbefreiten Mais- und Sojabohnenüberschüsse nach Westeuropa und Japan als Futtermittel für den wachsenden Viehmastkomplex (siehe Box 2.4). Das Angebot an industriell hergestellten Fleisch- und Wurstwaren stieß auf die Nachfrage einer kaufkräftigen und am American way of life orientierten Konsumgesellschaft (Levenstein 2003; Hirschfelder 2005, 234 ff.; Langthaler 2016a, 2016b). Was in den 1950er Jahren als nachholende „Fresswelle“ einsetzte, mündete in den Folgejahrzehnten im grundlegenden Wandel der westlichen Ernährungsstile von getreide- und kartoffel- zu fleisch- und zuckerreicher Kost. Der Speisezettel der westlichen Wohlstandsgesellschaft verband sich mit rassen-, klassen- und geschlechterspezifischen Deutungen; er signalisierte ‚weiße‘, ‚mittelständische‘ und ‚männliche‘ Kost als Ausweis gesellschaftlichen Aufstiegs (siehe Kapitel 8). Schauplätze dieses standardisierten Lebensstils bildeten neben dem Familientisch in den eigenen vier Wänden neue Formen des Einzelhandels (z. B. Supermärkte) und des Essens außer Haus (z. B. → fast food; Schlosser 2002; Ritzer 2006). Der Landwirtschaft vor- und nachgelagerte Industrien an den Flaschenhälsen der Wertschöpfungskette steigerten ihre Profite, jedoch unter Ausklammerung erheblicher sozialer und ökologischer Kosten (Weir 2014; Weis 2013; Smil 2013; Langthaler 2016a, 2016b).
Box 2.4: Handelsbilanz für Getreide, Ölsaaten und Fleisch 1946–1990 (eigene Darstellung nach www.fao.org/faostat)
Das US-zentrierte Regime war durch hohes Wachstum sowohl von Agrarproduktion als auch von Handelsflüssen gekennzeichnet. Dieses Wachstum hielt bis etwa 1980 an; dann begannen insbesondere die globalen Exporte und Importe zu stagnieren. Zwischen 1950 und 1980 verdoppelte sich die globale Getreideproduktion von 0,5 auf 1,1 Gigatonnen/Jahr, die Exporte stiegen um einen Faktor 6 auf 200 Mio. Tonnen/Jahr, wobei sich hier der Schwerpunkt von Brot- auf Futtergetreide verschob. In dieser Phase dominierten die USA den globalen Agrarhandel. Die US-Getreideexporte stiegen auf über 100 Mio. Tonnen; damit kamen in den 1970er Jahren knapp 50 % der globalen Getreideexporte und 65 % der Ölsaatenexporte aus den USA. In der UdSSR konnte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg die Getreideproduktion mit dem schnell steigenden Verbrauch, vor allem durch die expandierende Fleischproduktion, nicht Schritt halten und erlangte in diesem Regime keine Bedeutung mehr. Die UdSSR wurde in der Folge in den 1970er Jahren sogar zu einem großen Getreideimporteur. Die nordamerikanischen Exporte gingen bis in die 1950er Jahre noch überwiegend nach Europa. Erst danach entwickelte sich Asien zur wichtigsten Importregion, trotz der gleichzeitigen Steigerung der Produktion als Folge der „Grünen Revolution“. Ab den 1970er Jahren nahm auch die Bedeutung von Afrika als Importregion zu, während die Exporte der USA nach Europa zurückgingen. In diesem Regime nahm vor allem der Handel mit Sojabohnen, insbesondere als Eiweißfuttermittel in der industriellen Tierproduktion, und mit Fleisch stark zu. Diese Agrarprodukte wurden neben Getreide zu mengenmäßig bedeutenden Handelsgütern. In den zwei Jahrzehnten von 1961 bis 1980 stiegen der globale Handel von Ölsaaten von 15 auf 60 Mio. Tonnen und jener von Fleisch von 3,5 auf 9,5 Mio. Tonnen an. Während die Handelsrichtung bei den Ölsaaten vor allem von Nordamerika und ab 1975 zunehmend auch von Südamerika nach Europa ging, kamen die Fleischexporte vor allem aus Australien und Neuseeland (Ozeanien) sowie Südamerika. Erst in den 1980er Jahren entwickelte sich dann auch Europa zu einer Nettoexportregion von Fleisch (Krausmann und Langthaler 2016).
Anmerkung: Das Diagramm zeigt die physische Handelsbilanz (Importe minus Exporte). Positive Werte bedeuten Nettoimport, negative Werte Nettoexport.
In der Welternährungskrise 1972 bis 1975 ließen massive Getreideverkäufe der USA an die Sowjetunion, großflächige Missernten und der „Ölschock“ von 1973 die Agrarpreise hochschnellen (siehe Kapitel 7; Gerlach 2005). Dabei offenbarten sich die Widersprüche des US-zentrierten Nahrungsregimes an mehreren Punkten: Erstens belasteten die staatssubventionierten Agrarüberschüsse zunehmend die öffentlichen Haushalte, so etwa der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit ihrer auf bäuerliche Einkommens- und nationale Ernährungssicherheit ausgerichteten → Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP; Knudsen 2009; Patel 2009). Zweitens verschärften die Versuche, die wachsenden Produktionsüberschüsse mittels Preissubventionen auf dem Weltmarkt abzusetzen, den internationalen Wettbewerb. Drittens sahen die aufstrebenden transnationalen Unternehmen den nationalstaatlichen Protektionismus (→ Liberalismus) im Agrar- und Ernährungsbereich zunehmend als Hemmschuh für ihre Geschäftsstrategien. Diese Widersprüche befeuerten die Versuche der GATT-Reform ab 1986, ein neues Regelwerk im Zeichen des Neoliberalismus zu schaffen (siehe Abb. 2.2; Winders 2012, 153).
Abb. 2.2: Übersicht zum US-zentrierten Nahrungsregime (eigene Darstellung)
2.6 WTO-zentriertes Nahrungsregime (1990er–2010er Jahre)
Vom US-zentrierten Nahrungsregime hob sich das neoliberal ausgerichtete vor allem durch die veränderte Rolle des Staates ab: Verstanden sich Nationalstaaten zuvor als Beherrscher des Marktes, definierte sie der Neoliberalismus nunmehr als dessen Dienstleister. Dementsprechend galt Ernährungssicherheit nicht mehr als unveräußerliches Menschenrecht – so die FAO noch in der Welternährungskrise der 1970er Jahre –, sondern war nach der Lesart der Weltbank in den 1980er Jahren eine Leistung des Weltmarkts. Gemäß dem Grundsatz vom → „komparativen Kostenvorteil“ solle sich jedes Land auf die Güter spezialisieren, die es relativ günstiger herstellen kann, und den restlichen Bedarf über Freihandel decken. Die dafür erforderliche Liberalisierung der Märkte, die exportorientierte New Agricultural Countries (Brasilien, Argentinien, Neuseeland usw.) und transnationale Unternehmen in der Uruguay-Runde des GATT ab 1986 vorantrieben, wurde 1995 im Agreement on Agriculture der neu gegründeten Welthandelsorganisation (WTO) festgeschrieben. Angesichts des Gewichts transnationaler Unternehmen, die sich immer mehr auf den entfesselten Finanzmärkten engagierten (siehe Box 2.5), wird das WTO-zentrierte Nahrungsregime auch als corporate oder flexible food regime bezeichnet (Vorley 2003; McMichael 2013, 47 ff.).
Box 2.5: Parmalat und die „Finanzialisierung“ der Agrarindustrie
Parmalat als Drei-Ebenen-Netzwerk ‚flexibler‘ Kapitalakkumulation (eigene Darstellung nach Langthaler 2010, 160)
Innerhalb des neoliberalen Regelwerks gewannen agroindustrielle Unternehmen zusätzlichen Spielraum. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb untereinander, sondern auch mit Nationalstaaten und nichtstaatlichen Organisationen (Non-Governmental Organisations, NGOs). Ein Beispiel stellt die Firma Parmalat dar, die zu einem transnationalen Lebensmittelkonzern aufgestiegen war. Ihre Drei-Ebenen-Netzwerkarchitektur war charakteristisch für die ‚flexibel‘ regulierte Kapitalakkumulation der Globalisierungsära seit den 1990er Jahren: Auf der ersten Ebene generierten ProduzentInnen und KonsumentInnen in verschiedenen Ländern, die über das weitgespannte Verarbeitungs- und Verteilungsnetz auf der zweiten Ebene verknüpft waren, Wertschöpfung. Das parteipolitisch und finanzökonomisch eng verflochtene Kontrollzentrum auf der dritten Ebene (Parmalat Finanziaria) saugte die ‚realen‘ Werte auf und suchte sie im globalen Finanzsystem in ‚virtuelle‘ (Mehr-)Werte zu verwandeln – eine Strategie, die 2003 in einen desaströsen Finanzcrash mündete (van der Ploeg 2008, 87 ff.).
Obwohl die WTO im Agreement on Agriculture die Entfesselung der Weltagrarmärkte auf ihre Agenda setzte (siehe Box 2.6), schlossen protektionistische Regulierung und neoliberale Deregulierung einander nicht aus. So etwa gelang es den USA, der EU und Japan, durch Umschichtungen ihre erheblichen Agrarsubventionen beizubehalten – zum Nutzen von Großfarmern und Agroindustrie. Demgemäß ging die EU in der GAP-Reform von 1992 von mengengebundenen Preissubventionen (amber box) zu von der Produktionsmenge entkoppelten Flächen- und Tierprämien (blue box) und zur Förderung der → Multifunktionalität (siehe Abschnitt 4.2.2) im Rahmen des Programms zur ländlichen Entwicklung (green box) über. Auch die USA, Japan und andere Industriestaaten betrieben reges boxing (Buckland 2004, 97 ff.). Folglich verfehlte der WTO-Zugang zur Ernährungssicherheit das Ziel der Handelsgerechtigkeit mittels Liberalisierung nicht nur, sondern beförderte dessen Gegenteil – die Verfestigung der Benachteiligung der Länder des Globalen Südens gegenüber den Agrarprotektionisten des Globalen Nordens (→ Globaler Süden) (McMichael 2013, 53).
Box 2.6: Handelsströme für Getreide, Ölsaaten und Fleisch 1990–2012 (eigene Darstellung nach www.fao.org/faostat)
Die Wachstumsphase des US-zentrierten Nahrungsregimes mündete in den 1980er Jahren in eine Phase der Stagnation. In diesem Jahrzehnt wuchs die globale Produktion nur langsam und die Nettohandelsflüsse sowohl von Getreide als auch von Ölsaaten und Fleisch blieben weitgehend stabil. Erst in den 1990er Jahren wurde fast zeitgleich mit der GATT-Reform eine neue Dynamik sichtbar, als die Exporte von Ölsaaten und Fleisch mit hohen Raten zu wachsen begannen. Ab der Jahrtausendwende begann dann mit etwas Verzögerung auch der globale Getreidehandel wieder zuzunehmen. Die Getreideexporte wurden weiterhin von Nordamerika dominiert, während Europa zurücktrat und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zulegten; diese Exporte flossen überwiegend nach Asien und Afrika. Bei den Ölsaaten, vor allem bei Sojabohnen, kam der Zuwachs der Exporte überwiegend aus Südamerika und ging in Richtung der wachsenden Märkte in Asien; auch beim Fleisch entwickelte sich Südamerika zur dominierenden Exportregion und Asien zum größten Absatzmarkt (Krausmann und Langthaler 2016).
Anmerkung: Das Diagramm zeigt die physische Handelsbilanz (Importe minus Exporte). Positive Werte bedeuten Nettoimport, negative Werte Nettoexport.
Das anhaltende Dumping von Agrarüberschüssen drückte die Weltmarktpreise unter die Produktionskosten. Dies wirkte zwar zum Vorteil transnationaler Handels- und Verarbeitungsunternehmen, benachteiligte jedoch die (klein-)bäuerlichen NahrungsproduzentInnen weltweit, vor allem im Globalen Süden. Laut einer Schätzung der Welternährungsorganisation FAO verloren hier in 16 Ländern 20 bis 30 Mio. Menschen aufgrund der Liberalisierung des Agrarhandels ihre bäuerliche Existenz (Madeley 2000, 75; Patel 2008; Brookfield und Parsons 2007). Viele Entwicklungsländer (→ Globaler Süden) hatten bereits im US-zentrierten Nahrungsregime begonnen, die Exportlandwirtschaft für tropische Güter zu forcieren und Grundnahrungsmittel aus Industrieländern zu importieren. Diese Tendenz verschärfte sich im WTO-zentrierten Regime durch „Strukturanpassungsprogramme“ von Weltbank und Internationalem Währungsfonds zum Schuldenabbau sowie durch → land grabbing durch transnationale Unternehmen im Bündnis mit nationalen Regierungen (Englert und Gärber 2014). Einige Staaten Lateinamerikas und Asiens stiegen als New Agricultural Countries durch Agrarexporte, etwa von Sojabohnen (siehe Box 2.7), zu den global players auf; dies ging jedoch oft zulasten der Ernährungssicherheit der ärmeren, von Nahrungsimporten abhängigen Bevölkerungsklassen. Trotz einzelner Exporterfolge waren Mitte der 2000er Jahre 70 % der Länder des Globalen Südens Nettoimporteure von Nahrungsmitteln. Auf diese Weise wurden sie verletzlicher gegenüber Preisschwankungen auf dem Weltmarkt – wie etwa 2007/08, als die Grundnahrungsmittelpreise binnen eines Jahres auf das Zwei- bis Dreifache hochschnellten (siehe Box 3.2; McMichael 2013, 47 ff.).
Box 2.7: Die Weltkarriere der Sojabohne im 20. Jahrhundert (eigene Darstellung nach Langthaler 2015, 60)
Die Sojabohne, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich in Ostasien angebaut und verbraucht wurde, erfuhr im 20. Jahrhundert eine erstaunliche Weltkarriere. Aufgrund ihres hohen Fett- und Eiweißgehalts wurde die Frucht häufig als „Wunderbohne“ bezeichnet. Im UK-zentrierten Nahrungsregime verliefen europäische Anbauversuche, etwa durch den Österreicher Friedrich Haberlandt in den 1870er Jahren, zunächst im Sand. Doch noch vor dem Ersten Weltkrieg begannen Handelsunternehmen, Sojabohnen(-produkte) aus der – zwischen Russland und Japan umkämpften – nordostchinesischen Mandschurei nach Westeuropa zu verschiffen. Dort diente das Öl als industrieller Rohstoff, etwa zur Seifenherstellung. Im US-zentrierten Nahrungsregime stiegen die USA im und nach dem Zweiten Weltkrieg zum führenden Sojaproduzenten und -exporteur auf. Dabei gewann zunehmend der bei der Ölgewinnung anfallende Ölkuchen als eiweißreiches Futtermittel für den US-amerikanischen, westeuropäischen und japanischen Viehkomplex an Gewicht. Im WTO-zentrierten Nahrungsregime machten Brasilien und andere Staaten Südamerikas den USA die Führungsrolle auf dem Weltmarkt für Sojaprodukte streitig. Als Hauptabnehmer trat neben Europa und Japan nun China, dessen urbane Mittelschichten zunehmend den Fleischkonsum – und damit den Futtermittelverbrauch – in die Höhe trieben. Im Lauf des 20. Jahrhunderts wurde die Sojabohne von einem fernöstlichen Gemüse für den menschlichen Verzehr zu einer ‚verwestlichten‘ Ölfrucht als Quelle für eine Fülle weiterer Produkte: als Pflanzenöl für die menschliche Ernährung, als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Industrieprodukte (Farben, Kleber, Kosmetika usw.) und als Futtermittel für die wachsenden Nutzviehherden in Industrie- und Schwellenländern (Langthaler 2015).
Handelsströme von Sojaprodukten 2011
Die De- und Reregulierung im WTO-Regime spaltete den globalen Nahrungsmittelmarkt in ein Quantitäts- und ein Qualitätssegment: Das niedrigpreisige Quantitätssegment herrscht in den südlichen Schwellenländern und den östlichen Transformationsländern, aber auch unter einkommensschwachen Käuferschichten in westlichen Industrieländern vor. Es umfasst vor allem gentechnisch veränderte, agroindustriell verarbeitete und transkontinental gehandelte Waren von Supermärkten und fast-food-Ketten (food from nowhere; Campbell 2009). Das hochpreisige Qualitätssegment, das in den Industrieländern des Nordens eine wichtige Nische im Einzelhandel bildet, umfasst verschiedene Angebote: einerseits tropische Fisch-, Obst- und Gemüseprodukte, die saisonunabhängig über transnationale Vertriebswege in den Einzelhandel gelangen; andererseits saisonale, regionale und Bioprodukte für kaufkräftige und reflektierte KonsumentInnen (food from somewhere; Campbell 2009). Die marktmächtigen Supermärkte machen sich diese Zweiteilung zunutze, indem ihr Angebot beide Segmente zugleich bedient und derart die Kaufkraft der KonsumentInnen – vom exzessiven Fleischkonsum zum differenzierten Speisezettel – umfassender ausschöpft (Weis 2013).
Doch die lohnabhängigen KonsumentInnen von Handelswaren sind weniger zahlreich als die (klein)bäuerlichen, hungergefährdeten NahrungsproduzentInnen, denen das WTO-zentrierte Nahrungsregime die Lebensgrundlage zu rauben droht (siehe Kapitel 7; McMichael 2013, 47 ff.). Derartige Widersprüche, angeheizt durch die Welternährungskrisen von 2007/08 und 2010/11 (Rosin et al. 2012), treten zunehmend in das öffentliche Bewusstsein – etwa in der globalisierungskritischen Bewegung La Via Campesina (van der Ploeg 2008), die der neoliberalen Auffassung von Ernährungssicherheit die → Ernährungssouveränität als Menschenrecht entgegenhält (siehe Abb. 2.3; McMichael 2013, 57).
Abb. 2.3: Übersicht zum WTO-zentrierten Nahrungsregime (eigene Darstellung)
2.7 Es gibt Alternativen
Der Weg von Landwirtschaft und Ernährung im Globalisierungszeitalter folgte keiner zielgerichteten „Modernisierung“ von einem Anfangs- zu einem Endzustand. Vielmehr führte er, mehrmals die Richtung wechselnd, durch unterschiedliche Nahrungsregime: das erste, UK-zentrierte, das zweite, US-zentrierte und das dritte, WTO-zentrierte. Entgegen dem neoliberalen TINA-Prinzip (there is no alternative) ist das gegenwärtig herrschende Nahrungsregime nicht alternativlos. Die neoliberale Strategie, die etwa die WTO vertritt, fordert entsprechend einer produktivistischen Logik den Ausbau des agroindustriellen Modells mittels wissenschaftlich-technischen Fortschritts (z. B. → Gentechnik). Dazu gibt es mehrere Alternativen: Die reformistische Strategie, die etwa viele Aktivitäten der FAO anleitet, sucht die Auswüchse des neoliberalen Regimes mittels Nahrungshilfsprogrammen und der Förderung nachhaltiger Landbewirtschaftung einzudämmen, ohne jedoch die Machtverhältnisse grundsätzlich umzuwälzen. Die progressive Strategie, der → alternative Lebensmittelnetzwerke (z. B. Fair Trade) folgen, sucht innerhalb des herrschenden Regimes Nischen eines gerechten und nachhaltigen Umgangs mit Nahrung auszubauen. Die radikale Strategie, die etwa La Via Campesina vertritt, zielt auf die Aushebelung agroindustrieller Geschäfts- und industriestaatlicher Machtinteressen mittels durchgreifender Ressourcenumverteilung und Demokratisierung. Diese alternativen Strategien unterscheiden sich nicht nur nach Nähe zum und Distanz vom WTO-zentrierten Nahrungsregime, sondern auch im Hinblick auf globale, nationale oder subnationale Denk- und Handlungsansätze (Young 2012, 342 ff.). Eine – wenn nicht die – Existenzfrage der gegenwärtigen Weltgesellschaft und ihrer Umwelt lautet, ob das neoliberale Regime mit seinen sozialen und ökologischen Folgekosten aus der aktuellen Krise gestärkt hervorgeht oder durch ein anderes, etwa der Ernährungssouveränität verpflichtetes Regime abgelöst wird. Darum geht es im Schlusskapitel dieses Buches (siehe Kapitel 9).
Kontrollfragen
Worin besteht das Problem einer modernisierungstheoretischen Sicht der Geschichte und welche Lösung bietet sich dafür an?
Welche Weltregionen sind HauptproduzentInnen und -konsumentInnen der global gehandelten Nahrungsmittelmengen in den drei Nahrungsregimen?
Welche (handels- und währungs-)politischen Institutionen regeln die Produktflüsse in den drei Nahrungsregimen?
Wer sind die treibenden Akteure in den drei Nahrungsregimen?
Aufgrund welcher Widersprüche sind Gegenbewegungen zu den drei Nahrungsregimen entstanden?
Diskussionsfragen
Wer sind GewinnerInnen und VerliererInnen in den drei Nahrungsregimen?
Inwieweit lag bzw. liegt es in der Macht der KonsumentInnen, ein herrschendes Nahrungsregime zu verändern?
Welche Formen von Nahrungsregimen erscheinen aus Sicht unterschiedlicher Akteure (ProduzentInnen im Globalen Norden bzw. Süden, transnationaler Handels- und Verarbeitungsunternehmen, KonsumentInnen im Globalen Norden bzw. Süden usw.) für die Zukunft als wünschenswert?