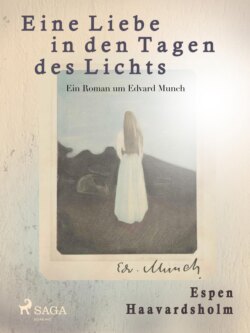Читать книгу Eine Liebe in den Tagen des Lichts - Roman um Edvard Munch - Espen Haavardsholm - Страница 3
1
ОглавлениеDreiundzwanzigster Januar, Morgendämmerung.
Wie sonderbar, dass noch immer Leben in ihm ist. Ganz oben im Hals hat sich der Katarrh festgesetzt, er hat Fieber- und Hustenanfälle, zu allem Überfluss noch eine Bronchitis.
Wie jeden Winter.
Nur schlimmer! Jahr für Jahr wird es schlimmer!
Mit einer hastigen Bewegung zieht Herr M. die Jalousien hoch. Er kneift die Augen zusammen und blinzelt benommen auf einen schmalen Streifen Gelb und Zinnoberrot, der zwischen den mit Raureif überzogenen Baumkronen zum Vorschein kommt.
Finster und erbärmlich. So sieht es in ihm aus.
Er zieht Pantoffeln an und wirft sich Ulster, Schal und Morgenrock über den Schlafanzug. Während er ein paar alte Zeitungen zusammensucht, um damit Feuer zu machen, fällt sein Blick auf eine Bekanntmachung, die besagt, dass allen norwegischen Juden jetzt ein »J« in den Pass gestempelt wird.
»Pah!«
Er verzieht das Gesicht, reißt die Zeitungsseiten entzwei und knüllt sie zusammen. Dann stopft er das Papier in den rußigen Ofenschlund und legt Späne und Kleinholz dazu. Schließlich hält er ein Streichholz an das Ganze.
»Na, also!«
Schon lange klingt seine Stimme nur wie ein krächzendes Flüstern. Sobald die Flammen aufzüngeln, stellt er das Ofenventil ein und lässt die Luft durch einen schmalen Spalt an der Aschenschublade eindringen. Die Geräusche aus der Küche verraten ihm, dass seine Haushälterin da draußen schon eingeheizt hat, hier drinnen jedoch kümmert er sich um so etwas lieber selbst.
Dies hier ist seine Seite des Hauses. Die Haushälterin soll ihm nicht zu nahe kommen.
Nicht jeder Raum, in dem es Bilder gibt, bedarf des Ofenfeuers – hier unten allerdings, wo seine Utensilien sind, will er es etwas behaglicher haben. Denn die elektrische Heizung allein kann gegen die Eiseskälte nicht genügend ausrichten. Diese Arbeitszimmer sind sein Zuhause, hier hängen all seine Bilder und auch Briefe an den Wänden. Graphische Blätter, Skizzen und unfertige Entwürfe liegen über den Fußboden verstreut – hier laufen alle Fäden zusammen.
Der gebrechliche Hausherr von Ekely erhebt sich mühsam von den Knien und blickt umher, bevor er mit schleppenden Schritten den Nebenraum betritt, um auch dort den Ofen anzuheizen. Es knackt in seinem dünnen Leib.
»Scheiße!«
So lange hatte er in Deutschland gewohnt, dass Deutsch zu seiner zweiten Muttersprache wurde. Wochen und Monate sind vergangen, seit er zuletzt der eigenen Stimme trauen konnte.
Der Krieg verbreitet sich von Ozean zu Ozean, von Kontinent zu Kontinent. Bald gibt es wohl keinen Fleck mehr auf Erden, der unberührt ist. Allenfalls in Landstrichen, die sich den Fängen der Zivilisation bisher entzogen haben, bei den Polynesiern in Tahiti, zum Beispiel; oder den wilden Indianerstämmen irgendwo am Amazonas.
Doch andererseits – wer weiß? Vielleicht wird die Blutspur aus dem Schlachthof des Zweiten Weltkriegs sogar bis zu solch entlegenen Orten führen?
Womöglich endet alles mit diesem Krieg.
Denn zweifelsohne gibt es Umstände, die darauf hinweisen, dass es sich um die alles verschlingende Apokalypse handeln könnte – die Endzeitkatastrophe, die sein alternder Vater den Kindern in dunklen Stunden ausmalte.
Gleichwohl gilt es, die düsteren Gedanken im Zaum zu halten.
Sein Freund, Doktor Schreiner, gemahnt ihn ständig daran. Der Anatom! Der Pathologe! Der Totendoktor! Sein Hausarzt, den der alte Maler vor einer geöffneten Leiche im Obduktionssaal porträtiert hat und zu dem er ein gewisses Vertrauen hegt.
Sobald Herr M. die Öfen versorgt hat, geht er ein Stück an der Wand entlang, mit geschlossenen Augen. Ein kleiner Trick, den er manchmal anwendet – zumindest wenn er ein wenig Aufmunterung braucht. Wie ein Blinder bewegt er sich vorwärts, bevor er schließlich stehen bleibt und die Augen öffnet. Er darf nicht mogeln. Das ist ja gerade der Witz an diesen Morgenspaziergängen. ›Marats Tod‹ ist das Bild, vor dem er heute landet. Er blickt auf und nickt.
»Guten Morgen, Herr Graf«, sagt er.
Allein die Bronchitis in seinem Hals antwortet mit einem Pfeifen.
»Guten Tag, Frau Gräfin«, murmelt er dann, ein wenig verlegen, und sieht sie direkt an.
Verblüffend offenherzig erwidert sie seinen Blick. Doch auch von ihr erhält er keine Antwort. Das hätte er auch nicht erwartet – natürlich nicht.
Ein passendes Bild, um den Tag zu beginnen, wie er gleich merkt. Denn die Schwermut lichtet sich ein wenig, wenn er an die Unterhaltung zurückdenkt, die er – auf stockendem, aber halbwegs brauchbarem Deutsch – vor einer Ewigkeit dort unten in Berlin mit seinen Modellen, dem Ehepaar mit dem adelig klingenden Nachnamen Grävenitz führte.
Ob sie sich vielleicht vorstellen könnten, ihm für ein bestimmtes historisches Motiv Modell zu stehen?
»Aber natürlich!«
Jung waren sie zu jener Zeit – und schienen auch den starken Wunsch zu hegen, sich ein Bild zu kaufen.
Er erklärte seine Idee. Der hochwohlgeborene Herr Grävenitz war gleich bereit, die Rolle des erstochenen Marat zu spielen, zögerte jedoch, als der Maler die Notwendigkeit erklärte, dass sie beide – er und seine Frau – in einer möglichst natürlichen Situation posieren müssten, was bedeuten würde, dass …
Die beiden blickten einander an. Fast unmerklich nickte sie. Er tat dasselbe und fragte dann:
»Wann?«
»Morgen früh um zehn?«
Die Eheleute sahen sich wieder an und nickten.
Im Grunde hatte er damit gerechnet, dass das junge Patrizierpaar Bedenken haben und nicht auftauchen würde. Doch das taten sie, genau wie vereinbart. Verlegen rief er:
»Ich habe das Gefühl, dass es nicht richtig ist, Sie um so etwas zu bitten.«
»Unsinn.«
»Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu arbeiten, aber Sie sind einverstanden, wenn es etwas Zeit in Anspruch nimmt?«
»Natürlich sind wir einverstanden.«
»Gut, dann …«
»Ja?«
»Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber dort drüben steht ein Wandschirm, wenn die Herrschaften tatsächlich …«
Sogleich verschwanden sie hinter dem Wandschirm und machten sich bereit. Etwas Freimütiges und Robustes strahlten sie aus. Er hatte schon altgediente Berufsmodelle gesehen, die in solchen Augenblicken viel befangener waren als diese beiden.
Er – der Skandalmaler aus Kristiania im hohen Norden – hatte die vornehme Frau Grävenitz überreden können, sich völlig schutz- und hüllenlos in der Rolle der Mörderin Charlotte Corday zu zeigen! Stundenlang hatte sie so dastehen müssen, mit ihrem langen, rotblonden Haar und den geröteten Wangen. Ihr distinguierter Mann hatte nicht nur das akzeptiert, sondern war sogar einverstanden, dass er selbst, im Bett liegend, die Rolle des nackten, verratenen und ermordeten französischen Revolutionshelden übernahm! Von all den erstaunlichen Erlebnissen, die er mit Modellen hatte, kommt ihm jenes an diesem eiskalten Januarmorgen auf Ekely besonders denkwürdig vor.
Ein ungewöhnliches Ehepaar. Aber hochwohlgeboren! Und so kunstinteressiert!
Er, der Skandalmaler, war damals jung und stark gewesen. So viele Einfälle waren ihm gekommen. Doch das war vor dem Nervenzusammenbruch gewesen, vor den alkoholfreien Malereien, den nikotinfreien Zigarren und den giftfreien Damen – bevor er es vorgezogen hatte, sich hinter dem hohen Bretterzaun hier in der Villa zu verstecken.
Vor Urzeiten also. Viele seiner stärksten Bilder wurden vor Urzeiten geschaffen. Manchmal denkt er, das Geheimnisvolle seiner Malerexistenz sei in Wahrheit darin zu suchen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen unheilverkündenden Geschehnissen in seinem eigenen Leben und den Dingen, die sich da draußen in der Welt ereignen.
Unerklärlich? Mag sein. Aber ein bildender Künstler muss oft abseits des rein Logischen arbeiten.
Er muss in der Lage sein, die unsichtbaren Fäden zu erahnen, die alles zu einer Einheit verbinden. Dies betrifft nicht nur die entscheidenden Ereignisse in der Gegenwart. Auf einer eher intuitiven Ebene gilt das auch für den Einklang mit den großen Wellenbewegungen des Daseins, den Stoffwechsel der Natur – den rhythmischen Wechsel zwischen Knospe und Blüte, Nuss und Baum, Hochsommer und Frostwinter, dem Fließenden und Kristallinen, Lust und Abscheu, schwimmenden Samenzellen im Dunkel der Gebärmutter und alten, verblichenen Knochen.
All das hat er in seinen Bildern zu schildern versucht.
Sein persönliches Schicksal allerdings hat ihn niemals an einer dieser Wellenbewegungen des Daseins teilhaben lassen – er ist der letzte Ast an einem einstmals starken und üppigen, doch immer wurmstichiger gewordenen Stammbaum; eine mächtige Eiche, die ihre Fruchtbarkeit eingebüßt hat.
Mit einundzwanzig, als er mit seinem Vater und seinen Schwestern in Åsgårdstrand Ferien machte, erlebte er seinen ersten verliebten Sommer.
Sie allerdings war verheiratet und hatte nicht die Absicht, ihren Ehemann zu verlassen. Für sie war er – der keusche junge Maler – nicht mehr als ein romantisches Abenteuer, ein lustiger kleiner Zeitvertreib, der im Spätherbst ein Ende fand. Nach dieser Erfahrung glaubte er, sich nie wieder erholen zu können. Er fühlte sich gelähmt, verletzt bis ins Mark. Doch das Ganze führte zu einer Abhärtung.
»Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker!«, lautete der Rat, mit dem ihn sein Freund aufzumuntern pflegte.
Der mutterlose Sohn des Armenarztes entschied sich nach der Affaire mit Frau Thaulow, nie wieder etwas mit Frauen anzufangen. Doch dies erwies sich als zeitlich begrenzter Entschluss – denn später im Leben war er von so vielen besessen.
Im Augenblick der Ekstase nutzte er seine Beobachtungsgabe und nannte das Bild ›Madonna‹. Eine Idee, die ihm schon auf der Studienreise nach Frankreich gekommen war – ein Bild zu erschaffen, das die Menschen zwingt, das Geheiligte in dieser Art von Hingabe zu erkennen, und davor den Hut zu ziehen, wie in der Kirche.
Nach der Verlobung mit der Weinhändlertochter Tulla, die mit dem Revolverschuss in Åsgårdstrand endete, hatte er in Paris ein aufreibendes Liebesverhältnis mit der dunkelhaarigen Geigerin Eva – und verlor schließlich, nach weiteren Jahren des Nomadentums, den Boden unter den Füßen und landete in Doktor Jacobsons Privatklinik in Kopenhagen.
Das Ende seiner Jugend war gekommen. Später im Leben wurde vieles so anders. Ekely wurde zu einer Art sicherem Hafen. Ein Zufluchtsort. Ein mit Bildern geschmücktes Gefängnis.
Unter den Modellen an den Wänden von Ekely finden sich die blutjunge Ingeborg, das reife Fräulein Helga, die schlagfertige Frøydis, das geschmeidige Kätzchen Annie, das Tag und Nacht bei ihm war, die strenge Hildur, die gotisch edle Birgitta und die scheue Hanna mit dem klangvollen Akzent aus dem Norden. Alle unterschieden sich voneinander – einige waren für ihn mehr als nur Modelle, doch mit allen hat er in der Phantasie Hochzeit gefeiert.
Ist das so ungewöhnlich?
Ein Heiliger ist er nie gewesen. Zwar hat ihn das Schicksal zu einem Leben in Einsamkeit verurteilt; aber er darf doch wohl Gefühle haben?
All diese jungen Frauen haben ihn auf ihre Weise berührt. Ein paar von ihnen drohten förmlich, Macht über ihn zu gewinnen – auch wenn er alles versuchte, dies nicht zuzugeben.
Früh hat er gelernt, eine Maske zu tragen. Eine seiner speziellen Fähigkeiten. Unwillkommene auf Abstand zu halten und niemanden erkennen zu lassen, was wirklich geschieht. Hier hängen sie jedenfalls in Rahmen, bekleidet oder unbekleidet, eine nach der anderen. Er hat seine Modelle so gemalt, wie er sie erlebt hat, und noch immer leuchten sie ihm mit ihrer jugendlichen Vitalität entgegen. Nie ist er es müde geworden, sie um sich zu haben.
Doch jedes Mal, wenn aus dem Spiel Ernst zu werden drohte, zog er sich rechtzeitig wieder zurück. Jedes Mal, wenn er Gefahr lief, völlig den Kopf zu verlieren – und er verliebte sich in einige von ihnen, es wäre töricht, dies zu leugnen – überkam ihn wieder die Erinnerung an den Pakt, den die hinterbliebenen Geschwister eingegangen waren, nachdem ihr Bruder, der Arzt, an einer Lungenentzündung starb, nur wenige Monate, bevor sein Kind geboren wurde. Eine geheime Abmachung. Seitdem haben sich alle drei an den Pakt gehalten, sowohl seine Schwestern als auch er selbst.
Jäh kommt ihm die Frist für die Steuererklärung in den Sinn.
Einunddreißigster Januar! Nur noch acht Tage!
Er muss unbedingt ein neues Schreiben aufsetzen, um diesen Dummköpfen im Finanzamt zu erklären, wie ein Künstler eigentlich arbeitet – zumindest muss er bald einen Brief schreiben, in dem er, aus gesundheitlichen Gründen, um eine Fristverlängerung für die Abgabe bittet!
Vor lauter Angst angesichts der Maßnahmen, mit denen die Behörden ihn dieses Mal womöglich schikanieren könnten, läuft ihm sogleich der Schweiß über den Rücken – bis ihm plötzlich aufgeht, dass er das Ganze in den letzten Jahren ja seinem neuen Anwalt überlassen hat, diesem gesegneten Stockfisch von einem Juristen, dem nun alles an Steuerirrsinn, Zahlen und Rechenschaftsunterlagen zugeschickt wird. Der alte Meister schreibt einen Zettel, den er mit einer Reißzwecke an der Tafel über dem Telefon befestigt: »Aker/Borre/Vestby. Fristverlängerung!!!«
Erneut bleibt er vor ›Marats Tod‹ stehen. In seinem Hals beginnt es zu kratzen. Er bekommt einen Hustenanfall.
»Herr M.?«
Im ersten Augenblick verschlägt es dem Alten die Sprache – ist das etwa so zu verstehen, dass die junge Frau Grävenitz jetzt anfängt, mit ihm zu reden?
Doch diese Einbildung währt nur ganz kurz, dann erkennt er die Stimme von Fräulein Berg und schüttelt beschämt den Kopf über seine idiotischen Altmännerphantasien. M. geht zur Küchentür und öffnet sie vorsichtig einen Spalt.
»Sind Sie schon auf, Herr Kunstmaler?«
»Ich habe nur Feuer gemacht.«
»Können Sie wieder sprechen?«
»Es geht so.«
»Der Arzt hat gesagt …«
»Ja, ich weiß, was der Arzt gesagt hat.«
»Ich habe Ihre Morgenzeitung.«
»Vielen Dank, Fräulein Berg.«
Liv Berg, mit ihr hat er sich jedenfalls keine Hochzeit vorgestellt! Und ebenso wenig hat er sie gebeten, Modell zu stehen.
Nein, da malt er sich lieber selbst. Der Spiegel ist ein Ausweg, dessen er sich in unregelmäßigen Abständen bedient, falls es ihm an Motiven mangelt. Wie viele Bilder dieser Art hat er wohl im Laufe des Jahres gemalt? Vierzig? Oder vielleicht fünfzig?
Viele wurden verworfen, natürlich. Herr M. hält sich nicht für einen ichbezogenen Mann – zumindest nicht mehr, als es in seinem Metier erforderlich ist –, aber in fast keinem Jahr hat er versäumt, seine Selbstporträts zu malen. Das aus der Hölle beruht vielleicht am ehesten auf persönlichen Erfahrungen. Im Schein der glühenden Flammen steht er da mit nacktem Oberkörper.
Auf einem Bild, das hier auf Ekely entstanden ist, hat er sich selbst als einsamen und schlaflosen Wanderer gemalt, übermüdet, rastlos, mit dunklen Augen und gebeugtem Nacken, halbwegs an den Betrachter gewandt – mit einem Ausdruck, als habe er eben am Fenster ein Gespenst gesehen. Das war kurz vor Kriegsausbruch. ›Der Nachtwanderer‹, hat er das Porträt genannt. Auf einem anderen Bild hat er sich selbst als alten Mann in einsamem Rausch gemalt, umgeben von einem Meer aus Flaschen.
Danach hat er die Flaschen weggeräumt. Bekommt er Besuch, kann er immer etwas anbieten, doch für gewöhnlich gibt es nicht viel. Nein, nur selten trinkt er mehr als zwei Gläser, solange es sich nicht um einen besonderen Anlass handelt. Er hat genügend Künstler gesehen, die zielbewusst ihre Seele, ihre Leber, ihre Fähigkeit zu lieben zerstört haben, oder was sich sonst noch zertrümmern lässt. Er misstraut Menschen, die es darauf abgesehen haben, sich selbst zu vernichten. Es erscheint ihm wie eine Verhöhnung ihrer eigenen Mütter, die so viele Lebensjahre geopfert haben, um sie großzuziehen. Indirekt werden wir alle dadurch verhöhnt.
Herr M. hält sich in dieser Hinsicht für urteilsfähig, denn zehn Jahre lang erlebte er selbst diese Verwüstung.
Er ist zwar kein junger Mann mehr, aber noch immer lodert tief in seinem Innern das Leben, wenn auch nur wie halberloschene Glut. In all den Jahren fühlte er sich bei seiner Arbeit allein dadurch stimuliert, etwas Konkretes sehen zu können – vielleicht am liebsten, wenn er es direkt vor Augen hatte, sei es nun ein flacher Kieselstrand am Fjord, ein aufgescheuchtes Pferd, ein Paar unter einem Apfelbaum oder ein unbekleideter Mensch.
Seitdem er es sich leisten konnte, hat er sich an Modelle gehalten; unregelmäßige Besucherinnen oder manchmal auch Hausgenossinnen. Unleugbar haben diese jungen Frauen ihm geholfen, das Leben besser auszuhalten.
Doch Hanna aus Senja ist jetzt in Troms – hier auf Ekely malte er Hanna in ihrem Luchspelz unter dem blühenden Kastanienbaum, und in Åsgårdstrand ließ er sie Fausts Gretchen spielen –, zurückgekehrt in die nördliche Heimat, um dort zu heiraten, nachdem sie fast ein ganzes Jahrzehnt für ihn gearbeitet hat.
Natürlich ist es schon früher passiert, dass eine junge Frau auf diese Weise aus seinem Leben verschwand – weil ein anderer Mann, entschlossener als Herr M., in ihr Dasein trat.
Aber bis ganz hinauf nach Nordnorwegen?
War es wirklich nötig, so weit fortzugehen?
In Wirklichkeit ist das wohl ein Zeichen. Alles ist vorbei, soll es bedeuten. Die Arbeit ist beendet, und das Leben verebbt, mit jedem Winter etwas mehr.
Nein, es gibt nur noch wenig Anzeichen von Vitalität in ihm. In Wirklichkeit ist es wohl nur sein alter Freund Gottfried Tod, der jetzt noch auf ihn wartet und zwischen den Fledermäusen im Ulmenwald herumspioniert, stets bereit, Schluss zu machen, sobald er sich auch nur einen winzigen Fehltritt leistet – und ihn in Stücke zu reißen und den Würmern und Maden zum Fraß vorzuwerfen, bis nur noch abgenagte Knochen übrig sind.
Schon immer ist Gevatter Tod dort irgendwo in der Dämmerung bei ihm gewesen, wie ein treuer, aber unsichtbarer Gefährte. Jahr für Jahr. Jahrzehnt für Jahrzehnt. Wie seltsam, dass er diesen Gottfried mit dem unsichtbaren roten Umhang so lange überlisten konnte. Ein so argloser Mann wie er!
Etwas muss es dennoch gegeben haben – eine innere Zähigkeit –, die ihn zu einem Überlebenden machte.
Er wirft einen Blick auf den eisernen Ofen. Schon immer wusste er das brüllende Geräusch der Flammen in einem Holzofen zu schätzen. Etwas Anheimelndes und Tröstendes geht davon aus, ein Geräusch, das ihn an die Wohnung unten in der Quadratur hinter der Festung Akershus erinnert, als seine Mutter noch lebte.
So viele Jahre sind seitdem vergangen. Und dennoch passiert es, dass er sie vor sich sieht, so, als lebte sie noch – jede kleine Falte um ihren Mund, jede Nuance der Stimme, jeden noch so kleinen Rest des Akzentes von Krakerøy, der dann und wann hervorbrach, jede Strafpredigt, jedes Lächeln, jedes ernste Wort und jeden Blick. Und auch das straff zurückgekämmte Haar über dem marmorweißen Gesicht, als ihr der Atem ausging, ist schwer zu vergessen.
Dass nun ausgerechnet er zu so einem uralten Mann werden sollte! Wer hätte das damals gedacht? Er nicht, und auch nicht die anderen. Wäre das Schicksal gerecht gewesen, dann hätte er damals in Kristiania von Herrn Gottfried Tod geholt werden müssen – und nicht sie, seine Schwester.
Wurde Sofie in Wirklichkeit an seiner statt geholt?
Das ist ein Verdacht, von dem er sich nie so ganz befreien konnte. Im Alter von zwölf Jahren verlor er seinen Platz in der Domschule, weil er wegen seiner schwachen Lunge so häufig dem Unterricht ferngeblieben war. Zu Weihnachten, als er dreizehn und sie vierzehn war, lag er mit Fieber im Bett und starrte auf die Lichter des geschmückten Baums. Verschwitzt und unruhig wandte er sich flüsternd an seinen Vater:
»Papa?«
»Ja.«
»Was ich da ausspucke, ist so dunkel.«
»Wirklich, mein Junge?«
Sein Vater arbeitete als Truppenarzt und Armenarzt. Die biblische Denkweise nahm er ernst und brachte es oftmals nicht übers Herz, seinen Patienten Geld abzuverlangen. Im Laufe der Jahre zogen sie innerhalb der Stadt von einem Ort an den anderen, erst von der Nedre Slottsgate in die Pilestredet, dann von der Thorvald Meyers gate in den Fossveien – insgesamt acht verschiedene Wohnungen.
Sein lieber Vater mit den grauen Locken holte eine Kerze, nahm das Taschentuch, knüllte es zusammen und verbarg es vor ihm. Beim nächsten Mal spie der Dreizehnjährige aufs Laken, um nachzuprüfen, was der Vater ihn nicht sehen lassen wollte.
»Es ist Blut, Papa.«
Sein Vater strich ihm übers Haar.
»Hab keine Angst, mein Junge.«
Es verging eine Weile. Vielleicht war er für einen Augenblick eingedöst. Er erwachte, als sein Vater die Hand auf seinen Kopf legte und sagte:
»Ich will dich segnen, mein Junge.«
Inmitten des Fiebers dämmerte ihm, dass wohl auch er die Schwindsucht hatte, genau wie seine Mutter. Von jetzt an würde vielleicht nur noch ein mageres Schattenleben auf ihn warten. Wieder schlief er für ein paar Minuten ein. Doch dann war sein Vater wieder da, strich ihm übers Haar und sagte:
Der Herr segne dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir.
Der Herr gebe dir Frieden.
Im Laufe des Abends wurde das Fieber schlimmer. Ein weiterer Arzt wurde herbeigerufen. Er horchte die Brust des Patienten ab und verordnete Eis, um ihn abzukühlen. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte, spürte er, wie es jedes Mal beim Luftholen in seiner Lunge rumorte. Ein neuer Hustenanfall füllte das ganze weiße Taschentuch mit Blut, wie ein rotes Banner. Zu Tode erschrocken jammerte er:
»Jesus hilf mir, ich sterbe – ich kann doch jetzt nicht sterben.«
»Du darfst nicht so laut reden, mein Junge. Das ist nicht gut für dich«, erwiderte sein Vater.
Seine ein Jahr ältere Schwester Sofie legte sich neben ihn auf das Bett. Sie weinte und betete. Die anderen versammelten sich um das Krankenlager, ihre Gesichter waren bleich und ernst. Von der Jacobskirche ertönten die Glocken, im Nebenzimmer stand der funkelnde Weihnachtsbaum. In Lappen eingewickelte Eisklumpen lagen auf der Brust des Jungen. Er schaute seinen Vater an und verspürte eine Art Scham für das, was er sagen wollte, wagte aber nicht zu schweigen. Mit gesenktem Blick stellte er die Frage, die an ihm nagte, die banale freimütige Frage, wo er, nach Ansicht seines Vaters, landen würde, falls er diesen Winter nicht überleben sollte – ob der Vater wirklich glaubte, dass er in den Himmel käme?
»Das wirst du bestimmt, mein Junge – solange dein Glaube unerschütterlich ist. Mein lieber Sohn, glaubst du an Gottvater, Gottes Sohn und den Heiligen Geist?«
»Ja, Vater«, erwiderte er mit matter Stimme, obgleich er keineswegs wusste, ob dies die richtige Antwort war. Es gab Dinge in der Bibel, die einfach nicht stimmen konnten.
Jäh durchfuhr ihn ein Schrecken. Er sollte vor den Richtertisch des Herrn gestellt werden und wusste doch, dass Zweifler verurteilt waren, für immer und ewig in der Hölle zu brennen. Draußen auf der Straße fing ein Hund an zu heulen. In der Küche hörte er eine Frauenstimme fragen:
»Wie geht es dem Jungen?«
Die Antwort verstand er nicht. Doch dann hörte er die Frauenstimme sagen:
»Mein Sohn ist auch krank. Einen von beiden holt wohl der Tod, und deshalb heult der Hund.«
Etwas später erwachte er aus dem Halbschlaf und sah seinen Doktorpapa mit gefalteten Händen neben dem Bett knien.
»Herr, ich bitte Dich – ich fordere von Dir – lass ihn heute nicht sterben – er ist noch nicht bereit – ich bitte Dich, hab Erbarmen mit uns, lass ihn leben – er wird Dir immer dienen, das hat er mir versprochen.«
Inmitten des Fieberwahns sah der Junge, wie weiß die krampfartig gefalteten Hände des Vaters waren.
»Ich flehe Dich an, Herr, ich fordere es von Dir – in Namen von Jesu Christi Blut, mach ihn wieder gesund.«
Ein paar Jahre später schrieb er das alles auf, deswegen erinnert er sich so gut daran – er weiß noch jedes einzelne Wort, das an jenem Dezembertag in Grünerløkken gesagt wurde.
Aber niemand wurde an diesem Weihnachtsfest geholt. Nicht der andere Junge. Nicht er. In seiner Erinnerung ist es das Weihnachtsfest mit dem blutroten Banner. In seiner Erinnerung ist es das Weihnachtsfest, an dem er befürchtet hatte, womöglich für immer und ewig in der Hölle zu brennen – aber es ist auch der Winter, in dem er den Entschluss fasste, überleben zu wollen.
Von der Thorvald Meyers gate zogen sie in ein Mietshaus, in dem es weniger zugig sein sollte. Doch im November desselben Jahres gelang es dem teuflischen Herrn Tod dennoch, die Treppen dieses im Osten der Stadt gelegenen Hauses hinaufzuschleichen, um seine ältere Schwester zu holen.
Welche Art von Gerechtigkeit konnte hierin gelegen haben – dass seine Schwester so früh auf dem Friedhof landete, und nicht er?
Tage und Nächte rätselte er während seiner Jugend darüber. Und noch immer kann es passieren, dass er sich diese Frage stellt.
Ihre Knochen kann er vor sich sehen, dort unten im Grab.
Wie mager sie zum Schluss wurde! So stumm und scheu und fast durchsichtig dünn!
In seinen Kindertagen gab es nur zwei Menschen, denen er sich tief verbunden fühlte, die dunkelhaarige Mutter und die rothaarige ältere Schwester. Nachdem seine Mutter der rachsüchtigen Tuberkulose erlegen war, wurde sie, seine ältere Schwester, zur großen Liebe seines Lebens. Eine ganz besondere Nähe entstand zwischen ihnen.
Als seine Mutter starb, waren die anderen Geschwister noch so klein, dass sie sich kaum an sie erinnerten. Sofie und er waren diejenigen, die die Mutter wirklich gekannt hatten und Geschichten über sie erzählen konnten – wie lieb sie zu ihnen gewesen war, wie kurzatmig sie damals auf der Treppe in der Nedre Slottsgate geworden war, und wie sie in der Pilestredet alle zu sich gerufen und kurzerhand erklärt hatte, was der Arzt gesagt habe, und dass sie sich alle im Himmel wiedertreffen würden, wenn sie nur bereit wären, ein gottesfürchtiges Leben zu führen.
Er war fünf, als die Mutter fortgerissen wurde. Als seine ältere Schwester Sofie ihr nachfolgte, war er dreizehneinhalb. Sein erstes wirklich umstrittenes Bild zeigte die große Schwester mit den roten Haaren; wie sie sich, als sie fürchtete, er müsse sterben, neben ihn auf das Bett legte, stattdessen aber selbst von dem rachsüchtigen Herrn Tod mitgenommen wurde.
Mit dem Pinsel kratzte er an dem Bild von Sofie herum, ritzte Streifen in die Farbe, änderte, entfernte und übermalte – eine Weile kämpfte er mit dem Bild, als handele es sich um einen Feind, nahm alles Überflüssige weg, machte die Details undeutlicher, verstärkte das Kolorit, vereinfachte und konzentrierte den Ausdruck. Für die Arbeit benutzte er ein junges Modell mit langen roten Haaren. In gewisser Weise half ihm dieses Bild, sich mit dem Schicksal seiner Schwester abzufinden. Doch wirklich versöhnen konnte er sich niemals.
»Aufschneider!«, nannte ihn einer der bekanntesten norwegischen Künstler, mit höhnischer Fratze, als der Debütant auf der Herbstausstellung das Bild seiner schwindsüchtigen Schwester zeigte.
War es wirklich Aufschneiderei, die er da betrieb?
Trickste er? Pfuschte er?
Nein, er tat das, was ihm nötig schien, er folgte seinem eigenen Weg. Wie elend, ratlos und dumm du dich auch fühlen magst, wenn du von den anderen verhöhnt wirst; folge deinem eigenen kleinen Trampelpfad in die Wildnis der Selbständigkeit, stehe zu deinen Gefühlen und dem, was du selbst erfahren hast. Das ist der einzige Rat, den er weitergeben kann – das begriff er, nachdem er mit dem Bild seiner sterbenden Schwester die Mauer des öffentlichen Schweigens durchbrochen hatte; und diesem Pfad muss er noch immer folgen.
Jetzt geht sein Leben dem Ende zu; kein Gebet kann das verhindern. Brummend schleppt sich der von Bronchitis Geplagte zurück ins Bett, um wieder etwas Wärme in die Glieder zu bekommen.
»Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.«
Wie ein Schlag in die Magengrube trafen ihn die Worte aus dem protestantischen Begräbnisritual, als er einmal, ein paar Jahre nach seinem Umzug nach Ekely, einer Einäscherung beiwohnte. Seitdem lehnt M. es ab, an Begräbnissen teilzunehmen. Nicht einmal, als seine heißgeliebte Tante starb – die sich der mutterlosen Kinderschar angenommen hatte und all die Jahre anstatt ihrer Schwester für sie dagewesen war –, konnte er es über sich bringen, die Kapelle aufzusuchen.
Einen hübschen Kranz schickte er. Doch von der Trauerfeier hielt er sich fern und beobachtete das Ganze gut versteckt aus der Entfernung.
Nein, er konnte einfach an keinen Begräbnissen mehr teilnehmen. Sie waren ihm zu viel geworden. Er konnte die Predigten im Stil von Pastor Manders nicht ertragen und hasste es, bei den Trauernden zu sein.
Das war zu der Zeit, als er fürchtete, blind zu werden.
Das Sehvermögen des linken, schwächeren Auges war bereits zuvor immer schlechter geworden. Nach einem furchteinflößenden Zahnarztbesuch bekam er einen Bluterguss, der sich wie eine Krebsgeschwulst über die Netzhaut des anderen, guten Auges legte. Da hatte er schon das Ende vor sich gesehen. Wie, um alles in der Welt, sollte er weiterleben, wenn er nichts mehr sehen könnte?
»Verdammte Scheiße!«
Er räuspert sich und hustet Schleim.
Von jedem wichtigen Bildmotiv gibt es zwei Versionen, manchmal sogar acht, neun oder noch mehr – in verschiedenen Techniken. Es gibt ein paar malerische Schlüsselsituationen, zu denen er immer wieder, manchmal im Zeitraum von zehn Jahren, zurückkehrt.
›Marats Tod‹ ist eines dieser Themen, mit denen er nie ganz fertig geworden ist. Beim letzten Mal hat er sich hier auf Ekely daran versucht, mit einem jungen dunkelhaarigen Modell als Charlotte Corday. Doch es glückte ihm nicht recht. Die Mörderin in ›Marats Tod‹ muss rothaarig sein. Sonst scheint das Motiv ein wenig seiner expressiven Kraft einzubüßen.
Da sind die dunkelhaarigen Frauen und die rothaarigen. Es ist wie in Monte Carlo – es gibt die schwarzen Todesmarken und die roten Liebessteine. Schon damals in Südfrankreich dachte er so, während er seine Notizen machte und nach der Strategie suchte, die ihn im filzgrünen Halbdunkel der Spielhalle zum Sieger machen könnte.
Es war ihm nicht gelungen, weder in Monte Carlo noch bei den Frauen.
Er ist ein Mann der Niederlage. Seine besten Bilder handeln davon – Trauer, Tod, Eifersucht, Verzweiflung, Erniedrigung, Irrsinn und Niederlage.
Dreck!
So ist sein Leben gewesen.
Scheiße! Krankheit! Leere! Niederlage!
Allzu lange hat das Leben gedauert.
Und jetzt ist bald endlich alles vorbei.