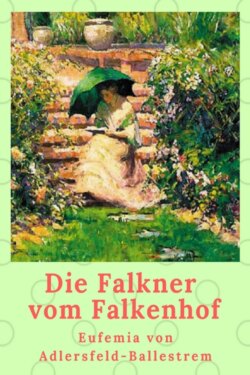Читать книгу Die Falkner vom Falkenhof - Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem - Страница 3
Kapitel 1
ОглавлениеIch sprach zur Taube: „Flieg und bring im Schnabel
Das Kraut mir heim, das Liebesmacht verleiht,
Am Ganges blüht's, im alten Land der Fabel –“
Die Taube sprach: „Es ist zu weit.“
E. Geibel nach Francois Coppée
„Bravo! Bravo! Da Capo!“ Ein wahrhaft frenetischer Applaus rauschte und brauste durch die weiten Räume des Opernhauses zu X. und übertäubte fast die wilden, teuflischen Klänge des Orchesters, das eine seltsame, originelle Weise spielte.
Es war die erste Aufführung der neuen Oper eines unbekannten und ungenannten Komponisten, der fantastischen Oper „Satanella“, deren Text dem Publikum eine jener rätselhaften „Teufelinnen“ der alten Zeiten vor Augen führte, die aus ihrem unterirdischen Reich heraufgekommen war, um durch ihre Schönheit einen „minnigen Sänger“ zu bestricken und in den Tod zu treiben. Vom wütenden Volke aufgegriffen, wird sie als Hexe zum Scheiterhaufen geschleppt und an den Pfahl gebunden. Unter den Klängen eines prachtvollen Chors wird der Holzstoß entzündet, und Rauch und Flammen steigen empor, um die Teufelin zu vertilgen von der Erde. Da plötzlich teilen sich die Flammen, Satanella schüttelt lachend die Fesseln von ihren Händen, das graue Büßer- und Sterbehemd fällt von den Schultern, und sie selbst steht in Höllenpracht gekleidet vor dem entsetzten Volk. In wilden Dithyramben singt sie ihr bestrickendes Zauberlied, und mit dem jauchzenden Schluss: „Lebt wohl, ich kehre zurück zu euch, so lang die Schönheit Siege feiern wird, so lange Männerherzen sich noch betören und betrügen lassen –“, sinkt Satanella hinab in die sie verschlingende Erde.
Diesem Schlusse jauchzte das Publikum zu; es konnte sich nicht satthören an der mächtigen, süßen und metallreichen Stimme der fremden Sängerin, die eigens gekommen war, um die Satanella zu singen; es konnte sich nicht sattsehen an dem wunderbar malerischen Schlussbild mit dem brennenden Scheiterhaufen, den mittelalterlichen Stadtmauern mit ihren Türmen und Erkern, dem entsetzt zusammengedrängten Volke und der Gestalt der Satanella auf dem Holzstoß.
Sie war in der Tat von wunderbarer Schönheit, diese fremde Sängerin, Senora Dolores Falconieros – eine schlanke, geschmeidige Gestalt mit dem leuchtenden Rothaar Tizians, das in üppigen Wellen herabfiel auf das scharlachrote Seidengewand, das sie umschloss. Und in dem blutlosen und doch lebensfrischen Antlitz brannten große, strahlende, samtschwarze Augen, deren Glanz noch gehoben wurde durch die sich über der feinen römischen Nase schließenden dunklen Brauen, durch die langen seidenartigen Wimpern.
Wie sie dort stand auf der Bühne inmitten des rot glühenden Feuers, im roten Gewand und im roten Haar, aus dem ein zweigezacktes Brillantdiadem blitzte und funkelte, mit der wundersam bestrickenden Stimme ihr in seltsamem Rhythmus sich bewegendes Teufelinnenlied singend und dazu ein Flammen sprühendes Zepter schwingend, dessen Feuerregen bis ins Parkett hinab flog, da bot sie ein Bild, das mit begreiflicher dämonischer Macht die herbeigeströmten Hörer zu brausendem Beifall entfachte. Immer wieder musste Satanella aus den Tiefen der Hölle, der Versenkung, heraufsteigen und mit dankendem Lächeln grüßend ihr verkohlendes Zepter schwingen.
Das Schicksal der neuen Oper war entschieden. Der berühmte blonde Tenorist als „minniger Sängerheld“ und die durch den Intendanten entdeckte und sofort berühmt gewordene Fremde hatten der herrlichen Musik den Odem des Lebens eingehaucht und ihr Weihe erteilt, hinauszutönen in alle Welt.
Etwa eine Stunde später hatte sich ein kleiner, aber gewählter Kreis in dem künstlerisch ausgestatteten Salon des Direktors der Akademie der Künste, Professor Balthasar, zusammengefunden. Der Hausherr, ein über die Grenzen Europas hinaus bekannter geistvoller Maler in der Blüte der Jahre, liebte es, nach dem Theater einen kleinen Kreis um sich zu versammeln, in dem er und seine liebenswürdige Gattin aufs Trefflichste für die leibliche und geistige Unterhaltung ihrer Gäste sorgten.
Um den runden Tisch, dessen silbernes Teegerät von Frau Balthasar gewandt und lautlos gehandhabt wurde, saßen etwa sechs Personen mit Einschluss des Hausherrn und der Hausfrau. Da war der hochberühmte geniale Historienmaler Richard Keppler, der feinsinnige Dichter N., die berühmte Schauspielerin Luise R., der Legationsrat Freiherr von Falkner. Ein Platz war noch leer – er harrte eines verspäteten Gastes.
„Mir summt die Melodie des Teufelinnenliedes noch im Kopf – ich kann sie nicht loswerden“, meinte Professor Balthasar.
„Das macht der dämonische Einfluss dieser Musik – es ist ein echtes rechtes Teufelswerk!“, rief die Schauspielerin.
„Ja, aber das Werk eines genialen Teufels“, entgegnete Keppler.
„Das ist das rechte Wort dafür“, sagte der Legationsrat, eine hohe, gebietende Erscheinung mit dunklen Augen, dunklem Haar und gleichem Vollbart, „die ›Satanella‹ ist ein Werk, das aus jedem Takt einen Born von Genialität sprudeln lässt, aber eine Genialität, die ich herzlos nennen möchte, weil sie nicht das Herz, sondern nur den Geist berührt und anregt. Der Komponist ist zweifellos ein Genie, aber er ist nicht von Gottes Gnaden, sondern von Luzifers.“
„Und versteht doch so warme Herzenstöne anzuschlagen“, nahm sich Frau Balthasar des unbekannten Meisters an, „ich erinnere Sie nur an das süße Liebeslied des Troubadours im zweiten Akt.“
„O ja, es schmeichelt sich dem Gehör ein, aber nicht dem Herzen“, erwiderte Falkner kühl, „es bezaubert, aber es ergreift nicht. „
„Nun, dann erkläre ich mich befriedigt durch den Zauber, den das Liebeslied enthält!“, rief Keppler. „Warum sollen wir armen Sterblichen uns nicht einmal bezaubern lassen? Wir können nur vom Glück sagen, wenn unser Herz dabei nicht Schaden leidet. „
„Sie mögen recht haben, Keppler“, erwiderte der Legationsrat ruhig, „die Individualitäten sind ja so verschieden. Für mich ist die Musik keine Musik, wenn sie nur blendet und berauscht. So erkläre ich offen auf die Gefahr hin, für einen Vandalen gehalten zu werden, dass für mich die Mehrzahl der antiken Statuen nichts sind als alte Marmorblöcke, deren blöde Augen uns Epigonen recht dumm anstarren, und dass das schönste Antlitz, aus dem kein Herz spricht, mich entsetzlich gleichgültig lässt. So die Musik der ›Satanella‹. Ich bewundere den elektrischen Strom der Genialität, der durch ihre Takte pulst, aber ich liebe sie nicht, weil nicht ein einziger warmer, menschlicher Herzschlag sie durchzittert.“
Während der Legationsrat sprach, hatte sich einer der Türvorhänge geteilt, und in seinem Faltenrahmen erschien, nur von Frau Balthasar bemerkt, eine dunkle Frauengestalt mit rotem Tizianhaar – Dolores Falconieros. Sie legte lächelnd den Finger auf die Lippen, zum Zeichen, dass sie noch unbemerkt bleiben wolle, und stand noch so, als Professor Balthasar entgegnete: „Nun wohl, aber was der Musik fehlt, gaben die Darsteller ihr.“
„Wie wunderbar schön sang unser Heldentenor den Minnesänger, wie seelenvoll“, rief die Schauspielerin.
„Und wie herrlich war die Falconieros in der Titelrolle“, setzte Keppler hinzu, „es war eine unvergleichliche Leistung.“
„Gewiss, unvergleichlich in der Darstellung der grausamsten Herzlosigkeit“, sagte Falkner spöttisch, „mir war's, als spielte diese Satanella ihr eigenstes Selbst – nicht einen warmen Herzenston vermag diese Fremde anzuschlagen, eben weil sie es nicht kann, weil auch sie nur ganz Genie ist. Ich mag diese herzlosen Frauen nicht.“
„Aber die Falconieros –“, begann der bis dahin nur zuhörende Dichter.
„Die Falconieros, wie ihr Künstlername lautet, könnte die ›Satanella‹ komponiert und gedichtet haben“, vollendete Falkner kurz und kühl.
Frau Marianne Balthasar hatte dem Gespräch mit steigendem Unbehagen zugehört und schob jetzt rasch das Teegerät zur Seite.
„Ah – die Senora!“, rief sie, die peinliche Szene beendend und auf die noch im Türrahmen stehende Sängerin zuschreitend. Die Übrigen erhoben und verbeugten sich, als ihre Namen vorstellend genannt wurden, und Donna Dolores nahm auf dem leeren Sessel zwischen dem Professor und Keppler Platz – Falkner saß ihr gegenüber.
„Vor allem Verzeihung, dass ich so spät komme“, sagte sie mit einem reizenden Lächeln, das ihre prachtvollen Züge noch verschönte, „aber ich musste ja erst die Garderobe wechseln –“
„Die Satanella aus- und das Gewand gewöhnlicher Sterblicher anziehen“, scherzte der Professor.
„Als ob ich diese Satansfarbe je ablegen könnte!“, erwiderte sie und strich mit der schlanken weißen Hand über ihr jetzt hoch aufgestecktes Haar. Dabei irrte ihr Blick über den Tisch und traf den des Legationsrates.
„Wie Sie nur so reden können, Senora“, sagte Keppler und betrachtete die Sängerin mit entzücktem Künstlerblick, „oder sollten Sie in der Tat nicht wissen, welch kostbaren Schmuck Sie auf dem Haupte tragen?“
„Mein Haar“, lachte sie. „Ach, das ist eine Künstlerlaune. Gewöhnliche Sterbliche nennen es rot. „
„Ich wusste nicht, dass auch in Spanien unser germanisches Blond üblich ist“, bemerkte Frau Balthasar.
„Oh, ich bin ja zur Hälfte eine Deutsche“, erwiderte Donna Dolores mit ihrem reinen, aber doch fremdartigen Dialekt, „und ich betrachte Deutschland als meine Heimat, wenn auch die Sonne hier weniger sengend strahlt als in Brasilien.“
„O ja, bedeutend kälter“, sagte Professor Balthasar fröstelnd. „Wir Nordländer sind ein eigenes Volk – uns ist nur wohl, wenn uns das Eis bis ans Herz steigt. Das südliche Feuer, das andere durchglüht, stößt uns ab, wenn es uns berührt.“
„Ja, wenn es Gift und Dolch, Vendetta und Lava sprüht“, warf Falkner ein.
Wieder traf ihn ein Blick aus den dunklen Augen der Sängerin, und wieder musste er sich widerstrebend eingestehen, dass diese Augen außerhalb der Bühne einen ganz anderen Ausdruck hatten, einen freien, stolzen und dennoch weichen Ausdruck.
Die Teestunde war beendet, und der kleine Kreis erhob sich, um entweder an die bücherbeladenen Tische zu treten oder eine jener Mappen zu durchblättern, die in großen Gestellen an der Wand standen und kostbare Skizzen und Stiche enthielten.
Donna Dolores setzte sich in einen Sessel und blätterte in einer dieser Mappen, indem sie lächelnd auf Keppler hörte, der sie um den Vorzug bat, sie als Satanella malen zu dürfen.
„Denn“, meinte er, „mir lässt's keine Ruhe, bis ich das Problem der Farbe gelöst habe, das Sie, Donna Falconieros, uns heute Abend vorzauberten. Diese wunderbare, köstliche Wirkung von Rot in Rot – ich hatte mir nie eine solche Kühnheit geträumt. Und was die Hauptsache war – sie wirkte ästhetisch.“
„Meine Kühnheit ist durch Ihren Ausspruch entschuldigt“, entgegnete Donna Dolores, „denn offen gesagt, mir bangte fast, als ich heut Abend in der Garderobe das scharlachrote Kleid anlegte und mein Haar auflöste. Und als dann gar die roten Flammen um mich lohten, da glaubte ich mich dem Urteil der Verdammung, der Ausschließung aus der Zunft der Künstler überliefert zu haben. „
„Es war ein herrlicher Anblick, die letzte Szene der ›Satanella‹“, rief Keppler, „eine Szene, wie sie das Auge des Malers zu sehen sich ersehnt. Rot in Rot – Flammen und Gold – ich kann den Gedanken daran noch nicht loswerden und werde nicht eher Ruhe finden, als bis ich die Farben auf meiner Palette habe.“
Dolores sagte zu, dem Maler einige Sitzungen zu gewähren, und fuhr dabei fort, den Inhalt der Mappe zu durchmustern. Plötzlich stieß sie einen leisen Schrei aus und sah erblassend auf eine Farbenskizze, eine kleine Landschaft mit prächtigen, dunklen alten Eichen und Ulmen, zwischen denen ein altes, im Karree gebautes Haus hervor sah, mit Säulengängen ringsum, die vier Ecken flankiert von ebenso vielen hohen, erkerbeklebten und efeuumwucherten Türmen. Auf einem wehte eine grünweiße, schachbrettartige Flagge und deutete an, dass dieses alte graue Haus kein Kloster sei, wie es auf den ersten Blick schien.
Donna Dolores sah lange auf die Skizze – ihre bleichen Wangen waren noch blässer geworden, und es war, als scheue sie sich zu sprechen. Keppler sah über ihre Schulter hinweg auf das Blatt.
„Ah, das ist der Falkenhof“, sagte er. „Nicht wahr, ein malerischer Fleck Erde. Und Legationsrat von Falkner ist sein glücklicher Erbe.“
„So –?“, sagte Donna Dolores mit eigentümlichem Ausdruck, indem sie zu dem Genannten hinübersah, der mit dem Professor eifrig im Gespräch stand. Seine rücksichtslosen Worte über sie und ihre Leistung auf der Bühne, die sie vorhin mit angehört, hatten sie nicht so tief getroffen, wie man vermutete, aber eine kleine Wunde hatten sie doch hinterlassen. Seit diesem Augenblick aber, als sie hinübersah nach dem Erben des Falkenhofes und sein Blick wiederum über sie wegflog, kalt, verächtlich, da wusste sie, dass dieser Mann dort ihr Feind war oder es werden musste.
„Ein kleines Eden, dieser Falkenhof“, sagte Keppler, auf das Bild deutend, „und doch wiederum der Hintergrund für einen Kampf aus der Zeit der Bilderstürmer. Balthasar hat eines seiner berühmtesten Bilder nach dieser Skizze geschaffen, die er an Ort und Stelle mit Bewilligung der jetzigen Herren aufnahm. Bei dieser Gelegenheit machte er die Bekanntschaft Falkners.“
„Des Erben vom Falkenhof“, wiederholte Dolores leise für sich.
„Ein Mann von Geist und Wissen“, fügte Keppler ebenfalls leise hinzu, „aber mitunter absprechend und kalt bis zur Rücksichtslosigkeit. Balthasar ist so ziemlich der einzige Künstler, dessen Salon er besucht –“
„Also exklusiv und hochmütig ist er demnach“, fiel Dolores dem Maler ins Wort.
„Man ist versucht, es manchmal so zu nennen“, sagte dieser achselzuckend, „Falkner liebt wohl die Kunst und erkennt das Genie rückhaltlos an, aber er will nichts oder doch nur wenig von den Künstlern wissen.“
„Also doch Hochmut“, warf Dolores ein.
„Vielleicht, Senora. Aber er geht den Künstlern wenigstens nicht aus dem Wege, während er eine ausgesprochene Abneigung gegen –“
Keppler stockte.
„Nun?“, fragte die Sängerin ruhig, „warum vollenden Sie nicht: während er eine ausgesprochene Abneigung gegen die Künstlerinnen hat.“
„Senora –“, sagte der Maler halb lachend, halb verlegen.
„Warum nicht aussprechen, was der Betreffende so zur Schau trägt?“, sagte sie achselzuckend, leicht, indem sie die Skizze fortlegte. Aber dabei entstieg ein tiefer Atemzug fast wie ein Seufzer ihrer Brust.
Sie erhob sich und nahm ihre Handschuhe.
„Wie, Sie wollen schon gehen, Senora?“, rief der Professor und eilte auf sie zu.
„Es ist spät, und ich bin müde“, erwiderte sie freundlich. „Die Partie der heutigen Oper war anstrengend. Es ist gar nicht so leicht, eine ›Teufelin‹ zu spielen“, setzte sie lächelnd, fast schalkhaft hinzu.
„O Senora, singen Sie uns noch ein Lied, ein kleines Lied nur“, bat Frau Balthasar und geleitete Dolores nach dem offenen Flügel.
Donna Dolores zögerte einen Augenblick, dann setzte sie sich an das Instrument und ließ die Hände präludierend über die Tasten gleiten. Und sie sang ein einfaches kleines Lied, kurz wie ein Intermezzo.
„Es hat die Rose sich beklagt,
Dass gar zu schnell ihr Duft verwehe,
Den ihr der Lenz gegeben habe.
Da hab ich ihr zum Trost gesagt,
Dass er durch meine Lieder wehe
Und dort ein ew'ges Leben habe.“
Und wie sang sie es! War diese süße, zauberische, weiche Stimme dieselbe, die vorher das Teufelinnenlied von der Bühne herabgejauchzt? Wie eine Verheißung zog Wort und Ton durch das lautlose Gemach.
Und atemlos lauschte der kleine Kreis, als Dolores geendet hatte und leise das Nachspiel erklingen ließ. Dabei schweifte ihr Blick dahin, wo die Skizze des Falkenhofes auf der Mappe lag, und es schimmerte feucht in ihren Augen. In weiche Mollakkorde löste sie die Melodie des Liedes von Mirza Schaffy auf und ging in eine andere über –
„Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar –“
sang sie leise, wie im Traum. Herzerschütternd schwollen die Töne des schlichten Volksliedes an, und durch die einfachen Worte klang es wie ein Schluchzen –
„O du Heimatflur, o du Heimatflur,
Lass zu deinem heil'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur
Entfliehn im Traum.
Keine Schwalbe bringt, keine Schwalbe bringt
Dir zurück, wonach du weinst;
Und die Schwalbe singt, und die Schwalbe singt
Im Dorf wie einst.“
Die süße Stimme verklang, und die Sängerin ließ die Hände herabsinken von den Tasten. Ihr gegenüber stand Alfred von Falkner, das Auge wie gebannt auf sie gerichtet, die er vorhin so hart verurteilt hatte. Und das Lied –? Es stieg vor seinem geistigen Auge empor wie eine Erinnerung in verschwommenen Umrissen, als das Lied ertönte. War dieses Lied nicht einst in den Kreuzgängen des Falkenhofes erklungen von einer frischen, hellen Kinderstimme –? Er strich mit der Hand über die hohe Stirn und sann und sann – und es war ihm fast, als müsse er in den frohen Tagen seiner Jugendzeit, in den engen Grenzen der Knabenjahre die Gestalt eines Spielgefährten suchen – ja, da war's ihm, als höre er ein kurzes, helles, spöttisches Lachen –
„Und die Schwalbe singt, und die Schwalbe singt
Im Dorf wie einst – –“
sang Donna Dolores dort am Flügel die Schlussworte ihres Liedes – und versunken waren mit einem Male die abgeblassten, vergessenen Gestalten – zerronnen in ein Nichts, aus dem sie entstanden.
„Das nenne ich Musik“, rief Balthasar nach einer Pause und trat auf die Sängerin zu, „das bebte durch die geheimsten Fibern der Seele, denn es war mit dem Herzen gesungen.“
Donna Dolores fuhr empor und richtete sich aufatmend hoch auf. Dann lachte sie kurz, hell und spöttisch, dass Falkner zusammenzuckte, denn ihm kam dieses Lachen so bekannt vor – und ein dunkler Blitz aus ihren schönen Augen huschte auf ihr Gegenüber.
„Mit dem Herzen?“ wiederholte sie laut und deutlich, „Sie irren, Professor. Ich spielte heute in der ›Satanella‹ mein eigenstes Selbst – nicht einen warmen Herzenston vermag ich anzuschlagen, eben weil ich kein Herz habe – –“
Falkner zog die Stirn in Falten, als ihm die Sängerin seine eigenen Worte wie eine Spottdrossel wiederholte – dann zuckte er mit den Schultern, verächtlich, hochmütig.
Da sprühten ihm die schwarzen Augen einen wahren Teufelinnenblick zu – es schien fast, als ginge ein rotes Feuer aus diesem Blick hervor – und wieder lachte der feine, blassrote Mund jenes seltsame, sinnverwirrende Lachen.
„Sie sind ein guter Psychologe und Physiologe, Herr von Falkner“, rief ihm Donna Dolores zu – es waren die ersten Worte, die sie an ihn richtete, „Ihr feines Gefühl hat Sie nicht betrogen – ich selbst habe die ›Satanella‹ komponiert!“
Ein allgemeines „Ah“ der Überraschung erscholl, und Falkner biss sich auf die Lippen – er ärgerte sich mit einem Male über sein Urteil, er ärgerte sich, dass er recht hatte. Donna Dolores aber ließ ihre Hände wieder über die Tasten des Flügels gleiten, wild, wirbelnd erschollen die rauschenden Akkorde, mit denen das Volk in der „Satanella“ den Holzstoß entzündet, um die Hexe zu verbrennen, die sich nun mit einem Male in das nimmer vertilgende, ewig lebende böse Prinzip, in den Fluch verwandelt, der auf der Welt seit ihrem Beginne ruht. Mächtig schwollen die Akkorde an, und mächtig setzte die Stimme der Sängerin ein:
„Lebt wohl, so lang der Sonne Leuchten
verklärt des Weibes ew'ge Macht,
So lang noch Leidenschaften glühen,
So lang noch Schönheit lockend lacht,
So lang noch Männerherzen brechen
Betrogen durch ein falsches Weib,
So lang, so oftmals kehr' ich wieder,
In eurer Mitte stets ich bleib'!
Entfacht der Flamme rote Gluten,
Ihr schafft mich nicht aus dieser Welt,
Denn wo sich Männerhochmut brüstet,
Mein Zepter reiche Ernte hält.
Ich wohn' in jedes Weibes Herzen,
Ich beuge jedes Mannes Macht,
Ich bin die Schlang' des Paradieses
Ich stifte Unheil – drum habt acht!“
Sie schloss mit einem rauschenden Akkord, durch den es wie das Knistern von Flammen klang, und sprang dann empor.
„'s ist Zeit zur Ruhe – gute Nacht!“, rief sie und war verschwunden, ehe die anderen sich dessen versahen.
Drunten vor der Tür stand der leichte Wagen der Sängerin, die Pferde stampften schon lange vor Ungeduld, und als Dolores eingestiegen war, entführten sie ihre leichte Last in raschem Trabe nach dem Hotel, das die „Brasilianerin“ bewohnte. Ihre schwarze Kammerfrau und Duenna in einer Person, die herkulische alte Negerin, hatte schon alles zur Ruhe vorbereitet.
„Tereza“, sagte Dolores auf spanisch, als ihr die Negerin das Haar zur Nacht einflocht, „Tereza, wen meinst du wohl, habe ich heut gesehen? Den ›Erben vom Falkenhof‹.“
„Alle Heiligen – den Alfred? Hat er dich erkannt, Herrin?“
„O nein – und ich hab' ihm auch kein Wort darum gesagt. Er ist ein schöner, großer Mann geworden, hochmütig und zurückweisend ernst.“
„Wie die ganze Falkenbrut“, murrte die alte Tereza. „Nun, lass ihn laufen. Du brauchst ihn nicht und den Alten auch nicht mit seinen klappernden Krücken.“
„Nein, ich brauche ihn nicht“, sagte Donna Dolores, „aber“, setzte sie mit zuckenden Lippen hinzu, „aber wiedersehen möcht' ich den Falkenhof doch. „
„So kaufe ihnen das alte steinerne Nest ab, Herrin!“, riet Tereza.
„Das geht nicht“, erwiderte Dolores sinnend, „es ist ein Lehen –“
„Was ist das?“
„Das ist – ach Tereza, ich bin müde und möchte schlafen.“ Sie sank in die weichen Kissen und schloss die Augen.
„Der Erbe vom Falkenhof!“, murmelte sie im Einschlafen.