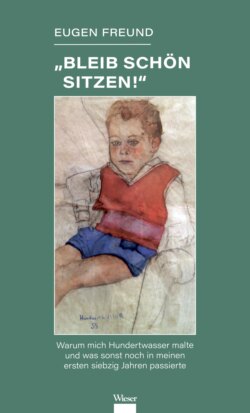Читать книгу "Bleib schön sitzen!" - Eugen Freund - Страница 8
Als Kind in St. Kanzian
Оглавление»Vati, schnell, das Auto lollt!« (Wie soll jemand, der noch kein rollendes »r« aussprechen kann, anders über ein rollendes Fahrzeug sprechen?)
Ganz atemlos kommt der kleine Bub in die Ordination gerannt. Fünf Stufen muss er mit seinen kurzen Beinen erklimmen, dann noch eine, danach zwei lange Gänge, dann noch durchs Wohnzimmer zum Arbeitsplatz des Arztes. Doch der Vater ist nicht interessiert. Er sitzt an seinem Schreibtisch, Marke Gründerzeit, mit einem kleinen Turm, der rechts von der Arbeitsplatte nach oben ragt. In einem kleinen Türchen steckt ein Schlüssel, an der Kette daran hängen zwei weitere Schlüssel. Der Herr Doktor sitzt auf einem hölzernen Sessel, die Sitzfläche und die Rückenlehne sind aus gealtertem Leder. Es knarrt, als er sich zum Buben hinüberdreht. Sein schwarzes, glattes Haar ist streng gescheitelt, der Schnauzer korrekt rasiert, die grauen Augen blicken ernst durch die Brille:
»Siehst du nicht, dass ich eine Besprechung habe.«
Neben ihm sitzt eine Dame, vor ihm am Schreibtisch liegt ein Stapel Medikamente. Weil ihm ganz offensichtlich keine Zeit für Argumente gelassen wird (oder weil er noch keine wirklich formulieren kann), läuft der Kleine enttäuscht wieder den Weg zurück: durch die zwei Gänge, dann eine Stufe, über die steinerne Brüstung kann er noch nicht blicken, also muss er wieder ganz hinunter: Vor allem die Stufen, die zum Eingang ins Haus führen, machen ihm zu schaffen. Als er, barfuß wie er ist, im Hof ankommt, ist das Auto, ein VW Kastenwagen, Kennzeichen G 4071, wieder ein paar Meter weiter leicht bergab gerollt, an den vier Gärten vorbei – jeder Hausbewohner hatte ein eigenes, abgeteiltes Stück zur Verfügung: mit Bohnen, Tomaten, Kartoffeln, Salat, Kräutern. Nur ganz langsam bewegt sich der Wagen, jeder Stein ist ein Hindernis, die Neigung ist gering, doch er macht keine Anstalten stehen zu bleiben. Also dreht sich der Bub wieder um, und läuft – über die Stiegen auf allen vieren – zurück ins Haus.
»Vati, komm doch, das Auto lollt noch immer!«
»Lass mich, ich hab’ zu tun.«
Doch Frau Bisenius, die Dame neben ihm, sie ist Vertreterin für pharmazeutische Produkte, schöpft Verdacht. Sie weiß, als sie ankam, war sie die Einzige mit einem Fahrzeug im Hof. Sie geht zum Fenster, blickt hinaus: Dort, wo sie ihren blauen VW abgestellt hat, ist nun gähnende Leere.
»Herr Doktor«, sagt sie, »wir sollten doch nachsehen!«
Der Bub läuft ihnen hinterher. Am Haustor angekommen, sehen sie gleich, dass sie zu spät dran sind. Obwohl – der Wagen rollt nicht mehr. Er ist neben der Holzhütte, die den Hof nach Norden abgrenzt, zum Stehen gekommen. Nicht etwa, weil er keinen Schwung mehr hatte, sondern weil er nun halb am Abgrund, über einer Betonmauer hängt, die Vorderräder in der Luft, darunter – das weiß Frau Bisenius freilich nicht – ist eine Senkgrube, mit einem Betondeckel einigermaßen gut abgesichert.
»Man hätte doch auf den Buben hören sollen«, sagt der Herr Doktor, »zum Glück ist nicht mehr passiert.«
Irgendwann kommt ein Traktor und zieht den Wagen mit einem Seil rücklings aus seiner Misere, alle vier Räder stehen wieder auf festem Boden.
Damals war ich noch keine drei Jahre alt, meine Leidenschaft für alles, was mit Autos zu tun hatte, war gerade erst im Entstehen. Das mag auch daran gelegen haben, dass zu der Zeit und in der Gegend, wo ich aufwuchs, Autos noch ausgesprochen selten waren – wenn man davon absieht, dass im Hof, eher etwas versteckt hinter dem Haus, ein total verrosteter, ehemals weiß lackierter Rot-Kreuz-Wagen stand, in dem wir gelegentlich am Lenkrad drehten und uns nicht einmal vom stark modrigen Geruch der immer wieder nass gewordenen Sitze davon abhalten ließen, Rettungsfahrer zu simulieren.
Nur sechs Wochen nach meiner Geburt hatten meine Eltern Wien verlassen und waren nach St. Kanzian am Klopeiner See gezogen. (Aus dem Notizbuch meines Vaters vom 26. Juni 1951: Nach knapp über 25 Jahren aus der Trauttmannsdorffgasse ausgezogen. Um 7.15 Uhr mit Inge, den Kindern und Inges Mutter mit dem Zug nach Klagenfurt – eigenes Coupe – von dort Bus nach Kühnsdorf … über Nacht bei Holzer.) Dort war eine Stelle als Gemeindearzt ausgeschrieben, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass meine Eltern mit den zwei Kindern auch eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekamen. Nicht sofort, denn erst mussten wir aufs Mobiliar warten. Die erste Nacht verbrachten wir bei »Holzer«, genauer gesagt im Hotel Amerika-Holzer. Meine Erinnerung ist zwar verständlicherweise getrübt, doch ich kann mich wieder auf die Eintragungen meines Vaters in einen kleinen Taschenkalender stützen. Die Besitzer waren zwei Damen, Mutter und Tochter, deren Mann bzw. Vater wenige Monate vor unserer Ankunft verstorben war. Das »Amerika-Holzer« war damals das erste Haus am Platz (ist es übrigens bis heute), doch zu teuer für einen längeren Aufenthalt. Also zogen meine Eltern am nächsten Tag mit Sack und Pack ins Gasthaus Wank nach St. Kanzian.
Ein paar Wochen nach unserer Ankunft lud das Fräulein Holzer meine Eltern zum Abendessen ein. Wir waren – relativ – fremde Menschen, wir kannten ja noch niemanden, und so wurde diese Einladung spontan ausgesprochen. Das neue Ärzteehepaar wurde übrigens für halb acht erwartet, gekommen ist es um halb zehn, nach den Visiten, aber nicht einmal diese Verspätung stellte die junge Freundschaft auf die Probe.
* * *
Inzwischen war der Umzug in die Wohnung erfolgt, direkt in der Volksschule. Über uns wohnten drei Lehrer, neben uns die Schulwartin mit ihrer Familie.
Unsere Wohnung begann hinter einer Glastür mit einem Vorraum, in dem sich sechs Sessel aneinanderreihten. Sie standen den Patienten zur Verfügung, die dort vormittags vor der Konsultation Platz nahmen. Gleich beim Eingang gab es eine Toilette, die wir mit den Kranken teilten – das machte uns resistent gegen allerlei Viren. Am oberen Ende des Warteraums blickte der jeweils erste Patient in die Küche – ein schmaler Schlauch–, in der als einziges modernes Elektrogerät ein Kühlschrank (Marke »Famulus«) stand. Der Herd wurde mit einer Gasflasche betrieben, Waschmaschine gab’s keine, das musste im Waschbecken erledigt werden, in der auch das Geschirr gereinigt wurde. Darunter war ein Holzkasten, ein Drittel davon war für unsere Spielzeuge reserviert. Der braune, fast lebensgroße Holzdackel mit Rädern, den ich immer wieder nachzog, wurde 1956 in eine Schachtel für Ungarnflüchtlinge verpackt, zusammen mit gebrauchten Kleidungsstücken für Kinder.
In dieser Küche arbeiteten unsere »Dienstmädchen« – weil meine Mutter ja in der Ordination mitmachte. Sie hatte drei Kinder in vier Jahren zur Welt gebracht, ums Aufräumen, Putzen und Kochen konnte sie sich nicht zusätzlich kümmern. So standen also im Laufe der Jahre Peppa, Anni, Vida, Mizzi, Toni, Greti, Frida und Hilde hinter dem Herd und sorgten am Ende des Tages dafür, dass wir gewaschen und gekämmt ins Bett kamen. Ab einem gewissen Alter war das äußerst peinlich für uns: Wir spielten draußen mit den anderen Kindern – Heini und Trixi, zwei Lehrerkinder, waren ein paar Jahre jünger als wir – und plötzlich rief Anni oder Mizzi oder eine der anderen aus dem Fenster in den Hof: »Silvi, Pepsi (das war mein Kosename), Buscha (auch Claudia hatte sich als Name nicht durchgesetzt) – reinkommen, waschen, baden, schlafen gehen.« – »Noch fünf Minuten, bitte!«, riefen wir fast im Chor zurück. Die Sonne stand noch relativ hoch am Himmel, um sieben Uhr schlafen gehen, das wollten wir nicht akzeptieren. »Gut, noch fünf Minuten, aber dann …« Drei Minuten später hörten wir sie wieder rufen. Die Kindermädchen – das waren die Haushaltshilfen ab dem Nachmittag – wollten natürlich auch Schluss machen und nach Hause gehen, je früher desto besser. Und so trotteten wir dann resigniert mit hängenden Köpfen über die Stiegen hinein. Im Kinderzimmer, ein Raum neben dem Wartezimmer, den wir nach dem Auszug der Familie Wolkinger 1957 dazubekamen, wartete bereits ein Kupfer-Bottich. Darin befand sich heißes Wasser aus dem Herd, das mit kaltem gemischt wurde, und so landete ein Freund-Kind nach dem anderen in der »Badewanne«. Als ich etwa neun Jahre alt war – so erzählte mir Mizzi bei einem Besuch, als ich sie um Erinnerungen an ihre Zeit bei uns fragte, als Neunjähriger flüsterte ich ihr ins Ohr, dass ich das nun allein machen möchte. Und so geschah es dann auch.
Das Wohnzimmer war gleichzeitig erste Anlaufstation für die Patienten: Brauchten sie nur Medikamente, musste der Blutdruck gemessen werden, reichte eine Injektion in den Po oder war eine intensive Untersuchung durch den Arzt notwendig, teilte das meine Mutter ein, verabreichte Rezepte oder Medikamente, zumindest jene, die wir in einer kleinen Hausapotheke verwahrt hatten. Die war im Schlafzimmer daneben untergebracht, das mit Kleiderkästen und fünf Betten (im Jahr 1953 war noch Claudia – also Buscha – hinzugekommen) ohnehin schon ziemlich vollgestopft war. Weil die fünf Betten nebeneinander keinen Platz gehabt hätten, schliefen die beiden Schwestern in einem Stockbett, mein Schlafplatz war ein Eisengestell, das wie ein auf den Längsseiten stehendes U unter und über dem Fußteil des Doppelbetts der Eltern stand (ich schlief darüber, nicht darunter). Mittels einer Eisenleiter kletterte ich so jeden Abend in mein Bett. Ein schwarzer Glaskasten war abgeschlossen, dort waren die eher gefährlichen Arzneiwaren untergebracht, doch der Schlüssel steckte immer im Schloss. An alle anderen Pharmaka, die in mehreren offenen Stellagen untergebracht waren, kamen wir Kinder leicht heran: »Siogen« Halswehtabletten (klein, rund, gelb, glatt) oder auch »Merfen« (weiß, viereckig, pulvrig) schmeckten wie Lutschbonbons und waren daher beliebtes, wenn auch nicht unbedingt genehmigtes Naschzeug.
Die meisten Patienten waren geduldig, es konnte durchaus vorkommen, dass sich 20 oder auch mehr Kranke versammelten, dann wurden Nummern ausgegeben, damit die Reihenfolge immer gut eingehalten wurde. Viele vertrieben sich die Zeit im Hof, rauchten eine Zigarette und saßen auf einer Bank, um den Aufruf ihrer Nummer abzuwarten. Gelegentlich gab es auch Patienten, die sich für etwas Besseres hielten. Baron Friedrich Latscher-Lauendorf, aus altem österreichischem Adel, einer von vielen Wiener Sommergästen, die sich in Unterburg eine Villa gebaut hatten, betrachtete auch den Arzt als seinen Untertanen. Und so gewöhnte er es sich an, einfach ohne anzuklopfen an allen anderen Patienten vorbei in das Wohnzimmer zu stürmen. Meine Mutter war wütend. Als sie ihn eines Tages wieder einmal mit dem Fahrrad ankommen sah, richtete sie sich eine Schüssel mit kaltem Wasser her und stellte sich zur Tür. Als der Baron diese mit einem schnellen Schwung öffnete, schüttete sie ihm das Wasser über die dreiviertellange Lederhose. Ganz trocken bemerkte sie: »Ach, Herr Baron, ich habe Sie gar nicht Klopfen gehört!« Nach diesem Vorfall klopfte er immer höflich an.
Die Rezeptgebühr durfte meine Mutter einbehalten – ein Schilling, zwei Schilling, später waren es fünf Schilling, aufgehoben oder gesammelt wurde das Geld immer in passenden blechernen Tablettendosen, die auf ihrem Schreibtisch aufgereiht waren. Es war ihr Einkommen. Oder unseres. Denn gelegentlich, wenn das ohnehin knappe Taschengeld wieder einmal ausgegangen war, stibitzte ich einen Fünfer aus der Dose. Oder ich griff in die Manteltaschen meines Vaters und klaubte die eine oder andere Münze heraus. Eine kleine Plastikschatulle mit Kleingeld führte mein Vater auch stets im Auto mit, als eiserne Reserve. Auch die hatte ich entdeckt und behalf mir in Notlagen daraus. Etwa wenn meine Lust auf etwas Süßes nicht mehr zu bändigen war.
Am allerliebsten hatte ich zu jener Zeit »Stollwerk«, tiefbraunes, quadratisches süßes Zeug, das beim Lutschen im Mund alle Zahnzwischenräume verklebte. Dafür musste man freilich zum »Konsum« – dort ging ich als Vierjähriger einmal um fünf Uhr früh hin und war schwer enttäuscht, weil das Geschäft noch geschlossen war … Der »Konsum« war bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch unser einziges Lebensmittelgeschäft im Ort – mit den heutigen Supermärkten nicht zu vergleichen. Es war dunkel im Raum, am Boden standen prall gefüllte große Papiersäcke mit Mehl, Zucker, Reis, Haferflocken und Ähnlichem. Hinter der L-förmigen Theke stand Herr Krakolinig, bekleidet mit einem hellgrauen Arbeitsmantel, und reichte uns die Waren, die in den Regalen verstaut waren, alles, was verpackt oder in Gläsern oder Dosen feilgeboten wurde. Es gab in St. Kanzian allerdings noch eine weitere Gemischtwarenhandlung. Die war im Gasthof Rabl untergebracht, wo sonntags im Sommer nach der Messe immer ein Schleck-Eis auf der Tagesordnung stand. Um daran zu kommen, musste man in die Küche des Gasthofs gehen und den Wirt bitten, sich kurz vom Kochen zu trennen und mit uns in die Fleischerei zu gehen, denn dort stand die Eismaschine, direkt neben der Kühltruhe, in der die Schulterscherzeln, die Schweinshälften oder die Hendln gekühlt wurden. Um 50 Groschen bekam man damals eine kleine Kugel, um einen Schilling entsprechend zwei. Mehr als zwei oder drei Sorten gab es nie, Vanille, Erdbeere, Schokolade, eventuell noch Haselnuss, das war’s. Wenn die Jahreszeit nicht nach Eis verlangte, gab es eine köstliche Alternative: »Negerbrot« (so durfte man damals die Schokolade mit den großen Haselnuss-Stücken nennen), oder »Dreieck« – Schoko-Waffeln, die die Größe eines Schul-Dreiecks hatten, auch Schaumtüten oder Ein-Schilling-»Bensdorp«-Schokoladen. (Immer wieder beteiligten wir uns damals an einer Aktion der Firma, die das Sammeln einer bestimmten Anzahl an »Schleifen« – das war die Verpackung aus Papier, in der die Schokolade eingewickelt war – mit zehn oder auch zwanzig »Bensdorp«-Schokoladen prämierte.) Um aber einen Einkauf zu tätigen, musste man die Mizzi, die Schwester des Wirtes, meist ebenfalls aus der Küche des Gasthauses holen. Dann ging sie mit uns durch den Ausgang auf die Terrasse mit der jahrhundertalten Kastanie und sperrte eine alte, knarrende Holztür auf, hinter der sich ein Kammerl mit allen möglichen Lebensmitteln befand. Und eben auch mit köstlichen Süßigkeiten.
Wenn wir dann allein vom Gasthaus weggingen, schlichen wir uns so rasch wie möglich am Stall vorbei. Dort stand immer der »Fide«: ein kleiner, rundlicher Mann, meist trug er Holz-Zockel ohne Strümpfe, sein Gang war wackelig, seine Lippen, von denen immer Speichel tropfte, waren dicklich und seine Sprache unverständlich. »Fide, Fide, Feitl auf!«, riefen ihm die tapfereren größeren Buben zu und ich hatte keine Ahnung, was damit gemeint gewesen sein könnte.
Neben der Brücke, unter der der Abfluss des Klopeiner Sees floss, waren in den frühen 1950er Jahren montags immer Frauen zu sehen, die dort ihre Wäsche wuschen – sie waren aus dem ganzen Ort zusammengekommen, trugen in einem Leintuch eingerollt Hemden, Unterwäsche, Socken und Tischtücher mit sich und schrubbten sie im kalten Wasser des Baches, bis sie wieder blütenweiß waren, oder was man damals eben unter blütenweiß verstand.
Neben dem wöchentlichen Kirchgang und dem Besuch des Krämerladens gab es für uns Kinder noch einen zweiten Grund, regelmäßig in den Ort zu gehen: Im Gasthof Wank gab es einen Fernseher und da durften wir, gegen ein Eintrittsgeld von 50 Groschen, mittwochs immer »Kasperl« und »Welt der Jugend« ansehen, schwarz-weiß natürlich. Dazu kamen noch die spannenden Abenteuer von »Lassie« und »Fury« – ein Hund und ein Pferd, die mit besonderen Eigenschaften immer ihre jugendlichen Besitzer aus einer Gefahrenlage retteten. Kasperl war etwas für die ganz Kleinen (»Krawuzi-Kapuzi«), die »Welt der Jugend« war eine Art »Zeit im Bild« für Kleine, nannte sich im Untertitel »Das internationale Fernsehmagazin« (Sprecher: Luise Prasser und Fred Schaffer). Schon die Kennmelodie zeigte auf, worauf man sich freuen konnte: Eine Weltkugel drehte sich bis zu einem bestimmten Punkt, blieb unvermittelt stehen, dann öffnete sich ein Türchen und der gezeichnete Kopf eines Kindes schaute heraus, immer in der jeweiligen Landestracht. Bei »Österreich« war es ein Bub mit einem Filzhut mit Gamsbart und Ziehharmonika.
Daran kann ich mich deshalb so gut erinnern, weil ich als Elfjähriger einmal selbst in einem Beitrag vorkam: als »gelehriger Schüler«, der seinem Großvater in der selbst gebauten Privat-Sternwarte mit Fernrohr (»dieses Monstrum, das wie eine Kanone aussieht …«) behilflich sein durfte. Mit Sphärenklängen unterlegt hieß es dann zum Schluss: »Im sogenannten Trockenkursus« – dabei sieht man, wie der Großvater einen Sternenatlas aufschlägt – »wird der Enkel in die Geheimnisse des Firmaments eingeweiht, in eine Welt, die vielleicht schon morgen die unsere sein wird …«. Vielleicht. Doch zu Sternwarte und Großvater später mehr.
Weil wir keinen Fernseher hatten, mein Vater aber offensichtlich einmal bei einer Visite das Familienquiz »Einer wird gewinnen« mit Hans-Joachim Kulenkampff mitbekommen hatte und davon begeistert war, begann einmal im Monat am Samstagabend auch bei uns das Rätselraten: Wo werden wir uns heute selbst einladen, um »EWG« zu schauen? Nicht immer gelang es, aber Josef Marolt (den wir alle »Pepi« nannten) nahm uns gerne für diese zwei unterhaltsamen Stunden bei sich auf. Wir kamen rechtzeitig, um noch Hugo Portisch mitzuverfolgen, der uns in leicht fasslicher Form das Wochengeschehen erklärte. Der »Kalte Krieg« war seine Spezialität, aber auch der heiße, zu jener Zeit die Auseinandersetzungen im Fernen Osten – die konnte niemand so gut erklären wie der »Portitsch« (wie ihn die meisten nannten). Dann rieten wir bei »EWG« mit, freuten uns aber am meisten auf den Schlussgag mit »Herrn Martin«, dem Butler, der Kulenkampff den Mantel reichte und dabei irgendetwas an der Sendung sarkastisch kommentierte. Für uns hörte sich das alles echt an, erst viel später erfuhren wir, dass sich diese Schlusspointe Kulenkampff immer selbst ausgedacht hatte.
Außer diesem Fernsehabend gab es für uns Kinder kaum eine Ablenkung vom und im Alltag. Nicht, dass wir die besonders nötig hatten: Wir spielten im Hof oder auf dem Schul-Turnplatz, Kinder gab es in der Nachbarschaft genug und das füllte uns auch bis zur Müdigkeit am Abend aus. Wenn es in St. Kanzian doch einmal eine Attraktion gab, versammelte sich dort auch das ganze Dorf. Einmal etwa zog ein riesiger Lastwagen durch Unterkärnten, auf der Ladefläche lag ein fast dreißig Meter langer Blauwal. Er war am Bauch aufgeschnitten, entsprechend stark war der Geruch, der von dort ausströmte. Aber das hielt uns nicht davon ab, dieses Untier aus der Nähe zu betrachten – so etwas Großes hatten wir noch nie gesehen. Allein das Maul, das man mit einem armdicken Stock offen hielt, war so groß, dass ich leicht darin Platz gefunden hätte. Zum Glück machte niemand den Vorschlag, ich sollte das ausprobieren. Nie im Leben ausprobiert hätte ich auch eine zweite Sensation, die uns zur Kirche eilen ließ: Ein Motorradfahrer fuhr auf einem gespannten Seil fast bis zur Kirchturmspitze hinauf. Um das Gleichgewicht zu halten, war unter dem Motorrad noch ein Gestänge befestigt, auf dem eine Frau saß. Wir hielten alle den Atem an, als der Fahrer Gas gab und sein Gefährt samt Begleitung nach oben lenkte – das heißt, lenken musste oder konnte er nicht, denn die Reifen waren abmontiert und nur die Felgen klammerten sich an das Seil. Eine weitere Attraktion waren die »Don-Kosaken« – eine Reitertruppe, die atemberaubende Kunststücke auf ihren Pferden zeigte: Ein Reiter saß verkehrt auf dem Sattel, ein anderer hielt sich unter dem Bauch des Tieres fest, immer wieder galoppierten sie aufeinander zu, stießen sich vom Pferd und kamen trotzdem auf den Beinen stehend am Boden auf.
Ich erinnere mich auch noch gut an die Ordination, in der es alles gab, was ein Landarzt damals brauchte: einen Frauen-Untersuchungsstuhl, mit eierschalengelben Sitz- und Rückenflächen und zwei chromverzierten, verstellbaren langen Stangen, die in einem O endeten, etwas, das uns Kindern immer Rätsel aufgab. Daneben stand ein Zahnbohrgerät, der dazugehörige Elektromotor, der über lange Treibriemen mit dem Bohrer verbunden war, musste mit dem Fuß bedient werden. Im Raum gab es den schon erwähnten Gründerzeit-Schreibtisch und zwei weitere kleine, weiß lackierte Tischchen, auf denen Wasserkocher standen, die zur Sterilisation der Spritzen und Injektionsnadeln im Einsatz waren. Und dann war da noch eine Liege, genauer: eine Joka-Couch, die sich einmal, ich war damals achteinhalb Jahre alt, als Geschenk des Himmels erweisen sollte.
Zu Weihnachten 1959 bekam ich nämlich meinen größten Wunsch erfüllt: Unter dem Christbaum stand eine rote Schachtel, in der eine elektrische Eisenbahn (»Kleinbahn«) verstaut war. Ich hatte sie einige Wochen vorher beim »Grüner« in Klagenfurt in der Auslage gesehen und offenbar keine Ruhe mehr gegeben. Noch am Abend baute ich das Oval unter dem Esstisch auf, sonst gab schlicht keinen Platz dafür. Da das aber auch keine wirklich praktikable Lösung war (wenn ich unter dem Tisch spielte, war der Raum für die Beine der restlichen Familienmitglieder deutlich eingeschränkt), kam mein Vater auf die glänzende Idee, die Schienen im Bettzeugraum der aufklappbaren Couch in der Ordination unterzubringen. Das wiederum verkürzte meine Spielzeit auf jene Stunden, in denen weder mein Vater die Ordination noch Patienten das Bett beanspruchten. Das war allerdings selten der Fall.
Weihnachten war für uns Kinder natürlich ein Segen, aber immer auch ein wenig mit einem Fluch verbunden. Da viele Patienten auch am Heiligen Abend versorgt werden mussten, war der Vater auch an diesem Tag auf Visiten unterwegs. Wir Kinder saßen im Vorraum, spielten miteinander und warteten gespannt darauf, dass das Christkind endlich das Glöckchen läutete – das untrügliche Zeichen, dass der Christbaum geschmückt war und es mit dem Abliefern und dem Einpacken der Geschenke fertig war. Den Baum besorgte uns jedes Jahr der »Joza«, der Mann der Schulwartin – damals war es üblich, einfach in den nahe gelegenen Wald zu gehen und sich dort einen schönen Baum abzuschneiden – wenn der Wald der Kirche gehörte, dann umso besser. Dann war er auch gleich gesegnet.
Während die Nachbarkinder – an ihrem Gejauchze und dem Geschnatter deutlich hörbar – schon längst mit ihren neuen Spielzeug spielten (oder sogar bei uns vorbeikamen und die neuesten Sachen präsentierten), ließ unser Gabentisch noch immer auf sich warten. Oder besser: Der Vater ließ auf sich warten. Denn viele Patienten luden ihn ein, mit ihnen noch die eine oder andere Jause zu teilen oder »wenigstens ein paar Minuten, nur für ein Weihnachtsplauscherl, noch zu bleiben«. Und so wurde es oft acht Uhr oder sogar neun, bis der Herr Doktor von seinen Visiten zurückkam und uns Kinder aus der Ungeduld erlöste. Später – viel später – wiederholte sich das Schauspiel durch das ähnliche Verhalten unserer Mutter. Auch sie war zu Weihnachten immer die letzte. Mittlerweile hatten natürlich schon wir Kinder das Schmücken des Christbaums übernommen, aber jedes Jahr am 24. Dezember warteten wir auf sie, bis sie aus Klagenfurt zu uns kam: Sie musste noch die Obdachlosen und die Taxifahrer mit kleinen Geschenken versorgen, meist selbst gebackene Kekse, was immer zu heftiger Verspätung und auch zu einer gewissen Verärgerung führte …
Ein Zimmer, das eigentlich zu unserer Wohnung gehörte und gegenüber dem Warteraum lag, wurde einige Jahre noch von einer anderen Partei, der Familie Wolkinger, benutzt. Doch so ganz genau hielten sich die Wolkingers offenbar nicht an die Raumeinteilung. Eines Tages, oder eigentlich eines Nachts ging meine Mutter in die Küche und sah zu ihrem Schrecken hinter dem Kasten einen Schuh herausschauen. Zu diesem Schuh gehörte auch ein Fuß, ein Bein, ein Körper – da stand doch tatsächlich Herr Wolkinger und stotterte eine Entschuldigung: »Uh, ah, ich … ich habe den Wasserhahn tropfen gehört und wollte ihn gerade zudrehen …« Ob damals auch irgendetwas aus der Küche gefehlt hatte, ließ sich nicht mehr rekonstruieren.
Fast alle Kinder im Haus waren älter als wir Neuankömmlinge. Sie gingen schon zur Schule, und wenn das die Volksschule war, dann mussten sie nicht einmal ins Freie: Alle Wohnungen (auch unsere) waren mit einem Gang mit den Klassenzimmern verbunden. Ohne Mäntel und ohne feste Schuhe konnten wir so die ersten vier Jahre zur Schule gehen.
Auf der anderen Seite des großen Gebäudes gab es den schon erwähnten Parkplatz, er war gleichzeitig die Zufahrt zur Holzhütte, die die Gemeinde als Lager verwendete, zwei Traktor-Anhänger standen darin, Holzstangen, um im Winter die Straßen abzugrenzen, und Bänke, die den Urlaubern in den Sommermonaten auf den Wanderwegen zur Verfügung standen. Unterhalb, quasi im Keller der Hütte, gab es einen kleinen Stall mit Schweinen. Die fütterte die Frau Kert mit »Kåschpl« – essbare Abfälle, die in einem Kübel gesammelt und dann in den Schweinetrog geleert wurden. Gelegentlich teilten sich die Schweine den Platz in der Hütte mit zugelaufenen Katzen. Nur zu viele durften es nicht werden.
Manchmal, wenn ich mit einem der größeren Buben in einem Kellerzimmer mit den kleinen Matchbox-Autos spielte – dazu hatten wir in den Holztisch Fahrbahnen eingekratzt –, hörte ich draußen am Gang flehendes Katzenmiauen. Als wir nachschauten, sahen wir die Schulwartin gerade in den nächsten Raum huschen, in dem ein riesiger Waschtrog aus Beton eingebaut war. Frau Kert wollte nicht, dass wir sahen, was als Nächstes passierte. Sie hielt einen Kartoffelsack im Arm, aus dem das schwache Miauen zu vernehmen war, aber nur ganz kurz. Mit einer raschen Handbewegung tauchte sie den braunen Sack ins Wasser und hielt ihn wohl eine halbe Minute unter. Als sie ihn wieder herauszog, war das Miauen verstummt.
Der grausame Tod der Katzenjungen war nicht das einzige einprägsame Ereignis im Umgang mit den Tieren in unserer Hausgemeinschaft. Immer wieder musste auch ein Huhn daran glauben. Das für den Mittagstisch herzurichten, war die Aufgabe von Herrn Kert: Ein frei herumlaufendes Huhn einzufangen, war schon schwierig genug. Es schien zu ahnen, was ihm bevorstand, und lief daher mit lautem Gackern vor dem mit einer Axt bewaffneten Mann davon. Wenn er es schließlich mit beiden Händen erwischt hatte, folgte der nächste, brutale Schritt: Er legte es auf einen Holzpflock, versuchte das mit den Flügeln wild um sich schlagende Huhn einigermaßen ruhig zu halten und – zack – schlug er dem Tier mit der scharfen Hacke den Hals durch. Der Kopf fiel zu Boden, doch was danach folgte, blieb unvergesslich: Oft entglitt der zappelnde restliche Körper seinen Händen und dann lief das kopflose Tier davon, Blut spritzte aus dem Hals, bis es nach ein paar Metern kraftlos in sich zusammensackte. Dann wurde es in einen großen Topf mit heißem Wasser gelegt, um die Federn leichter ausrupfen zu können. Dass wir danach trotzdem noch Lust auf ein Brat- oder Backhendl hatten, ist schwer erklärlich. Umso verständlicher, dass sich einmal im Hof ein Hahn für die grausame Behandlung seiner Hennen ausgerechnet an mir rächte. Ich war gerade am Weg zum Hühnerstall, als mich der besagte Hahn sah und zielgerecht auf mich zu rannte: Nichts Böses ahnend blieb ich stehen und da war er schon. Er sprang mich an und bohrte seinen Schnabel durch die dünne Sommerhose in meine Seite. Ich schrie auf, laut genug, dass er von mir abließ, doch seit damals bin ich immer vorsichtig, wenn ich Hühnern, oder mehr noch einem Hahn außerhalb eines Zaunes begegne.
Irgendwann, als er um die 15 Jahre alt war (ich war damals zehn), wollte mein älterer Freund Sigi nicht nur mit den Matchbox-Autos spielen. Als ich in sein Zimmer kam, lag er im Bett und tat so, als ob er müde sei. »Komm, leg dich dazu«, sagte er und hob mit einer Hand die Decke hoch. Ich dachte mir nichts dabei und schlüpfte neben ihn. Es dauerte nur kurz und schon nahm er meine Hand und legte sie auf seinen erigierten Penis. Ich wusste nicht recht, wie mir geschah und wollte sie wegziehen. Aber Sigi blieb hartnäckig und hielt meine Hand fest. Das schien ihm nicht zu reichen, denn er forderte mich auf, sein dickes Stück in den Mund zu nehmen. Mir graute davor, aber ich hatte keine Chance und tat, was er verlangte, krümmte aber meine Lippen so nach innen, dass ich mit dem Penis kaum in Berührung kam. Als er merkte, dass bei mir da nicht mehr herauszuholen war, ließ er mich gehen. Es war das letzte Mal, dass ich in sein Zimmer kam. Zum Auto-Spielen musste ich mir dann andere Freunde suchen.
Hinter der Schule gab es noch zwei Besonderheiten: Im Schatten des Turnsaales war eine zirka drei Meter breite, gut 20 Meter lange, mit 10 Zentimeter hohem Rand betonierte Fläche errichtet worden. Sobald die Temperaturen unter null gesunken waren, wurde erst Wasser daraufgespritzt und bald danach hörte man das Klirren der Eisstöcke. Denn vor allem am Wochenende trafen sich viele St. Kanzianer, um bis spät in die Nacht – zwei Lampen beleuchteten die Eisbahn notdürftig – ihre Matches auszutragen. Ziel war es, den Stock so nahe wie möglich an die Daube zu zielen oder dem Gegner die Bahn zu ihr zu versperren. Neben der dicken Winterkleidung und den aus Filz gefertigten Überschuhen sorgte auch der Alkohol dafür, dass die Körper nicht einfroren.
Die zweite Besonderheit war – gleich neben der Eisbahn – die Kalkgrube: ein Betonschacht, der mit einer weißen Masse gefüllt und durch schwere Bretter abgedeckt war. Wenn man durch einen Spalt hinunterblickte, konnte man gelegentlich das Blubbern des Kalks hören oder vielleicht sogar sehen. Wir Kinder wurden immer davor gewarnt, der Grube ja nicht zu nahe zu kommen, denn würde man dort hineinstürzen, könnte das tödliche Folgen haben. Einer unserer Nachbarbuben, Manfred, er war damals fünf Jahre alt, hatte sich offenbar nicht an die Mahnung gehalten. Durch einen Spalt, der für seinen kleinen Körper zu breit war, fiel er hinein und war binnen weniger Minuten so schwer verbrannt, dass ihn mein Vater, der sofort am Unfallort war, nicht mehr retten konnte.
Josef Kert, genannt »Joza«, war ein Schwerarbeiter. Sein Gesicht war braun gebrannt, er war ja immer im Freien, sein schütteres Haar war früh angegraut, viele Furchen zogen sich über die Stirn, seine Hände waren knochig, die Schwielen auf den Fingern stammten von der Schaufel, der Hacke oder der Säge, die er tagaus, tagein in der Hand hielt. Er war bei der Gemeinde St. Kanzian »angestellt«, oder jedenfalls wurde er von dieser Institution für seine Tätigkeiten bezahlt. Wann immer es etwas zum Aufgraben, Zuschaufeln, Betonieren, Sägen, Hacken, Aufbauen oder Abreißen gab, »Joza« war dabei, von Montag früh bis Freitagabend – oder besser: Freitagnachmittag, denn da gab es die Auszahlung. Seine Frau, die Schulwartin, wartete dann immer mit Bangen auf seine Heimkehr. Gelegentlich kam er stockbetrunken, das schwarze Steyr-Fahrrad neben sich herschiebend, zuhause an. Seine Frau war wütend, hatte er doch wieder fast sein ganzes Wochengehalt im Gasthaus versoffen. Durch alle Räume des Hauses hörte man dann die beiden miteinander lautstark streiten, das gebrüllte »Prekled hudič«, »Moj duši« oder das etwas verzweifeltere »Marija Devica« klingt mir noch heute in den Ohren. Wenn es noch später wurde, hatte Frau Kert oft schon die Wohnungstür versperrt. Joza suchte und fand dann auf den Sesseln bei uns im Vorraum einen Platz, wo er seinen Rausch ausschlief. Wenn wir Kinder in der Früh auf die Toilette mussten, konnte es schon vorkommen, dass wir über ihn drübersteigen mussten, weil sein Körper in der Nacht langsam vom Sessel auf den Boden heruntergerutscht war.
Seine Frau war Schulwartin und gleichzeitig eine strenge Hausbesorgerin. Sie war eine stattliche, schöne Frau mit vollem, dunklem Haar, einem faltenlosen Gesicht, das in den wenigen Momenten, in denen sie sich entspannt zeigte, durchaus auch als freundlich bezeichnet werden konnte. Auch wenn sie »nur« für die Schule verantwortlich war, fühlte sie sich als Aufseherin auch für den Wohnungsbereich. Wir fürchteten uns vor ihr fast genauso wie ihr Mann, obwohl wir ja mit Alkohol nicht in Berührung kamen. Für die Frau Kert waren wir immer zu laut, zu lebhaft und zu umtriebig, was immer wir im Hof unternahmen, es passte ihr nicht. Das hatte sich in uns schon eingeprägt und so schlichen wir uns, wenn wir ihrer ansichtig wurden, wie die Mäuse in unsere Zimmer zurück, um nur nicht ihren Zorn zu erregen. Sie war auch eine ungeheuer fleißige Frau. Allein musste sie jeden Tag den Dreck hinter allen Schulkindern wegputzen, am Vormittag kochte sie für die rund 100 Volksschüler eine (fast immer) warme Mahlzeit: Montag Nudelsuppe, Dienstag Milchreis, Mittwoch Kakao, Donnerstag Ritschert und freitags Tee mit einer Käsesemmel. Das Ganze wurde in der Pause gegen 10 Uhr im Keller serviert. Dort standen mehrere lange Tische, um die sich die Schüler versammelten. Vor dem Essen sprachen wir ein kurzes Gebet: »Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast!« Die fünf Klassenlehrer bewachten uns dabei. Frau Adamek, eine Kärntner Slowenin (nicht, dass man das damals erahnen konnte), brachte den Erstklasslern das Lesen und Schreiben bei (»DER VATER ARBEITET. DIE MUTTER KOCHT«). Frau Luise Prah, sie wohnte in der Schule, war für die zweite Klasse zuständig. Frau Siebitz, die später den Pharmavertreter Willibald Diexer heiratete, sorgte sich um die Schüler der dritten Klasse, und Herr Hubert Rebernig – der Schuldirektor – bereitete seine Schützlinge in der vierten Schulstufe darauf vor, den nächsten großen Schritt zu machen: entweder in die Hauptschule nach Kühnsdorf zu wechseln oder in das Gymnasium nach Klagenfurt. So manches arme Bauernkind bekam aber auch die Disziplin und Härte des Direktors zu spüren, die er als Nationalsozialist im Zweiten Weltkrieg erlernt hatte: Wer nicht spurte, stotterte oder sonst sein Missfallen erregte, wurde flugs mit einer »Kopfnuss« bestraft. Dann zog der Herr Direktor mit dem Fingerring oder dem Schlüsselbund in der Hand scharf über das Haupthaar, blutige Wunden waren keine Seltenheit.
Nur wenige blieben bis zur achten Schulstufe in St. Kanzian, wo sie von Oberlehrer Felix Schwarz unterrichtet wurden. Er, seine Frau Gerda und später die beiden Buben Heini und Michi wohnten über uns und waren jahrzehntelang, auch als sie und wir schon aus der Schule ausgezogen waren, so etwas wie unsere Ersatzeltern. Es gab kaum einen Tag, an dem nicht irgendein Familienmitglied der Freunds in den ersten Stock zu den Schwarzischen ging, wo wir dann mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden und uns über dieses und jenes unterhielten. Über dem Küchentisch hing eine Uhr aus Porzellan, auf der mit blauer Schrift »NUETZE DIE ZEIT« zu lesen war. Ich verstand lange nicht, was NU-ETZE bedeutet, fragen traute ich mich auch nicht, ich wollte ja nicht als dummer Bub dastehen.
Nicht im Traum rechnete ich damit, dass sich hinter der freundlichen Fassade des Volksschullehrers auch rohe Gewalt verbergen konnte. Eines Tages hörte ich elende Schreie über den Schulhof schallen. Ein Junge brüllte wie am Spieß durch ein geschlossenes Fenster des Lehrerzimmers, dazwischen vernahm ich etwas, das ich als Stockhiebe identifizierte. Felix Schwarz verdrosch den etwa 15-jährigen Hermann. Er war bei seiner Tante, der Lehrerin Prah, untergekommen, die dürfte aber mit dem pubertierenden Buben völlig überfordert gewesen sein. Und so prügelte Herr Schwarz auch noch den letzten Widerstand aus dem bedauernswerten Geschöpf heraus. Doch niemand sprach darüber. Das blieb ein Tabu-Thema bis zu seinem Tod.
Neben dem normalen Stoff in der Schule gab es natürlich auch noch den Religionsunterricht, hier war die slowenische Sprache dominant: Die Kirche war der einzige Stützpfeiler der slowenischen Volksgruppe in Kärnten, wo der verpflichtende Unterricht in dieser Sprache 1956 abgeschafft wurde. Pfarrer Josef Kogelnik strahlte zwar eine achtbare Autorität aus, aber auch die musste er immer wieder mit »Kopfnüssen« untermauern. Sein Adlatus, der kleinwüchsige Kaplan Valjavec, war jedoch der ganzen Bösartigkeit der Buben und Mädchen ausgesetzt. Er konnte kaum eine Geschichte aus der Bibel erklären, ohne dass nicht große Unruhe im Klassenzimmer herrschte. Einmal schlich ich mich hinter ihn und äffte ihn zum Gaudium meiner Mitschüler mit Grimassen und Handbewegungen nach. Valjavec, der immer einen Stock bei sich trug – eigentlich war der für die Schreibtafel gedacht – drehte sich plötzlich um und schlug mit dem Holzstück so fest er konnte auf mich ein. Mit dem Effekt, dass der Stock in zwei Teile brach und eine Hälfte durch das halbe Klassenzimmer über die Köpfe der Schüler und Schülerinnen nach hinten flog.
Am Ende des Schuljahres wurde dann das obligate Klassenfoto geschossen. Das Prozedere war immer das gleiche: Wir mussten uns in Reih und Glied im Hof aufstellen, aus dem Turnsaal wurde noch eine Bank herangeschleppt, damit die Kinder in der hinteren Reihe auch sichtbar waren, und der einzige Fotograf in der Umgebung schoss dann die Schwarz-Weiß-Fotos. Sein Name war Anton Bohinc, ein kleiner, hagerer Mann. Er trug eine Brille auf seinem schmalen Gesicht, fast immer auch einen weißen Mantel. Bevor er abdrückte, sorgte seine Frau dafür, dass alle Schüler und Schülerinnen auch ordentlich gekämmt, geschniegelt und geschnäuzt waren. Dafür spuckte sie sich in die Hände, ging durch die Reihen, bügelte die Haare glatt, strich jeden Scheitel gerade, knüpfte die Zöpfe der Mädchen zurecht oder putzte mit dem Taschentuch die Nase. Mit einem Taschentuch die Nasen aller.
Ein weiterer Höhepunkt unseres schulischen Alltags spielte sich immer rund um den 10. Oktober ab, dem Kärntner Landesfeiertag. Am Abend zuvor pilgerte die ganze Schule mit allen Lehrerinnen und Lehrern auf die »Kura« – einen anderen Namen gab es für den Hügel hinter der Schule nicht. Dort hatten die Gemeindearbeiter schon einen riesigen Haufen aus Ästen, Zweigen und Kartons hergerichtet, um den herum wir uns alle aufstellten. Der Direktor hielt eine Ansprache, die im Wesentlichen so verlief:
»Kinder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen ganz besonderen Tag in der Kärntner Geschichte zu begehen. Am 10. Oktober 1920 stimmte die Mehrheit der Kärntner (damals gab es noch kein Binnen-I) dafür, dass unser schönes Heimatland bei Österreich verblieben ist.
Dass es überhaupt dazu gekommen ist, haben wir den Abwehrkämpfern zu verdanken, die ihr Blut dafür hergegeben haben, dass Kärnten nicht Teil des damaligen jugoslawischen Reiches geworden ist. Ihnen allen sind wir heute zu großem Dank verpflichtet …«
Ein runder Feiertag, wie etwa der 40. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung, wurde groß begangen. Dann stellten sich Schüler, Lehrer, der Gesangsverein, die Feuerwehr und zahlreiche Gäste im Schulhof auf und ließen Abwehrkämpfer zu Wort kommen.
Danach wurden einzelne Schüler und Schülerinnen nach vorne gebeten, um jeweils ein – meist patriotisches – Gedicht aufzusagen. Schließlich sangen wir gemeinsam das Kärntner Heimatlied, wobei vor allem die vierte Strophe hervorsticht:
»Wo Mannesmut und Frauentreu,
die Heimat sich erstritt auf neu,
Wo man mit Blut die Grenze schrieb
Und frei in Not und Tod verblieb;
Hell jubelnd klingt’s zur Bergwand
Das ist mein herrlich’ Heimatland.«
Und alle sangen mit, auch die Kinder, die zuhause gar keine andere Sprache als Slowenisch hörten. Davon gab es zumindest in den 1950er Jahren noch viele. In manchen Häusern wurde fast ausschließlich Slowenisch oder jedenfalls ein Dialekt davon gesprochen. Das war auch für meinen Vater bei der Behandlung der Patienten eine Herausforderung. Als Wiener aus gut bürgerlichem Haus konnte er zwar Englisch, Französisch und Latein (er war stolz darauf, sich mit einem Bischof im jugoslawischen Split einmal in dieser »toten Sprache« unterhalten zu haben), aber nicht Slowenisch. Einen Ausdruck hatte er sich aber sehr schnell eingeprägt: »Drei Mal am Tag« (wenn es um das Einnehmen von Tabletten ging) heißt »tri krat na dan« auf Slowenisch. Selbst ich hatte das bei den gemeinsamen Patientenbesuchen so oft aufgeschnappt, dass es sich in mein Gedächtnis eingeprägt hatte. Ebenso alles, was mit der katholischen Messe verbunden war. Wir gingen jeden Sonntag in die Kirche, für meinen Vater gab es rechts vorne – auf der Männerseite – immer einen einzelnen Sessel, der freigehalten wurde. Die Kirchgänger hatten sich auch daran gewöhnt, dass er meist erst nach oder gerade während der Predigt erschien, denn die wurde – wie die gesamte Messe – auf Slowenisch gehalten. Das »Vater Unser« (»Očenaškaterisinebesi…«) habe ich auch so oft gehört, dass es mir eine Basis für das Verständnis einer slawischen Sprache gab, auch wenn es lange brauchte, bis ich wusste, dass »Oče« Vater und »naš« unser heißt und wo diese unendliche und für mich unverständliche Buchstabenwurst getrennt gehört.
Die »Kura«, von der schon die Rede war, gehörte zu unserem winterlichen »Naherholungsgebiet«, im Sommer hatten wir zusätzlich den Klopeiner See vor unserer Haustür. Wenn es genug Schnee gab – und ich kann mich an keinen Winter erinnern, in dem es das nicht der Fall war –, zogen wir unseren Schlitten oder nahmen die Skier und schossen auf der »Kura« den Hügel hinunter. Das heißt, die anderen »schossen«, ich war immer ein Angsthase, mir war alles zu steil, mit dem Schlitten ging es gerade noch, aber beim Skifahren konnte ich mit den anderen Buben nie mithalten. Sicherheitsbindung oder dergleichen gab es auch nicht, sie ging mir auch nicht ab, niemand kannte das damals. Nein, man fuhr mit den »Goiserern« (heute würde man sagen: eine Art Wanderschuhe) in zwei auf dem Kopf stehende V-förmige Eisenteile am Ski, schob einen dicken Draht hinten über den vorstehenden Absatz und spannte das ganze dann vorne mit einem Hebel fest. Die Skier waren aus Holz, ohne Kanten, wenn man stürzte, blieb man in der Bindung hängen und konnte nur hoffen, dass alle Knochen heil geblieben waren.
Wenn wir in der warmen Jahreszeit zuhause blieben, spielten wir am Nachmittag meist im Hof. Die großen Holzzaun-Türen, die die Einfahrt abschlossen, aber ohnehin meist offen standen, wurden zu einer Drehfahrt umfunktioniert: Ein Flügel wurde ganz weit geöffnet, dann stellten wir uns abwechselnd mit einem Bein auf die untere Querleiste und schoben mit dem anderen an – mit dem Schwung erreichten wir mühelos eine 180-Grad-Drehung. Die Mädchen spielten meist mit dem Ball. Fangen spielen war zu langweilig, also »peppelten« sie den Ball gegen die Wand, nach jeweils fünf oder zehn Schlägen wurde es schwieriger: die Hand über Kreuz vor der Brust, oder die Hand durch das Bein, oder sich einmal umdrehen – doch immer den Ball gegen die Wand schlagen. Gemeinsam trafen wir uns auch oft zum »Schlatzkugel«-Spielen. Noch bevor Murmeln aus Ton oder noch später aus Glas auftauchten, drehten wir unsere selbst zwischen zwei Handflächen aus Erde und Spucke. Mit dem Schuhabsatz trieben wir ein Loch in den Boden und schon waren wir damit beschäftigt, die Kugeln in die Senke zu befördern. Und dann gab es noch die selbstgebastelten Panzer: In eine hölzerne Zwirnspule schnitzten wir Kerben ein, von einer dickeren Kerze wurde eine zirka einen halben Zentimeter starke Scheibe abgeschnitten (jede zweite zerbrach in mehrere Stücke, bis wir herausgefunden hatten, dass wir die Schneide des Messers möglichst heiß machen mussten), durch das Loch der Spule fädelten wir ein dickes Gummiband. Vor das Kerzenstück kam noch ein kleiner Stab, der sowohl zum Aufziehen als auch zum Vortrieb verwendet wurde. Die Kerze bewirkte, dass die Rolle nicht davonschoss, sondern sich ganz langsam vorwärtsbewegte und über so manches Hindernis kletterte.
* * *
Für gemeinsame Urlaubsreisen mit den Eltern gab es kaum Zeit und Gelegenheit. Im Sommer waren sie mit den vielen (kranken) Gästen voll beschäftigt, und in der übrigen Jahreszeit war immer zumindest eines von uns Kindern in der Schule. Lediglich einmal – es dürfte in der letzten Ferienwoche gewesen sein – besuchten wir gemeinsam Venedig.
Das erste Mal am Meer, die ungewöhnliche Luft, der Strand und der Sand am Lido hatten es uns Kindern besonders angetan. Wir hatten uns im »Albergo San Fantin« einquartiert, einem kleinen Hotel in der Stadt mit einem Durchgang, der mitten durch das Gebäude ging. Unser Zimmer war über diesem »Tunnel« und so kamen wir auf die Idee, einen Zettel auf einem Faden runterhängen zu lassen, auf dem wir »Buona notte« (eine der wenigen italienischen Phrasen, die wir kannten) geschrieben hatten. Es war schon dunkel, der Faden war kaum zu sehen, nur der helle Zettel. Wenn jemand von den Spaziergängern nach dem Papier greifen wollten, zogen wir schnell daran und – husch – war die Notiz verschwunden. Wir freuten uns diebisch, wenn die Leute dann verärgert nach oben blickten, aber niemanden sahen, denn wir hatten uns längst vom Fensterbrett entfernt.