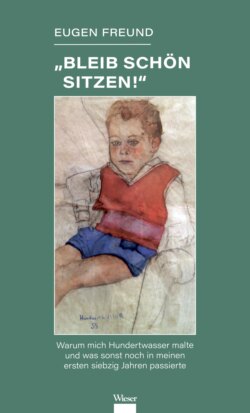Читать книгу "Bleib schön sitzen!" - Eugen Freund - Страница 9
Sommer am Klopeiner See
ОглавлениеViele Tage im Sommer verbrachten wir am Klopeiner See. Von zuhause führte ein kleiner Waldweg an einem Bach entlang direkt zum Bad. Ziemlich zentral stand dort das Hotel »Obir«, ein großer Kasten mit vielen Balkons. Herr und Frau Wutte führten das Hotel und kümmerten sich auch um das Strandbad. Sohn Walter fiel – vor allem mir – durch seine ausgefallene Autoauswahl auf. An den Studebaker »Golden Hawk« kann ich mich gut erinnern – niemand hatte damals so einen Straßenkreuzer mit der großen Schnauze und den noch viel auffälligeren Heckflossen. Er war auch der Erste, der sich kurz nach dessen Debüt auf dem Genfer Autosalon 1963 einen Mercedes 230 SL besorgte. Das war jener Sportwagen mit dem Pagodendach und einem querstehenden Rücksitz (für ein weiteres Paar Beine wäre hinter dem Fahrer kein Platz gewesen). Am Abend arbeitete Walter auch hinter der Theke, wenn »Andy Müller und sein Orchester« groß aufspielten. Die Band kam aus Graz (wie – unterhaltungsmäßig – armselig wäre der Klopeiner See gewesen, hätten die Steirer hier nicht ausgeholfen …), spielte zuerst zum Fünf-Uhr-Tee und am Abend von acht bis Mitternacht. Der Saal war voll, in erster Linie deutsche, aber auch holländische und dann natürlich österreichische Urlauber, die jeden Spaß mitmachten – oder das, was Andy Müller darunter verstand. Da mussten zum Beispiel männliche Freiwillige einen Luftballon aufblasen, während sie weibliche Freiwillige unter den Achseln kitzelten. Sehr groß wurden die Ballons nicht. Doch die meisten kamen zum Tanzen und wohl auch zum Schunkeln, kein Abend verging, ohne dass die gut aufgelegten Gäste nicht zu Jetzt trink mer noch ein Glaserl Wein, oder Bier her, Bier her, oder I fall’ um schunkelten. Höhepunkte der Saison waren die Auftritte von Fred Haid, auch ein Steirer, der zwei Mal im Sommer mit Schmachtfetzen aus Oper und Operette die Touristen begeisterte.
Nicht, dass mir das Baden mehr Spaß machte als das Skifahren. Dass ich im Wasser nicht weniger Angst hatte als im Schnee, hing auch mit dem Schwimmlehrer zusammen. Er hieß Egon Karpf – und schrammte mit seinem Namen nur knapp an jenem Fisch vorbei, von dem man im Klopeiner See viele stolze Exemplare sah. Er war ein immer tief braun gebrannter, drahtiger Turnlehrer aus einem Gymnasium in Graz (das bestätigt wieder meine These, dass der Klopeiner See ein langweiliges Kaff geblieben wäre, hätten die Steirer nicht ausgeholfen), der jeden Sommer seinen Zöglingen – je nach Mentalität – das Schwimmen oder das Fürchten lehrte. Bei mir war es eher Letzteres, denn schon die erste Stunde begann damit, dass er mich einfach ins (für mich kalte) Wasser warf. Natürlich war er nicht weit von meinem Strampeln und Schreien entfernt und fischte mich auch gleich heraus, doch der Schaden war angerichtet. Ich lernte zwar Schwimmen – wie hätte ich mich auch dagegen wehren können – aber Spaß machte es mir nie. Wenn wir zum Schwimmen gingen, musste meine ältere Schwester immer auf uns Jüngere aufpassen. Ich war kein Problem, erinnert sie sich, denn ich war ohnehin wasserscheu. Aber Claudia (oder Buscha, wie wir sie alle nannten) konnte gar nicht genug bekommen. Sie war aus dem Wasser kaum herauszuholen. Ich sehe sie noch vor mir, mit blauen Lippen, am ganzen Körper zitternd – aber mit keinem Argument aus dem Wasser zu holen. Selbst als ihr Silvia einmal ein Eis brachte und es ihr hinstreckte, in der Hoffnung, sie könnte sie wie einen Hund locken, war Buscha schneller: Sie riss Silvia das Eis aus der Hand und schleckte es im Wasser weiter.
Einige Jahre später bekamen wir dann mit, dass der Herr Professor sich eine junge Urlauberin angelacht hatte, sehr zum Missfallen seiner Frau, die diesen Seitensprung von ihrem Liegestuhl am Strand wohl mitbekommen hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass das ohnehin jeden Sommer passierte, aber wir noch zu jung waren, um das wahrzunehmen …
Die Urlauber – viele waren Stammgäste und kamen Jahr für Jahr wieder – wurden von uns gelegentlich beurteilt oder auch mit irgendwelchen herablassenden Prädikaten versehen. »Speibkübel« war zum Beispiel ein kleines, dünnes Mädchen, das jedes Jahr im Strandbad des »Hotel Obir« auftauchte. Ich habe heute (und wahrscheinlich auch schon damals) keine Ahnung, wie sie dieses Attribut verdient hatte. Wir machten uns auch über das »Muttersöhnchen« lustig, einen Wiener Teenager, der regelmäßig mit seiner Mutter auf Urlaub kam. Man sah die beiden ständig zusammen, keiner machte einen Schritt allein. Viele Jahre danach traf ich ihn zufällig in Wien auf der Kärntner Straße. Ich sprach ihn an und er erzählte, dass er nun Mittelschullehrer sei, später wurde er sogar Direktor eines Gymnasiums. Von unserer Abqualifizierung als »Muttersöhnchen« erzählte ich ihm freilich nichts.
Neben dem »Hotel Obir«, wo wir als Kleinkinder schwimmen gingen, war dann die »Gabriela Diele« der nächste regelmäßige Besuchsort. Diese Bar gehörte zum »Kärntner Hof«, einem alteingesessenen Hotel. Benannt war die »Diele« (ein Kaffeehaus tagsüber mit Theke, Barhockern und ein paar kleinen Tischen, eine Bar in der Nacht), nach der Tochter des Hauses, die in die gleiche Klasse ging wie ich. Das Hotel, geführt von »Jultschi« Kruschitz (dass der Mann in Wirklichkeit Julius hieß, bemerkte ich erst an seinem Grabstein), war ein beliebter Treffpunkt für die Wiener »Hautevolee«: Juweliere, Ärzte, Richter waren damals Stammgäste. Sie kamen jedes Jahr, blieben drei bis vier Wochen und organisierten gegen Ende ihres Aufenthaltes zur Freude aller Sommergäste ein großes Feuerwerk am See. Mein Vater trug in seinem Notizbuch sogar die Namen der edlen Spender ein: »Heute Abend Privatfeuerwerk, gespendet von den Herren Netolitzka, Dr. Mihokovicz, Dr. Adamovich«. Für ihn, der ja 1951 aus der Bundeshauptstadt aufs Land gezogen war, und damit all seine Freunde und Bekannten mit einem Schlag verloren hatte, kam das einem Eintauchen in seine Welt von gestern gleich. Wir waren da selten dabei, vieles spielte sich zu einer Zeit ab, als wir schon längst im Bett lagen und mein Vater die Visiten erledigt hatte. Dann saßen er, meine Mutter und Gerda und Felix Schwarz, Theo Rebernig (der Sohn des Schuldirektors) und Fritz Wintschnig (beide begehrte Junggesellen des Ortes) bis spät in die Nacht bei Toastbrot und alkoholischen Getränken an der Bar. Einige der Gäste aus Wien wurden im Laufe der Jahre auch Freunde der Familie. In den kälteren Monaten verlagerte sich das Nachtleben (minus der Sommergäste) in die Bar von Gerd und Christa Rabl im Ort neben der Kirche. Im Postgebäude hatten sie einen kleinen Raum mit einer Theke ausgestattet, Platz war nur für ein paar Leute, und zum Essen gab es außer einem Schinken-Käse-Toast kaum etwas anderes. Dafür war die Bar mit alkoholischen Getränken bestens ausgestattet, was meine Eltern auch zu schätzen wussten.
Eine weitere »Klopeinerin« wurde dort auch immer gern gesehen, denn in der Hauptsaison hatte sie absolut keine Zeit, ihr Haus zu verlassen. »Fini Holzer«, auch »Fräulein Holzer« genannt, hatte mit dem »Hotel Amerika« alle Hände voll zu tun. Die Unterkunft hatte ihren Namen von den Gästen auf der gegenüberliegenden Seite des Sees bekommen. Die schwammen gerne hinüber – nach Amerika – um sich dort am flachen Strand auszurasten. Ihre Eltern hatten schon in den 1930er Jahren ein Grundstück am Klopeiner See erworben und die »Fini« wurde – wie sie mir einmal erzählte – »zu ihrem Leidwesen« an die Badekasse gesetzt. Als sie einmal diesen Platz an der Badekasse verließ, um mit ihren Freundinnen zu spielen, bekam das ihre Mutter, die in der Küche war, mit. Wütend lief sie ihr mit voller Kleidung ins Wasser nach, riss irgendwo einen Strauch aus und warf ihr den Busch samt Wurzeln an den Kopf.
Nach dem Staatsvertrag 1955 kam der Tourismus am Klopeiner See erst richtig in Schwung. Vor allem die deutschen Urlaubsgäste entdeckten diesen wärmsten Alpensee und bevölkerten im Sommer die ganze Region. Und mein Vater sorgte für ihre Gesundheit, oder besser: Wenn sie krank wurden, war er zur Stelle. Von den vielen Stammgästen des »Hotel Amerika« ist mir Professor Rudolf von Laun unvergessen geblieben. Wegen einer schweren Kinderlähmung konnte er sich nur mühsam fortbewegen, aber sobald er sich auf zwei Krücken gestützt über den Holzsteg zum Wasser vorgekämpft hatte, schwamm er wie ein Fisch. Rudolf von Laun war ein hochgebildeter Jurist mit österreichischen Wurzeln: Geboren 1882 in Prag, studierte er in Wien und war als junger Mitarbeiter des Außenamtes Mitglied der Delegation der Friedensverhandlungen von St. Germain. Später übersiedelte er nach Hamburg, wo er drei Mal Rektor der dortigen juridischen Fakultät war (1924–1926 und 1946–1947).
Als meine Eltern einmal nach Hamburg fuhren, lud das Ehepaar sie in eine Vorstellung ins Thalia Theater ein. »In Freundschaft und großer Dankbarkeit« überließ er der Familie Freund das von ihm verfasste Büchlein »Mephistopheles über die Universitäten« (C. Boysen Verlag, Hamburg), eine Faust-Parodie in das 20. Jahrhundert versetzt. Ein kurzer Auszug daraus:
Mephisto:
Fast jeder möchte heut’ studieren
Allein wohin soll denn das führen?
Es würde nimmermehr gelingen
Euch alle wirklich unterzubringen!
Nichts fürchtet heute mehr der Staat,
Als geistiges Proletariat!
Denn um im Staat zu dominieren,
Ist’s leichter, Dumme zu regieren.
Drum wollen wir – nicht Euer Denken,
Nur Eure Zahl – etwas beschränken.
Um freizuhalten die Studenten
Von unerwünschten Elementen.
Doch erst die Frage nun entsteht,
Was wählen Sie für eine Fakultät?«
. . .
Schüler:
Ich möchte gerne Geld verdienen,
Es hat mir aber doch geschienen,
Dass dieses Wissen wenig nützt,
Gerade dem, der nichts besitzt!
Weswegen ich noch fragen muss,
Wie steht es denn nun mit dem Jus?
Rudolf von Laun und seine Frau hielten sich bis in die frühen Siebzigerjahre regelmäßig am Klopeiner See auf. Er starb 1975 im Alter von 93 Jahren in Ahrensburg in Deutschland.
Immer wieder hatte mein Vater (und ich am Nebensitz) bei den Visiten interessante und überraschende Begegnungen. Im Sommer 1964 war er in »Obersammelsdorf bei Tietze und Siebold zur Jause« eingeladen. Mit dabei, so notierte er penibel in seinem Taschenkalender, waren nämlich auch die »Prinzessin von Preußen« und »Prinz Georg von Thurn und Taxis«. Zwei Tage später heißt der Prinz bereits »Gucki« und die Prinzessin wird mit ihrem Vornamen Marie Cecile genauer identifiziert. Eine weitere Eintragung lüftet dann das ganze Geheimnis: Sie ist »die älteste Tochter von Kronprinz Louis Ferdinand« und damit eine Ur-Enkelin des letzten deutschen Kaisers. Der Höhepunkt der adeligen Zusammenkunft fand schließlich am 25. August statt. »Abend Souper bei Krainz: Prinzessin Marie Cecile v. Preußen, Ehepaar u. Klaus Siebold, Frau Tietze m. Tochter Irma und Freundin, Inge, Silvi und ich, nachher noch alle bei Gocki in der Almbar. Strahl. Spätsommer-Wetter.« Obersammelsdorf war damals (und ist bis heute) ein kleiner Bauernort mit einem großen Campingplatz und einer fantastischen Aussicht auf die Steiner Alpen, den Hochobir und den nahe gelegenen Turnersee. Verglichen mit den touristischen Angeboten am Wörther See aber war das jedenfalls ein »Kaff« – wie man heute sagen würde. Das Restaurant Krainz in Unterburg wiederum gehörte tatsächlich zu den besten, die der Klopeiner See zu bieten hatte. Man saß damals im Garten unter herrlichen Kastanienbäumen und hatte einen wunderbaren Blick auf die hinter dem See untergehende Sonne. In der Küche standen Willi, der junge Küchenchef, und seine Eltern, die hervorragend kochten. Die Almbar wiederum war das absolute Gegenteil: eine laute, mit viel Alkohol durchtränkte Disco, aber auch der einzige Platz, in dem man nach dem Abendessen bis tief in den nächsten Morgen noch das machen konnte, wofür heute der Begriff »chillen« verwendet wird.
Davon machten am wenigsten die anderen, meist älteren Sommerurlauber in Unterburg Gebrauch, die sich in der »Villa Luise« und in der »Villa Pohl« eingerichtet hatten. Diese beiden Gebäude gehörten zu den ersten Urlaubsquartieren überhaupt am Klopeiner See, sie wurden vor rund hundert Jahren von Wiener Feriengästen errichtet. Hauptmann Eugen Pohl gilt als Pionier des Erholungsgebietes, schon 1904 kümmerte er sich mit seinem »Verschönerungsverein« um das Wohl der Urlauber. Wollte man zu der nach ihm benannten Pension, musste man erst am Bauernhof der Familie Ferk vorbei. In den späten Fünfzigerjahren konnte es durchaus sein, dass der kleine Janko (der sich später als Richter, viel mehr aber noch als scharfsinniger Beobachter und Schriftsteller einen Namen machte) dort barfuß und nur mit einer kurzen Hose bekleidet im Hof spielte. Für mich waren es aber im Wesentlichen die »alten« Damen aus Wien, die ich immer gerne besuchte. Das heißt, mein Vater besuchte sie als Hausarzt, ich durfte oft mit hinein und dann standen dort meist köstliche Kuchen oder auch »Heller Wiener Zuckerl« auf dem Tisch, an denen ich mich bedienen konnte. Für meinen Vater gab es regelmäßig ein Gläschen Eierlikör. Eine der Damen, Frau Perhauz, hatte es mir besonders angetan, und sie versprach, mich einmal nach Wien einzuladen. Das machte ich dann auch als Zwölfjähriger, in den Weihnachtsferien. Ich durfte mit dem Zug nach Wien fahren! Neben Frau Perhauz kümmerte sich dort auch ein Teil meiner Wiener Verwandten um mich. An zwei Höhepunkte erinnere ich mich gut: Einmal brachte mich Onkel Lukas (der Bruder meines Vaters) zum Flughafen Wien Schwechat, wo ich nicht nur die (wenigen) startenden und landenden Flugzeuge bewunderte, sondern am meisten von den elektrischen Schiebetüren beim Eingang fasziniert war. Wenn man auf den Gummiteppich trat, schoben sich die beiden Flügel automatisch zur Seite – ich weiß nicht, wie oft ich das ausprobieren musste. Ein noch größeres Erlebnis war aber der Besuch des Neujahrskonzertes am 1. Jänner 1960. Es dirigierte damals Willy Boskowsky – wie Johann Strauß als Stehgeiger. Ich saß ganz vorne neben dem Orchester, blickte von dort in den großen Saal des Musikvereins und genoss die Walzer- und Polkaklänge. Bis zum heutigen Tag habe ich dieses einmalige, alljährliche musikalische Ereignis nie versäumt. Gleichgültig, wo ich mich gerade aufhielt, in New York oder in Washington, am. 1. Jänner stand immer das Neujahrskonzert auf meinem Programm. Die Liebe zur klassischen Musik habe ich von meinem Vater geerbt. Das Radio, vor allem das Sonntagskonzert, war ein »Muss« in unserem Haushalt. Ein Plattenspieler, der im Radio eingebaut war, sorgte neben der Klassik für zusätzliche Vielfalt: Helmut Qualtingers »Der Herr Karl« wurde so oft gespielt, dass ich ihn bald auswendig nachsprechen konnte und kann (»Mir brauchen Sie gar nix dazählen, i kenn des. Die Art von G’schäften kenn i schon, weil i war auch amol a junger Mensch, aber damals, das war noch a andre Zeit …«). Meine Mutter sorgte dafür, dass auch sehr Exotisches aus den Lautsprechern schallte: »Missa Luba – Les Troubadours de Roi Bauduin«, ein kongolesischer Chor mit christlicher Kirchenmusik und – ganz als Kontrast dazu – aus den (nicht ganz jugendfreien) Balladen von Francois Villon, übersetzt von H. C. Artmann, gesprochen von Helmut Qualtinger mit Jazz von Fatty George (»… aus an Lavur von ana Hur …«).
Gelegentlich spielte der Vater aber auch am Klavier, das in unseren beengten Räumlichkeiten im Wohnzimmer Platz gefunden hatte. Dass er auch vor so schwierigen Stücken wie Beethovens Sonate »Die Wut über den verlorenen Groschen« nicht zurückschreckte, zeigt auch, dass er über ein ausgesprochenes musikalisches Talent verfügte.