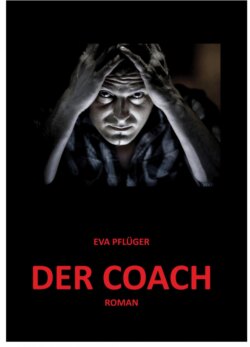Читать книгу Der Coach - Eva Pflüger - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеDer Gedanke einen Menschen getötet zu haben, hat lange Zeit mein Leben bestimmt. Es war mein Zwillingsbruder, den ich umgebracht haben soll, Tatort der Uterus meiner Mutter. Meine Kindheit und Jugend habe ich in der Überzeugung gelebt, dass es besser gewesen wäre, wenn ich mich gleich nach der Geburt wieder von der Welt verabschiedet hätte.
Meine Eltern legten weit mehr Interesse füreinander an den Tag als für mich, das ungebetene Ergebnis ihrer symbiotischen Beziehung. Um es auf den Punkt zu bringen: nachdem ich nun mal da war, hat man mich groß gezogen.
Meine Mutter hatte nicht den Hauch einer Ahnung, welche Schuld sie ihrem Sohn in den Kinderrucksack packte, als sie auf Familienfesten oder im Kreis der Freunde mit Begeisterung die immer gleiche Geschichte erzählte. Ich sei so wild entschlossen gewesen, als erster auf die Welt zu kommen, dass ich meinen hinter mir wartenden Bruder tot getrampelt haben müsse. Genau so drückte sie sich aus, pflegte an dieser Stelle amüsiert zu lächeln und hinzuzufügen, der andere Junge habe jedenfalls nicht mehr gelebt, als er ans Licht kam.
Ich habe meine Mutter dafür gehasst. Sie weiß nichts von meinen Qualen. Meine Gefühle prallen an ihr ab wie ein Wasserstrahl an einer Plastikplane. Ich habe eine Menge Zeit und Geld in Therapien investiert, bis ich meiner Mutter verzeihen konnte. Trotz allem kümmere ich mich um sie, besuche sie jeden zweiten Montag und, wenn ich es nicht vergesse, auch an ihrem Geburtstag. Vor diesen Ritualen drücke ich mich nur selten. Wenn ich die Wohnung in Berlin Charlottenburg betrete, in der ich aufgewachsen bin und in der meine Mutter noch heute, nach dem Tod meines Vaters, lebt, gebe ich mir Mühe, die Gedanken zu verbannen, die wie kleine kalte Fische durch meinen Kopf huschen und die mich bei jedem Besuch den Erlös berechnen lassen, den ich eines Tages mit dem Verkauf der elterlichen Wohnung erzielen werde.
Mein Name ist Leo Kafka. Ich will gleich an dieser Stelle anmerken, dass ich keine Ahnung habe, ob ich verwandt bin mit dem berühmten Schriftsteller. Eine Antwort auf diese Frage zu suchen ist nicht meine Absicht. Das hängt damit zusammen, dass ein Archivar und Spezialist für mittelalterliche Geschichte mir an der Theke einer Kneipe in Berlin Mitte ein Geheimnis verraten hat. Menschen, die unbedingt wissen wollen, wo sie herkommen und deshalb die Erforschung ihrer Ahnenreihe in Auftrag geben, würden in Insiderkreisen, also bei den Archivaren, als Geschlechtskranke bezeichnet. Er schien sich dabei köstlich zu amüsieren. Hätte ich jemals den Plan gehabt, in dieser Richtung tätig zu werden, jetzt war das Thema endgültig vom Tisch.
Meinen Lebensunterhalt verdiene ich als Coach. Die Arbeit mit Menschen, die das Bedürfnis oder den Auftrag haben, an ihren Potenzialen zu arbeiten und sich beruflich und persönlich zu entwickeln, gibt mir das Gefühl in meinem Leben etwas Sinnvolles zu leisten. Die Mischung aus Dankbarkeit, Respekt und Achtung, die nahezu alle Klienten mir am Ende der gemeinsamen Arbeit entgegen bringen, erfüllt mich mit einer widersprüchlichen Mischung aus Demut und Stolz. Ich habe gelernt mich auch über kleine Erfolge zu freuen, mit denen ich weder Revolutionen auslöse noch sonst irgendwie die ganze Welt verändere. Basis meiner Arbeit ist die tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch als biologisches, soziales und geistiges Wesen für sein eigenes Denken, Handeln und Fühlen Verantwortung trägt; dass jeder ein grundlegendes Recht auf die Entwicklung eigener Ziele und Werte besitzt; dass zu einem erfüllten Leben der wechselseitige Anspruch auf Achtung, Wertschätzung und Respekt gehört.
Im Laufe von 15 Jahren habe ich es in meiner Profession zu einigem Ansehen gebracht. Heute kann ich mir alles leisten, was für mich zu einem komfortablen Leben gehört und meiner Vorstellung von Luxus entspricht. Meine großzügige Altbauwohnung in Berlin Mitte habe ich mit wenigen wertvollen und einigen bequemen Möbeln ausgestattet. Hier arbeite ich auch mit meinen Klienten. Der Anblick des Jaguar E Type Cabrio vor der Tür meines Mietshauses erfüllt mich jedes Mal mit postpubertärer Freude und einem schlechten Gewissen. In dieser Reihenfolge. Ich räume ein, dass meine Freude überwiegt. Und ich gebe zu, dass ihr manchmal eine Konnotation von Genugtuung beiwohnt. Nicht gegenüber konkreten Personen oder Ereignissen. Es ist eher ein diffuses Gefühl in Bezug auf meine nicht immer ruhmreiche Vergangenheit. Würde ich den Spießer in mir zu Wort kommen lassen, könnte ich sagen, dass ich es geschafft habe.
Tage wie dieser, es ist ein später Freitagnachmittag im Frühling 2011, und die Tatsache, dass ich alleine bin, keine Termine mehr wahrzunehmen habe, sind wie geschaffen für frei mäandernde Gedanken. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und betrachte, die Füße auf dem antiken Schreibtisch, die Kulisse vor dem Fenster. Gepflegte Altbauten unter einem grauen Deckel aus Regenwolken über Berlin. Mein bisheriges Leben oder Teile davon Revue passieren zu lassen ist wie der Blick durch ein Kaleidoskop, in dem ich eine atemberaubende Folge von bunten Mustern, Scheiternsszenarien und Erfolgen, beobachten kann.
Noch einige Jahre nach der Studentenzeit legte ich missionarischen Eifer an den Tag, wenn es darum ging, an den Grundfesten der bürgerlichen Gesellschaft zu rütteln. Als einer der Höhepunkte meiner Aktivitäten zur Bekämpfung des Klassenfeindes auf den Straßen Westberlins ist mir meine Faust in gefährlicher Nähe eines Polizisten in Erinnerung. Die Aktion brachte mir eine Nacht im Knast ein. Eine klaustrophobische Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Ebenso wenig wie das denkwürdige Ereignis auf dem Dach eines Hauses in Tanger, wo ich nach meinem Examen auf einer ausgedehnten Tour durch Europa und Nordafrika gelandet war. Am Rand des Daches stehend blickte ich in die Tiefe und breitete die Arme aus, nicht um meinem Leben ein Ende zu setzen, sondern weil ich so komplett zugekifft war, dass ich glaubte fliegen zu können. Ebenso deutlich habe ich eine meiner Berliner LSD-Halluzinationen in den 70er Jahren vor Augen, als ich mich aus dem Fenster meines WG-Zimmers lehnte und fasziniert beobachtete, wie die einzelnen Steine des unter mir liegenden Kopfsteinpflasters abwechselnd aufleuchteten und zu tanzen begannen.
Nach meinem Studium startete ich eine Achterbahnfahrt durch verschiedene Jobs in Forschungsinstituten und sozialen Einrichtungen. Brotlose Engagements in politischen Think Tanks wechselten mit Zeiten der Arbeitslosigkeit. Eine Karriere als Taxifahrer habe ich in meiner Biographie ebenfalls aufzuweisen. Von der Erfahrung zehre ich noch heute. In Berlin, zumindest im westlichen Teil der Stadt kenne ich jeden Winkel. Ich glaube auch, dass diese Zeit, in der ich Menschen aller sozialen Schichten und in vielen Stadien des Glücks und der Verzweiflung begegnet bin, in mir die unersättliche Neugier geweckt hat auf das was hinter den Fassaden an Faszinierendem, Liebenswertem, Überraschendem und Abgründigem zu sehen ist.
Das graue Einerlei des Tages ist einer tristen Dämmerung gewichen. Es regnet, mir ist kalt, ich schließe das Fenster. Auf der anderen Straßenseite stößt ein Hüne mit einer Hand einen Kinderwagen der Tausend-Euro-Variante vor sich her, der jedes Mal ein paar Meter unkontrolliert an der Bordsteinkante entlang rollt. Mit dem anderen Arm zerhackt der Mann die Luft um sich herum. Was er zu verkünden hat, gilt offensichtlich der Frau, die ihm mit einigen Schritten Abstand folgt. Außer ihr ist niemand in der Nähe. Ich kann seine Worte nicht verstehen, aber die mühsam verdeckte Aggression, die dieser Mensch ausstrahlt, spüre ich noch hinter geschlossenen Fenstern.
Die Aussicht auf ein entspanntes Wochenende mit einem Treffen meiner Pokerfreunde ist leicht getrübt durch zwei Herausforderungen, die am folgenden Montag auf mich warten. Die eine ist der Besuch bei meiner Mutter.