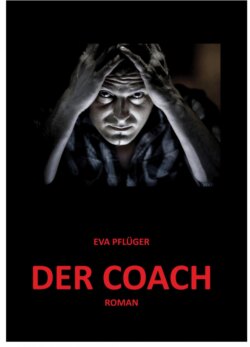Читать книгу Der Coach - Eva Pflüger - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
Оглавление„Ich werde dir fehlen.“
Mit geschlossenen Augen sitze ich in meinem Arbeitszimmer. Denke über diesen Satz nach. Ich bin sicher, ihn schon einmal gehört zu haben. Wahrscheinlich ein Zitat aus einem Film.
Mit diesem Spruch hat Martha sich in der vergangenen Nacht von mir verabschiedet, um mich wieder einmal zu verlassen. Nicht für immer. Sie nimmt eine Auszeit von zwei oder drei Monaten, das hat sie schon öfter getan. Martha und ich sind ein Paar, seit mehr als zehn Jahren. Für uns beide die längste Beziehung, die wir je hatten. Vielleicht auch die beste. Wir haben gelernt zu akzeptieren, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse gelebt und respektiert werden müssen, wenn wir ein Paar bleiben wollen. Genauer gesagt, hat Martha es gelernt. Ich habe schon immer nach meinen Vorstellungen gelebt.
Marthas Leidenschaft für ausgedehnte Reisen teile ich nicht. Wie ich meine Auszeiten gestalte, löst bei meiner Gefährtin resigniertes Kopfschütteln aus. Manchmal auch Besorgnis, sagt sie. Ich kann wochenlang hinter Bergen von Büchern verschwinden. Wenn ich wieder auftauche, verfüge ich über mehrere grob skizzierte Entwürfe für neue Beratungskonzepte, die ich dann eine Zeit lang für ebenso genial wie umsatzträchtig halte. Einige dieser Ideen setze ich um. Andere landen in der Bibliothek der nicht realisierten Visionen und ungelebten Träume, die ich in meinem Kopf eingerichtet habe. Dort werden auch die Vorsätze für einen gesünderen Lebensstil gesammelt, die ich von Zeit zu Zeit gerne fasse. Sie sind zahlreich und meistens folgenlos.
Es stimmt, Martha wird mir fehlen. Das leere Gefühl in mir kenne ich schon. Ich weiß, dass es vorübergehen wird. Nicht zum ersten Mal konnte ich mich nicht entschließen, meine Arbeit liegen zu lassen und Martha wenigstens bei einem Teil ihrer Reise zu begleiten. Der Vorstellung, mit ihr die Welt zu entdecken, kann ich durchaus etwas abgewinnen. Aber ich mache es dann doch nicht. Das hat im Laufe unserer Beziehung immer wieder zu größeren Verwerfungen geführt. Geändert hat das nichts, wir sind noch immer zusammen und Martha reist meistens allein. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Das legt sich, wenn ich wieder in meine Arbeit eintauche.
In den Häusern auf der anderen Seite der Straße gehen die Lichter an. Es war mir entgangen, dass ich in der Dunkelheit sitze. Ein Glas Rotwein ist jetzt angesagt. Auf dem Weg in die Küche, vorbei an dem großen Spiegel in der Diele, begegnet mir ein Kerl mit grauen Bartstoppeln, ungekämmten Haaren, leicht kollabierter Haltung, in ausgebeulten Jogginghosen und fleckigem Sweatshirt. Zu allem Überfluss habe ich vergessen zu duschen. Aber egal, mit Gästen ist heute nicht zu rechnen, jedenfalls nicht ohne Vorwarnung.
Auf dem alten Holztisch in der Küche liegt ein seidig glänzender Morgenmantel und verbreitet einen Hauch von Martha. Ihre Abschiedsbotschaft. Hier bewirte ich meine wenigen Freunde mit aufwändig zubereiteten Menüs und guten Weinen. Aus zwei ehemals kleineren Zimmern hat der Eigentümer der Wohnung eine Küche gestaltet, in der sich jeder ambitionierte Freizeitkoch ungehindert austoben kann. Daher fühlen sich auch meine Freunde, die sich um den großen Tisch versammeln, nicht gestört von dem Chaos, dass ich bei meinen Kochorgien produziere. So kurz nach Marthas Abreise ist der Raum beklemmend leer. Ich habe keine Lust, mich länger an diesem Ort aufzuhalten. Mit einem sardischen Rotwein, den wir am Vorabend zu zwei Dritteln geleert haben, und einem Hauch von Marthas Duft kehre ich zurück an meinen Schreibtisch. Vorbei an dem Typen mit den depressiven Falten im Gesicht, der in der Diele auf mich gewartet hat.
Was ist los mit mir heute? Ich hatte mich in der Absicht, die kommende Woche zu planen, in mein Arbeitszimmer begeben. Der Monitor auf dem Schreibtisch glotzt mich mit seinem kalten schwarzen Auge an.
Is’ was, Doc?
Der Kultfilm aus den 70ern mit der bezaubernden Szene, in der Barbra Streisand dem ebenso liebenswürdigen wie schusseligen Musikprofessor Elmer Fudd mitteilt „Ich werde Dir fehlen!“ Mindestens fünfmal gesehen, zweimal mit Martha. Mir wird heiß bei der Erinnerung an den fulminanten Abschied, den Martha uns in der vergangenen Nacht bereitet hat. Bücher, Papiere, CDs, die ihr im Weg waren, hatte sie von dem schwarz lackierten antiken Schreibtisch gewischt. Alles lag auch jetzt noch verstreut auf dem Boden des Arbeitszimmers. Ein Sakrileg, es handelt sich schließlich um meine Arbeitsunterlagen. Ich war nicht fähig gewesen zu protestieren angesichts dessen was mich erwartete. Die einladende Bewegung, mit der Martha den leer gefegten Platz eingenommen hatte, gehört zu einer perfekten Inszenierung, die auch nach Jahren nichts von ihrer Faszination verloren hat. Beim ersten Mal hatte Martha erklärt, dies sei ihre einzige Chance, wenigstens für einige Minuten auf Platz Eins der Liste mit den wichtigsten Dingen in meinem Leben zu stehen, noch vor meinem Arbeitsplatz. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber Martha glaubt fest daran und mir gefällt das Spiel.
Mit meinem Leben bin ich so zufrieden wie man es mit 58 Jahren und ohne Familie nur sein kann. Die paar Kilo zu viel, die bei meiner Größe nicht sonderlich auffallen, bewege ich mit großer Gelassenheit durch meine Welt. Auf andere wirkt das Tempo entweder beruhigend oder provozierend, das hängt vom jeweiligen Kontext ab. Die Frage eines Freundes, wie ich es schaffe, ständig den Eindruck zu erwecken, als wandle ich durch den Kreuzgang eines Klosters, während um mich herum das Leben tobt, kann ich nicht beantworten. Mein Tempo war immer schon so, egal ob ich mich morgens aus dem Bett quäle oder Gefahr laufe einen Zug zu verpassen.
Für gewöhnlich werde ich 10 Jahre jünger geschätzt. Außer dass es mein Ego bedient, bestärkt es mich darin, an der inzwischen weiß gewordenen Mähne im Trend der 70er Jahre festzuhalten. Die Haare in Hemdkragenlänge zu tragen ist aus der Mode, das ist mir bekannt. Und es ist mir gleichgültig. Es ist mir ebenso egal wie das Diktat der jeweils aktuellen Männermode oder der Kleiderordnung der Organisationen, in denen ich mein Geld verdiene. Es sind diese winzigen Nischen, die ich nutze, um einen Rest von Rebellion gegen das Diktat bürgerlicher Konventionen leben zu können.
Mir fällt ein Erlebnis aus den Anfängen meiner Karriere als Coach ein, das ich hin und wieder nach dem Genuss von Rotwein auch in Gesellschaft zum Besten gebe; aus der Reaktion der Zuhörer schließe ich, dass es einigen Unterhaltungswert hat. Damals hat der Vorfall für ein paar Stunden meine schwer zu erschütternde Balance gestört. Ein börsennotiertes Unternehmen war auf der Suche nach Coaches für sein Topmanagement und man hatte mich zu einem Probecoaching vor Publikum eingeladen. Das kam mir ungefähr so vor, als fordere ein einfallsloser Personalchef die erfahrene Bewerberin für einen Posten im Chefsekretariat auf, sich zu Testzwecken dem Diktat eines Geschäftsbriefes zu stellen. Ich war in meinem Lieblingsoutfit erschienen, schwarzer Anzug, schwarzes T-Shirt, eher eine Verkleidung, die Werbeleute als Erkennungszeichen für sich beanspruchen, aber ich fühle mich wohl darin, auch wenn ich nicht zu dieser Spezies gehöre. Die eleganten schwarzen Schnürschuhe waren mein Zugeständnis an die Zwänge der Businessmode. Sie sahen an diesem, und ich fürchte auch an jedem anderen Tag in meinem Leben aus, als habe ich in aller Eile versucht, ihnen mit Papiertaschentuch und Spucke zu etwas Glanz zu verhelfen. Meinen Schuhschrank füllt eine ganze Armada von bequemen Tretern. Nur die Tatsache, dass derartiges Schuhwerk bei meiner Klientel als Karrierebremse gilt, hält mich davon ab, auch bei geschäftlichen Anlässen die bequeme Variante zu wählen.
Zurück zu der Anekdote aus meinen Anfängen als Coach. Das Vorturnen vor den Managern des Daxunternehmens war hervorragend gelaufen. Noch nach Jahren erinnere ich mich an die sechs fahlgrauen Einreiher und die farbenfrohe Kopie eines Chanelkostüms auf langen Beinen, die mir als Coach allesamt hohe Kompetenz attestierten und daher umso mehr bedauerten, dass ich dem Topmanagement nicht zu vermitteln sei. Ich müsse verstehen, das lässige Outfit, die fehlende Krawatte. Mein Verständnis hatte sich in Grenzen gehalten. Hätte man mich um meine Einschätzung gebeten, was natürlich niemand tat, hätte ich die versammelten Leistungsträger darüber aufgeklärt, dass ich ihre Begründung für außerordentlich inkompetent hielt. Sie hatten den aufflackernden Zorn in meinen Augen nicht wahrgenommen, während ich jenes Haifischgrinsen erwiderte, das mir von der anderen Seite des Tisches entgegen blitzte und das ich so sehr verabscheute. Mit aufreizend langsamen Bewegungen hatte ich meine Papiere eingesammelt, in die Innentasche meines Mantels gestopft und den Saal mit ein paar höflichen Floskeln zum Abschied verlassen.
Während meine Gedanken an diesem Freitagabend weiter ungeordnet durch mein Hirn kreisen, muss ich, ohne es registriert zu haben, die Schreibtischlampe eingeschaltet, den Computer hochgefahren und Outlook gestartet haben. Außerdem ist die Rotweinflasche leer. Ich brauche Nachschub und etwas zu essen. Schlurfe wieder in die Küche und prüfe meine beachtlichen Weinbestände. Ich entscheide mich für einen Tempranillo, belade einen Teller mit Baguette und Käse sowie einem geschälten Apfel als Zugeständnis an eine wenigstens ansatzweise ausgewogene Ernährung.
Das alles trage ich zu meinem Schreibtisch, auf dem das gleiche Chaos herrscht wie augenblicklich in meinem Kopf. Der neugierige Betrachter kann unter der beständig wachsenden Papierflut die ganze Pracht des edlen, drei Meter breiten Empiremöbels nur erahnen. Das Chaos ist Ausdruck meiner unbezähmbaren Sucht, alles wissen und verstehen zu wollen. Besser zu sein als alle anderen.
Ein Blick auf den Outlook-Kalender lässt meine Befürchtung zur Gewissheit werden. Auf das Wochenende folgt wieder mal ein Montagnachmittag mit Mutter. Den Abend werde ich dann damit verbringen, den Abschlussreport für einen Klienten zu schreiben. Ich erinnere mich noch sehr präzise an dessen ersten Auftritt, obwohl seitdem mehr als 18 Monate vergangen sind.
Ein stark übergewichtiger Mann war mit raumgreifenden, zu allem entschlossenen Managerschritten, die vermutlich Entscheidungsfreude und Führungsanspruch signalisieren sollten, in meine Wohnung gestürmt. Obwohl er den Fahrstuhl in das dritte Obergeschoss genommen hatte, stand er nach Luft japsend vor mir. Er hatte sich telefonisch zu einem Vorgespräch angemeldet und teilte mir ohne Umwege über höfliche Konversation und mit seiner Kurzatmigkeit ringend mit, was der Grund seines Besuches sei. Er wolle seinen nächsten Karriereschritt in Angriff nehmen, wie er sich ausdrückte, und sich dabei von mir beraten lassen. Ich sei ihm empfohlen worden.
Hätte ich mich damals von meinem ersten Impuls und den wenig wertschätzenden Schlussfolgerungen leiten lassen, hätte der potenzielle Kunde, da bin ich sicher, dankend auf meine Dienste verzichtet. Wenn der Mann nicht bereit sein würde, seine Selbstwahrnehmung kritisch zu hinterfragen und in der Konsequenz seinen zweifellos ungesunden Lebensstil radikal zu ändern, wäre es mit der Karriere sehr schnell und vermutlich dauerhaft vorbei. Diese Gedanken behielt ich erst einmal für mich und besann mich auf meine Talente als empathischer Profi.
Die Geschichte, die ich zu hören bekam, nachdem der Besucher seine mehr als hundert Kilo zu meiner Verblüffung auf dem zierlichsten Stuhl platziert hatte, der in dem Coachingraum zu finden war, glich einem Parforceritt durch eine Welt gnadenloser Selbstausbeutung. Um die atemlose Jagd zu stoppen, nutzte ich eine Unterbrechung seines Vortrags, in der mein Besucher mit hochrotem Kopf nach Luft schnappte.
„Lassen Sie uns eine kurze Pause machen“, bat ich ihn, „ich denke, ein Wasser wäre jetzt gut.“
„Danke, ich brauche nichts.“
„Ich schon. Bin gleich wieder bei Ihnen.“
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Ich ließ mir Zeit. Als ich mit einer Karaffe und Gläsern zurückkehrte, stand er am Fenster und starrte gebannt auf sein I-Phone. Noch ein Blick auf die Uhr, dann setzte er sich wieder, schaute mich mit einer steilen Unmutsfalte zwischen den Augen an. Ich betrachtete meinen Gast. Auftritte dieser Art gehörten so zuverlässig zum Standardrepertoire mancher gestresster Manager wie drittklassige Schauspieler in eine Daily Soap. In solchen Momenten fühlte ich mich stets ein wenig traurig, gleichzeitig waren sie die implizite Aufforderung an mich selbst, mich mit aller Aufmerksamkeit und Professionalität meinen Gesprächspartnern zuzuwenden.
Ich trank einen Schluck Wasser. Mein Besucher ergriff ebenfalls das Glas, das ich vor ihn hingestellt hatte und leerte es.
„Ich habe Ihr Anliegen gehört und fasse zusammen, was ich verstanden habe“, nahm ich den Faden wieder auf. „Sie wollen den nächsten Schritt in Ihrer Karriere planen und wünschen sich professionelle Unterstützung auf ihrem Weg. Bevor ich Ihnen meine Arbeitsweise erläutere und Ihnen etwas erzähle zu meinem Rollenverständnis als Coach und den Erwartungen, die ich an meine Klienten habe, würde ich Ihnen gerne eine Rückmeldung darüber geben, was mir durch den Kopf gegangen ist, während ich Ihnen zugehört habe.“
Der Besucher schaute mich mit großen Augen an. Verschränkte die Arme. Schaute auf sein Glas. Ich folgte der nonverbalen Aufforderung und füllte es erneut mit Wasser.
„Möchten Sie das hören?“
Er trank einen Schluck, platzierte die Arme erneut vor der Brust.
„Ja natürlich, deswegen bin ich ja hier.“
„Ich bin sehr beeindruckt“, leitete ich meinen Kommentar ein, „von den enormen Herausforderungen, die Sie ganz offenkundig in Ihrer Position zu bewältigen haben. Mehr noch beeindruckt mich die Power, die Sie ausstrahlen.“
Pause. Ich nahm einen Schluck Wasser.
„Darf ich Sie fragen, was Sie derzeit tun, um für diese Belastungen einen Ausgleich zu schaffen, der Sie in der Balance hält?“
Mein Besucher schwieg und betrachtete seine Hände, ergriff dann das I-Phone, das er auf dem Tisch platziert hatte und ließ es in seiner Jackentasche verschwinden. Ich wartete.
„Also, ich gehe gerne zum Joggen, so zwei-, dreimal die Woche.“
Ich war überrascht.
„Allerdings komme ich derzeit nicht dazu.“
„Gibt es noch etwas, wobei Sie entspannen können?“
„Surfen.“
Ich hatte gerade beschlossen, die Kiste meiner übereilt gefassten Vorannahmen ordentlich auszumisten, als mein Gast fortfuhr. „Im Internet meine ich. Das Surfen!“
Ich goss uns Wasser nach.
„Leider ist meine Frau davon nicht so begeistert.“
„Wann surfen Sie denn? Gleich, nachdem Sie nach Hause gekommen sind?“
„Nein, zuerst muss ich mal runterkommen von meinem Stresspegel.“
Ich lächelte den Manager erwartungsvoll an. Seine Augen flatterten durch den Raum, fanden Halt an dem Sofa, das in seinem Blickfeld an der gegenüberliegenden Wand stand.
„Wenn ich nach Hause komme, bringe ich meinen Sohn zu Bett und höre mir an, was er zu berichten hat. Dieses Ritual lasse ich mir nicht nehmen.“ Er presste die Lippen aufeinander, räusperte sich, prüfte den tadellosen Sitz seiner Krawatte. „Dazu gönne ich mir ein, zwei Gläser Wein.“
Der Anflug eines verlegenen Lächelns legte sich über die angestrengte Mimik.
Nach dieser unerwartet offenen Schilderung des abendlichen Entspannungsprogramms, wir kannten uns gerade mal eine Stunde, wirkte der Besucher eine Spur gelassener als zu Beginn, und ich hatte genug gehört, um später eine Entscheidung darüber treffen zu können, ob ich mit dem Mann arbeiten wollte.
Ich gab ihm die angekündigten Informationen zu den verschiedenen Stadien eines Coachingprozesses, meinen Methoden, unserem formalen und psychologischen Vertrag und wir verabredeten eine Bedenkzeit von einer Woche für beide Seiten.
Nachdem der Manager gegangen war, hatte ich ziemlich genervt die Fenster aufgerissen, um den Tabakgeruch loszuwerden, den er mitgebracht hatte. Ich war nicht sicher, ob ich diesen Kunden wirklich haben wollte. Als es zu einem Vertrag kam, verlegte ich die ersten Sitzungen während des Spätsommers kurzerhand ins Freie und sorgte für Bewegung im Görlitzer Park. Eine ebenso elegante wie sinnstiftende Lösung für die Arbeit mit einem Kandidaten, der auf dem besten Weg war, durch seinen ungesunden Lebensstil in rasantem Tempo das endgültige Aus für seine Karriere anzusteuern.
Nach anderthalb Jahren Arbeit am kommenden Abend den Abschlussreport zu schreiben, würde das reinste Vergnügen werden. Ich werfe einen Blick auf den ausgedruckten Feedbackbogen, den ich am Montagabend bearbeiten will. Die Bewertung ist ausgezeichnet, alles hatte gestimmt für den Kunden, die Rahmenbedingungen wie Ort und Dauer der Sitzungen, die Methoden und Instrumente ebenso wie die erlebten Änderungen des eigenen Verhaltens sowie die positiven Feedbacks aus dem Umfeld. Die Beurteilung des Beitrags, den der Coach geleistet hatte, konnte aus Sicht des Managers nicht besser sein.
Mit einem zweiten Glas Tempranillo in der einen und einem weiteren Käsebrot in der anderen Hand war ich meinen Erinnerungen in den Beratungsraum gefolgt. Er ist, wie die gesamte Wohnung, sehr minimalistisch möbliert. Ein Paradies für Putzfrauen. Und meine Putzfrau ist eine Fee, die zaubern kann. Ich habe Frau Plönzke am Kiosk ganz in meiner Nähe entdeckt. Sie ist die Schwester meiner Zeitungsfrau. Jeden Montag, seit fünf Jahren, widmet sie sich mit Hingabe den 180 Quadratmetern, die ich bewohne. Es gab nie den geringsten Anlass für Kritik. Was ich mich allerdings immer wieder frage ist, wie eine so unfassbar dicke Fee wie Frau Plönzke es schafft, auch in Ecken und Winkeln, hinter und unter Schränken und Betten, einfach überall für tadellose Sauberkeit zu sorgen. Ich traue mich nicht, sie danach zu fragen.
„Morgen, Doktor“. Diese Begrüßung, genau genommen klingt es mehr nach „Morjen, Dokta“, ist höchst kurios, denn der Tag ist bereits fortgeschritten, wenn Frau Plönzke kommt und ich verfüge nicht über einen Doktortitel. Darüber habe ich sie mehrmals aufgeklärt, aber sie ignoriert das konsequent. Wie sie mir erzählte, arbeitet sie ausnahmslos für Männer in Singlehaushalten, und ich fantasiere, dass sie allen Kunden einen akademischen Titel verpasst. Nach dem Motto „Man kann ja nie wissen.“ Ich verstehe es auch weniger als Begrüßung, es ist eher die Aufforderung an mich, jetzt zu verschwinden. Bis ich die Türklinke in der Hand habe, rührt die dicke Fee jedenfalls ihre Putzutensilien nicht an. Vielmehr ordnen ihre üppig beringten Finger vor dem großen Spiegel in der Diele die wasserstoffgebleichten Haare zu einer Art Brigitte-Bardot-Hochfrisur im Stil der längst vergangenen 60er Jahre.
Der Beratungsraum ist der größte und hellste in meiner Wohnung, mit zwei hohen Fenstern zur Straße, stuckverzierter Decke und einer wunderbaren, fachmännisch restaurierten Flügeltür, durch die ich mein Arbeitszimmer erreiche. Der Besucher, der den Raum von der Diele aus betritt, geht vorbei an einem ovalen Tisch, an dem bis zu sechs Menschen auf einladenden Stühlen mit Armlehnen und weichen Ledersitzen Platz finden. Zwei riesige Bananenpflanzen und ein mehr als zwei Meter hoher Kaffeestrauch trennen diesen Bereich von dem Teil des Raumes, in dem ich die Gespräche mit den Coachingkunden führe. In zwei weißen Schränken bewahre ich Arbeitsmaterial auf, vor den Fenstern steht ein kleinerer runder Holztisch. Wenige Gemälde, überwiegend in einer Palette variierender Weißtöne, hängen an weißen Wänden. Eines der Bilder zieht die Aufmerksamkeit aller Klienten an. Ein wunderschöner Frauenkörper, vor weißem Hintergrund auf einem weiß lasierten Balken balancierend. Eine mit einem feinen dunklen Strich angedeutete Stange in ihren Händen gibt ihr Halt. Die Betrachter wollen wissen, wer der Künstler ist. Nur eine Klientin fragte: „Wer ist diese Frau?“ Mein Lieblingsbild. Mir erzählt es eine Geschichte von Hingabe und Verlust, von Stärke und Zerbrechlichkeit.
Weiß sind Decke und Parkett, dazwischen Farbinseln im üppigen Grün der Pflanzen und den warmen Holztönen der Tische und Stühle. In dieser Umgebung kann ich mich hervorragend auf meine Besucher konzentrieren.
An einer der Seitenwände habe ich fünf Stühle aufgestellt, die sich in Form, Material und Entstehungsjahr voneinander unterscheiden. Jeder Gast wird gebeten, den Stuhl zu wählen, der ihn am meisten anspricht und ihn an dem runden Tisch dort zu platzieren, wo er sitzen möchte. Wenn ich bemerke, dass der Blick eines Besuchers auf das cremeweiße Sofa fällt, das an der Wand gegenüber zum Ausruhen verführt und wenn er dann diese Richtung ansteuert, teile ich ihm mit, dass der Platz nicht zur Wahl steht. Ich ergänze freundlich, dass Coaching harte Arbeit ist und kein Small Talk. Meine Hypothese ist, dass Besucher, die sich auf dem Sofa niederlassen möchten, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich daran interessiert sind, in ihrem Leben etwas zu ändern oder an ihrer Zukunft zu arbeiten. Für meine Entscheidung, ob ich einen Klienten annehme oder nicht, spielt diese Abwägung eine wesentliche Rolle. Ich bin in der komfortablen Lage, Aufträge ablehnen zu können. Die Besucher akzeptieren die verbotene Zone. In all den Jahren gab es nur eine Ausnahme.
Ich kehre an meinen Schreibtisch zurück, ohne nochmals einen Blick in den Spiegel zu werfen. Ich weiß, welcher Anblick mich erwartet. Das will ich jetzt nicht sehen. Martha hatte in der vergangenen Nacht angekündet, nach ihrer Rückkehr für uns beide Personal Trainer zu suchen, ob ich wolle oder nicht. Meinen Einwand, dass ich seit langem meine persönliche Trainerin gefunden habe, ordnete sie empört der Kategorie blödester Kalauer zu, der eines austrainierten Linksintellektuellen nicht würdig sei. Um dann mit lasziver Stimme vorzuschlagen, man könne es ja trotzdem mangels anderer Alternativen mal versuchen. Der Versuch endete auf meinem antiken Schreibtisch.
Ich lenke meinen Blick wieder auf den Terminkalender. Der erste Eintrag für den kommenden Montag, 2. Mai, 11 Uhr Frau Bastian, lässt den drohenden Besuch bei meiner Mutter wie einen Spaziergang in der Frühlingssonne erscheinen.