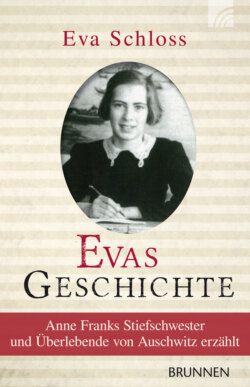Читать книгу Evas Geschichte - Eva Schloss - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Amsterdam
ОглавлениеWir mieteten uns eine möblierte Wohnung im ersten Stock eines modernen Häuserblocks in Amsterdam, Niew Zuid am Merwedeplein 46. Obwohl wir wegen des Krieges in Unsicherheit und Angst lebten, fühlte ich mich viel zufriedener und geborgener, weil wir wieder als eine Familie zusammenlebten. Das war für mich das Allerwichtigste.
Ich wuchs sehr schnell. Kaum waren wir in Holland angekommen, stellte Papi Heinz und mich an die Wand unseres Schlafzimmers und markierte dort mit einem Bleistiftstrich unsere Größe. Als er einen Monat später wieder Maß nahm, bemerkte ich mit Freude, dass ich eineinhalb Zentimeter gewachsen war – genauso viel wie Heinz.
Mein Bruder und ich schliefen im hintersten Zimmer, das auf einen Balkon hinausführte, auf dem in einer Ecke ein Kühlschrank stand. Einmal die Woche kam der Eismann vorbei, und Heinz musste einen riesigen Eisblock, eingewickelt in Sacktuch, hochtragen und ihn vorsichtig unten in den Eisschrank legen, in dem Mutti Milch, Butter, Käse und Fleisch aufbewahrte. Manchmal schlichen wir mitten in der Nacht auf den Balkon und holten uns ein Würstchen. Wir setzten uns auf unsere Betten, schmatzten und flüsterten und hatten viel Spaß miteinander. Es war einfach herrlich, wieder ein eigenes Zuhause zu haben.
Die Bewohner des Häuserblocks mussten an Feuer- und Fliegeralarmübungen teilnehmen. Auf diese Weise lernten Mutti und Papi schon bald andere, ebenfalls jüdische Familien in unserem Haus kennen. Es herrschte Kameradschaftsgeist und Zusammengehörigkeitsgefühl. Einer half dem anderen, den Mut nicht zu verlieren. Papi freundete sich mit einem Nachbarn, Martin Rosenbaum, an: ein freundlicher Mann, verheiratet mit einer Österreicherin, Rosi. Die beiden hatten keine Kinder, aber Martin Rosenbaum machte Papi oft Komplimente über uns.
»Was für reizende Kinder du hast, Erich«, hörte ich ihn einmal sagen, »und so begabt.«
Was Heinz anging, hatte er damit sicher recht. Zu Muttis großer Freude stand in unserer Diele ein Stutzflügel. Sie und Heinz spielten beide gut, und Heinz nahm sehr bald wieder Klavierunterricht. Gewissenhaft übte er Kompositionen von Chopin, aber auch Jazzmusik, die er nach Gehör spielte. »Bei mir bist du sheyn« – immer wieder. Ich tanzte sehr gerne im Zimmer herum, wenn er spielte, und stellte mir vor, auf einer großen Bühne zu stehen, während Papi und Mutti Beifall klatschten.
Mutti fand unter ihren neuen Bekannten eine Cellistin und eine Geigerin. Sie trafen sich einmal in der Woche in unserer Wohnung zum Musizieren. Papi war kein großer Freund dieser Musikabende. Sobald die quietschende Geige anfing zu spielen, ging er »ein bisschen frische Luft schnappen« und flüchtete zu Martin. Ich sah die beiden dann oft miteinander weggehen.
Wieder einmal schickte man mich auf die örtliche Grundschule, und ich fand mich schließlich mit meinem Schicksal ab, wieder eine neue Sprache lernen zu müssen. Holländisch fiel mir nicht ganz so schwer, weil es dem Flämischen, das ich in Belgien einmal die Woche gehört hatte, ähnlich war. Zumindest konnte ich ein wenig verstehen. In den meisten holländischen Grundschulen wurde auch Französisch unterrichtet, und mittlerweile sprach ich fließend Französisch.
Das hatte zur Folge, dass ich mir einbildete, ich sei besser als meine Lehrerin. Immer wenn sie ein französisches Wort falsch aussprach – was oft vorkam –, verbesserte ich sie. Ich kam mir dabei wichtig und bedeutend vor, aber sie ärgerte sich und ließ diesen Ärger bei jeder sich bietenden Gelegenheit an mir aus. Sie benahm sich mir gegenüber ausgesprochen hässlich, aber mich kümmerte das wenig, weil ich dadurch der Star der Klasse wurde.
Das geordnete Familienleben gab mir die Sicherheit, die ich so lange vermisst hatte. An Frühlingsabenden hörte ich die Kinder vor unserem Haus draußen spielen. Der Platz vor unserem Häuserblock war geradezu ideal zum Spielen – die Straße endete an unserem Haus und führte in einer Art Dreieck wieder zurück; frisch gepflanzte Büsche und Bäume trennten den Asphalt von einer kleinen Wiese dahinter. Nahezu alle Kinder aus der näheren Umgebung kamen hierher, um miteinander zu spielen.
Seit 1933 lebten sehr viele jüdische Familien hier in der Gegend, und die jüdischen Kinder schlossen sich zu festen Cliquen zusammen. Neuankömmlinge waren alles andere als willkommen. Ich stand sehr oft herum und wartete darauf, dass jemand mit mir sprach, aber sie wollten mich nicht. So war ich froh, wenn ein paar meiner holländischen Schulfreunde zu dem Platz kamen, um mit mir zu spielen. Vermutlich war ich einfach noch zu neu, denn schon bald schusserte ich mit ihnen, spielte mit ihnen Himmel und Hölle, Verstecken und vieles andere. Dann kaufte Papi mir eines Tages ein schwarzes, gebrauchtes Fahrrad. Ich lernte sehr schnell auf diesem zweirädrigen Ding die Balance zu halten. In den ersten Monaten 1940 fühlte ich mich richtig zugehörig, wenn ich mit meinen Freunden in der üblichen Tracht – Matrosenmantel und kniehohe Stiefel – durch die Gegend fuhr. Wenn es nicht regnete, waren immer genug Kinder da, um Mannschaften zum Beispiel für Schlagball zu bilden. Das gefiel mir am besten, weil man sich mit anderen zusammentun musste. Weil ich eine gute Schlägerin und Läuferin war, rissen sich die anderen um mich, was mein Selbstbewusstsein beachtlich stärkte.
Ganz allmählich fühlte ich mich wieder heiter und unbeschwert wie früher. Das Leben hatte wieder so viele schöne Seiten. Wenn ich zu Hause von der Schule erzählt und meine Hausaufgaben gemacht hatte, lief ich hinunter, um mit den anderen zu spielen. Um sechs Uhr rief mich meine Mutter zum Abendessen, aber ich folgte ihr meist nur widerwillig – schließlich waren viele meiner Spielkameraden noch draußen, bis nach acht! Aber Papi bestand darauf, dass ich nach dem Abendbrot zu Hause blieb. Im Unterschied zu meiner Mutter war ich nicht stets freundlich und nachgiebig: Ich hatte eine Menge von Papis Charaktereigenschaften geerbt, und es geschah nicht selten, dass er mich für meinen Eigensinn mit Hausarrest bestrafte. Ich war ein richtiges kleines Energiebündel und wäre am liebsten immer draußen gewesen, wo das Leben pulsierte.
Mit der Zeit entwickelten sich auch engere Freundschaften. Ich verliebte mich bis über beide Ohren in Suzanne Lederman. Sie hatte strahlende veilchenblaue Augen, pfirsichfarbene Haut und dicke, dunkle Zöpfe, die ihr bis zur Taille reichten. Ich hielt mich immer in ihrer Nähe auf, aber sie war lieber in Gesellschaft von zwei quirligen Mädchen namens Anne und Hanne. Die drei tauchten überall gemeinsam auf. Wir gaben ihnen den Spitznamen Anne, Hanne und Sanne, weil sie ein schier unzertrennliches Trio waren, alle ein bisschen weiter entwickelt als wir anderen – mehr wie richtige Teenager. Bei unseren kindischen Spielen wollten sie nicht mitspielen. Sie gluckten zusammen, beobachteten uns und kicherten über die Jungs, was mir sehr dumm vorkam. Dauernd blätterten sie in irgendwelchen Modezeitschriften und sammelten Bilder von Filmstars.
Von meinem Zimmer aus konnte ich zu Suzannes Zimmer hinübersehen, und manchmal gaben wir uns Zeichen. An einem sonnigen Sonntagnachmittag, ich saß mit Suzanne auf den Stufen zu unserer Wohnung, vertraute sie mir an, wie sehr sie ihre Freundin Anne Frank bewunderte, weil sie immer so geschmackvoll gekleidet war.
Wie recht sie hatte. Als Mutti mit mir einmal zu dem Schneider in unserer Gegend ging, um einen Mantel ändern zu lassen, mussten wir eine Weile warten, weil der Schneider noch mit einer anderen Kundin beschäftigt war. Aus dem Ankleidezimmer hörten wir Stimmen. Die Kundin wusste offenbar sehr genau, was sie wollte.
»Mit dickeren Schulterpolstern würde ich besser aussehen«, hörten wir sie mit bestimmtem Ton sagen, »und der Saum könnte ruhig ein bisschen höher rutschen, meinen Sie nicht auch?«
Der Schneider stimmte zu, und ich saß da und wünschte, ich könnte auch tragen, was ich wollte. Ich war platt, als der Vorhang zurückgeschoben wurde und Anne zum Vorschein kam, ganz alleine. Das Kleid, von dem die Rede gewesen war, trug sie immer noch. Es war pfirsichfarben mit grünem Besatz. Sie lächelte mich an. »Gefällt es dir?«, fragte sie und drehte sich dabei leichtfüßig.
»Oh, ja«, antwortete ich hastig. Ich platzte fast vor Neid. Verglichen mit ihr kam ich mir wie eine graue Maus vor. Obwohl ich einen Monat älter war als sie, erschien sie mir viel erwachsener. Sie besuchte die Montessorischule und war mir im Stoff etwa ein Jahr voraus.
Anne wohnte im gleichen Stockwerk wie wir, uns gegenüber. Ich ging sehr oft hinüber, weil ich Suzanne nahe sein wollte. Die Franks hatten eine große, graubraun gestreifte Katze, die jedes Mal behaglich schnurrte, wenn ich sie hochnahm und streichelte. Wie gerne hätte ich selbst ein Haustier gehabt, aber Mutti war strikt dagegen. Oft ging ich ins Wohnzimmer, um die Katze zu kraulen, und Herr Frank sah mir amüsiert dabei zu. Er war viel älter als Papi und sehr nett. Als er merkte, wie schlecht ich Holländisch sprach, redete er fortan Deutsch mit mir. Frau Frank schenkte Limonade für die Kinder ein, und wir saßen gemütlich, mit dem kühlen Getränk in der Hand, in der Küche zusammen.
Heinz hatte sich in zwei Mädchen verliebt, die beide in unserem Block wohnten. Eine, Ellen, war eine jüdische Immigrantin, genauso wie wir, die andere aber, Jopie, war eine hübsche, blonde Holländerin. Ich war ziemlich gekränkt, dass er den beiden so viel Aufmerksamkeit schenkte – ja, es gefiel mir ganz und gar nicht, dass mein Bruder Interesse für andere Mädchen zeigte. Ich wurde richtig eifersüchtig. Schließlich war ich seine kleine Schwester und stolz auf ihn, auf seine Musikalität und seinen klugen Kopf. Abgesehen davon plagte mich kaum etwas. Es war Frühling, und ich liebte Amsterdam, wo ich endlich wieder ein normales Leben führen konnte.
10. Mai 1940:
Die Deutschen marschieren in Holland und Belgien ein
Wir hatten angenommen, in Holland in Sicherheit zu sein, hatten uns allmählich eingelebt und begonnen, unser neues Leben zu genießen, als zu unser aller Entsetzen die Nazis in Holland einmarschierten.
Am 13. Mai ging meine Familie mit tausend anderen hinunter zum Hafen, um auf einem Schiff nach England zu fliehen. Stundenlang standen wir Schlange, aber umsonst. Die meisten Schiffe waren entweder schon ausgelaufen oder bis auf den letzten Platz besetzt. Wir waren zu spät gekommen.
14. Mai 1940:
Die deutsche Luftwaffe bombardiert Rotterdam, um Holland zur Kapitulation zu zwingen. Nach fünf Tagen streckt die niederländische Armee die Waffen
Das Land war nun in der Hand der Nazis. Überall waren deutsche Soldaten. Obwohl die Deutschen zunächst angekündigt hatten, alles werde beim Alten bleiben, wurden Woche für Woche neue Verordnungen über Funk und Anschlagtafeln bekanntgegeben, die uns immer mehr in unseren Rechten einschränkten.
Hitler ordnete an, dass jüdische Kinder in jüdische Schulen zu gehen hatten, die speziell für sie eingerichtet wurden. Der Unterricht in diesen Schulen durfte nicht von christlichen, sondern musste von jüdischen Lehrern gehalten werden.
Zu der Zeit besuchte Heinz das Gymnasium. Auch er musste auf eine jüdische Schule überwechseln und lernte dort Margot Frank, Annes ältere Schwester, kennen. Die beiden freundeten sich schnell an und machten oft ihre Hausaufgaben miteinander. Sie hatten eine Menge gemeinsam – beide waren begabte und sehr ehrgeizige Schüler. Meine Eltern fanden für mich einen Privatlehrer, in dessen Wohnung ich mit anderen Schülern unter seiner Aufsicht meine Schularbeiten machte.
Für alle Juden bestand nach acht Uhr abends Ausgehverbot. Sie durften weder Kinos, Konzerte noch Theater besuchen. Auch Straßenbahnen und Züge durften wir nicht benutzen. Einkaufen konnten wir nur zwischen drei und fünf Uhr nachmittags, und das auch nur in jüdischen Läden. Alle Juden mussten den gelben Davidstern deutlich sichtbar auf ihrer Kleidung tragen, damit man sie sofort identifizieren konnte.
Am 19. Februar 1941 wurden vierhundert Juden aus Amsterdam Zuid im Alter von zwanzig bis fünfunddreißig Jahren zusammengetrieben. Am 25. Februar organisierten daraufhin holländische Gewerkschaften einen Generalstreik, um so gegen das Vorgehen der Nazis zu protestieren. Zwei Tage lang stand alles still – der öffentliche Verkehr lag brach, in den Ämtern und Dienststellen hatten die Angestellten ihre Arbeit niedergelegt. Die Nazis drohten, Geiseln zu nehmen und sie umzubringen, falls die Arbeit nicht wieder aufgenommen würde. Das tat seine Wirkung. Einige mutige Holländer begannen freiwillig den gelben Stern zu tragen, um sich mit uns zu solidarisieren und die Deutschen zu verwirren.
»Zieh niemals deinen Mantel aus, wenn du keinen gelben Stern auf deinem Kleid trägst«, warnte mich Mutti, als ich ihr zusah, wie sie dieses Erkennungszeichen auf meinen dunkelblauen Mantel und meine Jacke nähte. »Wenn ein Jude angetroffen wird, der keinen Stern trägt, stecken ihn die Deutschen ins Gefängnis.«
Die Zeit verging und wir fühlten uns zunehmend stärker bedroht. Papi war jetzt bei uns zu Hause, weil ihm die Deutschen verboten hatten, weiterhin zur Fabrik in Brabant zu reisen. Er kam auf die Idee, kleine Lederhandtaschen aus Schlangenlederresten herzustellen, und schon sehr bald blühte das Geschäft. Die Taschen wurden in Heimarbeit gefertigt, und viele, die ihre Arbeit durch die Verordnungen der Nazis verloren hatten, verdienten sich so ihr Brot. Unsere ganze Familie lebte von dem Verkauf der Taschen. Was wir nicht zum Leben brauchten, sparte Papi, falls eine Zeit kommen würde, in der er selbst nicht mehr für uns sorgen konnte.
Er ging auf viele Versammlungen von Juden, um mit anderen Betroffenen über die sich zuspitzende Lage zu diskutieren. Eines Abends rief er uns alle zu sich und bereitete uns darauf vor, dass wir uns möglicherweise bald versteckt halten müssten. Er meinte, es wäre besser, wenn wir uns trennten und an zwei verschiedenen Orten versteckten. Als ich zu weinen begann, erklärte er, dass ihm das Weiterleben seiner Kinder überaus wichtig sei, dass die Menschen in ihren Kindern und Enkeln weiterleben. Wir könnten unsere Überlebenschancen verdoppeln, wenn wir uns trennten. Er wollte uns falsche Papiere besorgen, falls wir irgendwann einmal gezwungen sein sollten, unsere jüdische Herkunft zu verheimlichen.
Es gab von Holländern organisierte Widerstandsgruppen, die im Untergrund gegen die verhassten Nazis arbeiteten. Papi trat mit einer dieser Gruppen in Kontakt, und man beschaffte ihm falsche Pässe, die uns als gebürtige Holländer auswiesen.
Mutti hieß Mefrouw Bep Ackerman. Obwohl ich mir meinen neuen Namen, Jopie Ackerman, schnell eingeprägt hatte, vergaß ich ständig mein falsches Geburtsdatum und meinen Geburtsort, und Mutti musste mich immer wieder korrigieren.
Natürlich wusste Heinz sofort alles auswendig. Er war mittlerweile fünfzehn, hochgewachsen und sah sehr jüdisch aus, was ihn bekümmerte. Dieses Problem hatte ich wenigstens nicht. Ich hatte strahlend blaue Augen, helle Haut und blondes Haar, wie viele andere kleine holländische Mädchen auch. Mutti hätte man nach ihrem Äußeren leicht für eine Skandinavierin halten können. Sie verkaufte einen Teil ihres Schmucks, um genug Bargeld verfügbar zu haben.
Zusätzliche Sorgen machte uns unsere Gesundheit. Mutti und Papi war klar, dass es äußerst schwierig werden würde, in einem Versteck ärztliche Hilfe zu bekommen, falls einer von uns erkrankte. Schon seit Wochen litt ich an einer ernsten Mandelentzündung, und es stand bereits fest, dass ich operiert werden musste.
Zu der Zeit war es für Juden zu gefährlich, in ein Krankenhaus zu gehen. Zwar nahm man sie auf, aber viele wurden festgenommen und direkt von der Krankenstation weg in Lager abtransportiert. Ein Arzt in unserer Nähe erklärte sich einverstanden, mich in seiner Praxis zu operieren. Man schnallte mich auf einem Stuhl fest und gab mir Lachgas. Als ich nach der Operation allmählich wieder zu Bewusstsein kam, fantasierte ich, dass es in dem Zimmer brannte und alles lichterloh in Flammen stand. Von schrecklicher Angst geplagt, wachte ich auf. Meine Eltern brachten mich nach Hause, und ich lag etwa eine Woche lang im Bett, konnte nicht sprechen und nur Eiscreme zu mir nehmen. Mutti und Heinz umsorgten mich liebevoll, und Papi erzählte mir, wie mutig ich gewesen war. Als die Wunden verheilten und ich wieder richtig essen konnte, erholte ich mich sehr schnell.
Keines der Kinder in unserem Wohnblock redete über die Gespräche im Kreis der Familie. Wir vertrauten alle unseren Eltern. Sie würden wissen, was in bestimmten Situationen zu tun sei. Ich wollte jedenfalls nicht allzu viel über die Zukunft nachdenken. Allein der Gedanke, von Heinz getrennt zu werden, war mir unerträglich. Ich bewunderte ihn und hatte ihn von Herzen gern. Ich wollte, dass alles beim Alten bliebe, aber Papi und Mutti wussten, dass das nicht möglich war, und hatten Vorkehrungen getroffen.
Ich erinnere mich an Spaziergänge durch sonnige Straßen, wo wir uns verfolgt und bedroht fühlten. Eines Nachmittags kam Heinz völlig außer sich von der Schule nach Hause. Sein Freund Walter hatte auf dem Nachhauseweg seine Jacke ausgezogen, weil es ein warmer Tag war. Da er auf seinem Hemd keinen Davidstern trug, wurde er von der SS auf der Stelle verhaftet. Ich spürte, wie das Unheil unaufhaltsam auf uns zurollte.
1942:
Deutsche Truppen stoßen nach Stalingrad vor
Papi mietete einen leeren Raum in einem Lagerhaus an der Singel direkt am Kanal und deponierte dort große Koffer, in denen er Lebensmittel aufbewahren wollte für die Zeit, in der wir uns versteckt halten mussten. Lebensmittel waren schon rationiert. Es war nicht einfach, etwas von unserer wöchentlichen Zuteilung abzusparen.
Ich erinnere mich deutlich an einen Nachmittag, an dem wir einen Teil der Lebensmittel in das Lagerhaus schafften. Heinz steckte mir ein Paket, umwickelt mit braunem Papier, in meine Schultasche und half mir, den Riemen festzuschnallen, sodass die Tasche auf meiner rechten Hüfte saß. Die Tasche war sehr schwer. Immerhin steckten darin sechs Dosen Kondensmilch, sechs Dosen Ölsardinen, ein Paket Reis und eine Dose Kakao. Dann sah ich Heinz zu, wie er seinen Schulranzen mit Dosen Tomatenmark, einer Flasche Olivenöl, Zucker und ein paar Tafeln Schokolade bepackte. Mutti und Papi schnürten ebenfalls ihre Taschen.
Es war Frühling, April 1942. Gelbliche und hellgrüne Knospen sprossen aus den Zweigen der Weiden und Platanen entlang der Kanäle. Mutti und Papi gingen voraus; Papi trug seine Aktentasche unter dem Arm und Mutti ihren Einkaufskorb. Heinz und ich folgten ihnen über die Straßen aus Kopfsteinpflaster, über kleine Brücken hinunter zu dem Lagerhaus. Meine Tasche kam mir so schwer vor, und zu allem Überfluss löste sich auch noch einer meiner Schnürsenkel. Als ich mich gegen eine Wand lehnte, um mein Schuhband zu binden, klirrten die Dosen und ich bekam einen riesigen Schreck. Heinz griff im Nu geistesgegenwärtig unter meine Tasche und stützte sie. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Es war Sonntag, und gewöhnlich hielten sich an Sonntagen nicht so viele Menschen auf den Straßen auf, aber nicht weit von uns wurde ein Markt gehalten, und so gaben wir vor, dorthin zu gehen. Am Lagerhaus angekommen, schlossen wir sofort die große Holztüre hinter uns und stiegen die zwei Stockwerke bis zu unserem Lagerraum hoch. Papi sperrte die Türe auf und wir gingen hinein, um unsere Pakete loszuwerden. »Die Tomaten in den Koffer mit dem Olivenöl und dem Reis«, wies uns Papi an. »Die Sardinen und die Schokolade packen wir in den anderen.«
»Soll ich die Kondensmilch zu dem Kakao legen?«, fragte ich. Das war wichtig für mich, schließlich wollte ich helfen, so gut ich konnte.
Nachdem wir die Lebensmittel verstaut hatten, bedeckten wir sie mit Kleidungsstücken und streuten Mottenkugeln darüber. Wir sollten noch mehrere Male dorthin zurückkehren. Später trug unsere geheime Vorratskammer zwar dazu bei, Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen und ihnen zu helfen, die furchtbare Not des Krieges zu überstehen – jedoch wir zählten nicht zu den Glücklichen.
Am Morgen des 6. Juli kam per Post für Heinz eine Karte mit der Aufforderung, sich in drei Tagen mit Rucksack beim alten Theater, in unserer Nähe, einzufinden. Von dort würde man ihn weiter in ein Arbeitslager irgendwo in Deutschland schicken. Mutti war vollkommen verzweifelt und Heinz versuchte sie zu beruhigen.
»Ich werde gehen, Mutti«, sagte er tapfer. »Schließlich sind auch alle meine Freunde da. Henk, Marcel und Margot haben auch so eine Karte bekommen.«
»Sie werden euch wie Sklaven behandeln«, schluchzte Mutti.
»Sie werden mir nichts tun, wenn ich tüchtig arbeite«, erwiderte Heinz und sah, auf Zustimmung wartend, zu Papi hinüber.
»Natürlich brauchen sie junge Leute«, murmelte Papi, »aber ich halte es für klüger zu verschwinden.«
Innerhalb von vierundzwanzig Stunden waren alle Vorkehrungen getroffen. Papi und Heinz sollten sich getrennt von uns verstecken.
Alles war von Holländern organisiert, die im Untergrund arbeiteten. Mutti und ich bekamen die Adresse einer Lehrerin, einer Frau Klompe, am anderen Ende von Amsterdam Zuid.
Wir verbrachten die letzten Stunden im Kreis der Familie. Als es Zeit war, Abschied zu nehmen, klammerte ich mich an meinen heiß geliebten großen Vater.
»Papi, ich will nicht ohne dich gehen«, weinte ich. Der Gedanke, mich wieder von ihm trennen zu müssen, war kaum zu ertragen.
»Evertje, sei ein großes Mädchen«, sagte er. »Du musst auf Mutti aufpassen, solange ich nicht da bin.«
Ich hatte meine Arme fest um seinen Hals geschlungen und schwebte mit den Fußspitzen in der Luft. Er umarmte mich liebevoll, setzte mich wieder ab, hielt mich an den Schultern fest, sah mich ernst an und flüsterte, als ob er betete: »Gott beschütze dich.« Ich fühlte mich auf einmal stark und hörte auf zu weinen. Heinz stand neben mir. Tränen liefen ihm übers Gesicht. Er wischte sie mit dem Handrücken weg, umarmte und küsste mich zum Abschied.
Ich erinnere mich, wie ich mit Mutti das Haus verließ. Diesmal trugen wir keine gelben Sterne auf unseren Jacken. Verlegen hielt ich eine Zeitschrift vor meiner Brust, um zu verbergen, dass ich den Stern nicht trug. Ich sah mich noch einmal nach der Wiese um, wo wir immer gespielt hatten. Im Licht der frühen Morgenstunde erschien alles verlassen und hoffnungslos elend. Ich hatte mich nicht von meinen Spielkameraden verabschiedet und machte mir Sorgen, dass sie mich nachmittags vermissten, weil keiner wusste, wo ich war. Unser freundlicher Milchmann stand mit seinem Lieferwagen vor der Haustüre. Er wandte schnell seinen Kopf zur Seite und tat so, als hätte er uns nicht gesehen.
Mit einer kleinen Tasche in der Hand eilten Mutti und ich schweigend durch Amsterdam zu Frau Klompes Haus. Als wir klopften, öffnete eine gepflegte Dame mittleren Alters die Tür. Wir sahen sie zum ersten Mal, und sie sagte, gut hörbar für alle neugierigen Nachbarn: »Wie geht es euch? Schön, euch wiederzusehen«, und bat uns lächelnd herein. »Kommt herein, nun kommt.«
Sie gab sich große Mühe, so natürlich wie möglich zu wirken, aber als wir über die Schwelle traten, schloss sie eilig die Haustür hinter uns und führte uns in eine Art Wohnzimmer. Bei einer Tasse Tee erklärte sie Mutti, wie und wo wir untergebracht werden sollten. Dann folgten wir ihr in die drei Stockwerke höher gelegene Dachkammer, die man in zwei Räume unterteilt hatte. In dem Raum, in dem ich schlafen sollte, standen nur ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl. Der andere war wie ein Wohnzimmer eingerichtet mit einem Küchenschrank, einem Tisch, drei Stühlen und einem geblümten Sofa, auf dem Mutti schlafen würde.
Ein paar Stufen tiefer befand sich ein längliches Badezimmer mit Toilette. Kochen konnten wir hier oben nicht, aber wir durften die Küche unten mitbenutzen.
»Wenn ich nicht zu Hause bin, könnt ihr weder das Bad noch die Küche benutzen«, warnte uns Frau Klompe. »Wenn die Nachbarn Lärm hören, schöpfen sie Verdacht. Wir müssen sehr vorsichtig sein, damit niemand erfährt, dass ihr euch hier versteckt haltet.«
»Wie sicher sind wir?«, fragte Mutti.
»Gelegentlich machen die Deutschen Razzien, um nach versteckten Juden zu suchen«, erwiderte Frau Klompe. »Sie sind wie Rattenfänger, die fest entschlossen sind, alles Ungeziefer zu vernichten«, fuhr sie trocken fort, »aber wir hier im Untergrund sind ebenso fest entschlossen, Unschuldige vor ihnen zu schützen.«
Sie lächelte mir aufmunternd zu, aber ich spürte, wie mir flau und flauer wurde.
Am gleichen Abend besuchte uns ein weiterer Untergrundkämpfer, Herr Broeksma. Er war ein Kollege von Frau Klompe und die beiden arbeiteten sehr eng zusammen. Er war Friese – ein abgehärteter Freiluftfanatiker, der jeden Winter an den Schlittschuhrennen über Meieln auf den gefrorenen Kanälen teilnahm – und Vollblutholländer, der die Eindringlinge zur Hölle wünschte. Er war intelligent, mutig und verlässlich und, wie die anderen Untergrundkämpfer, ausgesprochen hilfsbereit. Wir waren in seiner Hand und er kannte die Gefahr, in der wir alle schwebten, aber wir vertrauten ihm bedingungslos.
Er nahm sich Zeit, unser Versteck genau zu besichtigen, und kam zu dem Schluss, dass wir innerhalb dieser Wände noch ein weiteres Versteck bräuchten, wo wir uns verborgen halten konnten, wenn das Haus durchsucht würde.
Natürlich musste er alles organisieren. Am darauffolgenden Abend kam er mit einem Architekten. Die beiden überlegten, wo sich in den beiden kleinen Räumen noch ein zusätzliches Versteck einrichten ließe. Schließlich kamen sie auf die Idee, die Toilette vom Rest des Badezimmers abzutrennen.
Sie kamen überein, ins Bad eine gekachelte Wand einzuziehen mit einer Art Geheimzugang, der von der Toilette aus zu schließen war. Von außen würde es aussehen wie eine durchgehend gekachelte Wand. Das bedeutete, dass wir jedes Mal, wenn wir die Toilette benutzen wollten, durch dieses kleine Loch schlüpfen mussten. Doch diese Unannehmlichkeit nahmen wir gerne auf uns, da wir so ein Versteck hatten, in das wir uns im Notfall verkriechen konnten.
Das Baumaterial musste zuerst beschafft und dann im Schutz der Dunkelheit Stück für Stück in die Dachkammer gebracht werden, aber die zwei Männer konnten schon nach vierzehn Tagen mit der Arbeit beginnen.
Am dritten Sonntag in unserem Versteck arbeiteten sie den ganzen Tag und waren beinahe fertig. Nur der Zugang musste noch gekachelt werden. Sie waren beide sehr müde, beschlossen aber, trotzdem so lange zu bleiben, bis die Arbeit getan war. Schließlich baten sie Mutti, durch das Loch zu klettern und die gekachelte Klappe von der Toilette aus zu schließen. Zu meinem großen Erstaunen war Mutti tatsächlich hinter einer anscheinend durchgehend gekachelten Wand verschwunden.
Die beiden Männer sahen einander zufrieden und anerkennend an und beglückwünschten sich zu ihrem Erfolg. Als Mutti wieder zurückkroch, schüttelten sie auch uns die Hände und verabschiedeten sich.
Ich schlief in jener Nacht so tief, dass das Motorengeräusch der Gefängniswagen unten auf der Straße und das ungeduldige Klopfen an der Haustür nur ganz allmählich durch meine Träume drangen, bis ich schließlich aufwachte. Im Erdgeschoß waren Deutsche, die brüllten: »Halten sich hier vielleicht dreckige Juden versteckt?«
»Mutti?« Ich hatte schreckliche Angst.
»Schnell, Eva, deck das Bett mit der Steppdecke zu«, flüsterte sie, half mir geschwind aus dem Bett und strich die Überdecke mit mir glatt, damit es so aussah, als wäre das Bett nicht benützt worden.
Wir schlichen uns ins Badezimmer und zwängten uns, so schnell wir konnten, durch die kleine Öffnung in die Toilette. Mit fliegenden Fingern schloss Mutti die Klappe. Es war stockdunkel und ich spürte, wie Mutti auf der Toilette saß und ihre Knie umklammert hielt. Voller Angst drückte ich mich an sie.
Wir hörten die Soldatenstiefel die Treppen hochkommen. Ich drückte mich noch fester an Mutti und wagte kaum zu atmen. Mein Herz klopfte so laut, dass ich mir sicher war, sie konnten es hören.
Plötzlich flog die Badezimmertüre auf und die Deutschen standen in dem kleinen Zimmer. Sie sprachen sehr laut miteinander. Nach einer Weile entfernten sich die Schritte wieder in Richtung Treppenhaus. Schließlich gaben sie anscheinend auf und wir hörten, wie die Haustür hinter ihnen ins Schloss knallte.
Mutti zog meinen Kopf an ihr Gesicht. Ich spürte, wie ihr vor Erleichterung die Tränen herunterliefen. Wenn die Nazis nur zwei Stunden früher gekommen wären, hätten sie uns sicher gefunden. Gott im Himmel und unser Friese hatten über uns gewacht.