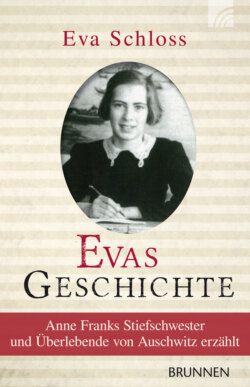Читать книгу Evas Geschichte - Eva Schloss - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. In Haft
ОглавлениеDer schwarze Gefängniswagen rumpelte über das Kopfsteinpflaster Richtung Stadtgefängnis. Wir saßen mit ein paar anderen Familien im hinteren Teil des Wagens und starrten einander, wie unter Schock, teilnahmslos an. Holländische Gefängniswärter zerrten uns dann aus dem Wagen und trennten die Männer von den Frauen. Ich klammerte mich an Mutti. Sie sah zu Papi hinüber, der uns »Kopf hoch!« zurief, ehe man uns fortbrachte. Es war das Schlimmste, was ich jemals erlebt hatte. Ich konnte nicht verstehen, warum man mich ins Gefängnis stecken wollte und warum ich, gerade fünfzehn Jahre alt, so unerwünscht war, nur weil ich dem jüdischen Volk angehörte. Es war ein himmelschreiendes Unrecht, und ich war aufgebracht und erbittert. Ich wünschte, ich hätte das alles begreifen können.
Wenn man in eine so aussichtslose Lage gerät und nichts dagegen tun kann, beginnt man sich innerlich vollkommen leer zu fühlen. Normalerweise hätte ich mich den Leuten um mich herum verbunden gefühlt und mit ihnen gesprochen, aber jetzt vermutete ich in jedem einen Spion, der uns nur aushorchen wollte. Ich vertraute keiner Menschenseele mehr, außer Mutti. So begann die Vereinzelung, die Teil der Entmenschlichung in den Konzentrationslagern war.
Man brachte Mutti und mich in einen großen Schlafsaal, in dem dreistöckige Notbetten aufgereiht standen. Etwa vierzig Frauen waren dort untergebracht. In einer Ecke befanden sich ein Waschbecken und eine Toilette, die sich alle teilen mussten. Das war das erste Mal, dass ich mit so vielen Menschen in einem Raum schlafen musste. Ich kletterte auf eine der obersten Pritschen, legte mich auf die graue Decke, mein Kopf auf einem kleinen Kissen, und starrte ins Leere. Mein ganzer Körper schmerzte von den Schlägen. Ich beugte mich zu Mutti hinunter – ich konnte diese Nacht nicht alleine verbringen. Als sie mein zerzaustes Haar und mein schmerzverzerrtes, zerschundenes Gesicht sah, nickte sie. Ich kletterte zu ihr hinunter und kuschelte mich auf ihrem Bett an sie. Schlafen konnte ich lange nicht.
Die ganze Nacht hindurch wurden neue Gefangene hereingebracht: Frauen mit Babys, die wohl die Verzweiflung spürten und verängstigt schrien. Ohne irgendwelche Hilfsmittel mussten die Mütter ihre Kinder notdürftig versorgen. Eine chronische Asthmatikerin bekam in der Nacht Anfälle. Sie rang keuchend nach Luft und ihr Gesicht verfärbte sich blaurot. Die Frauen riefen nach einem Arzt und einer Krankenschwester. Irgendwann schickten die holländischen Wachmänner dann einen Arzt, der sich um sie kümmerte.
Mutti lag ruhig da, ihre Arme um mich geschlungen. Spätnachts gelang es mir schließlich, den Lärm und das Treiben um mich zu vergessen und einzuschlafen.
Am nächsten Morgen gab man uns zu essen. Es war der erste Bissen Brot und der erste Schluck zu trinken seit meinem unterbrochenen Geburtstagsfrühstück. Ich hatte auf einmal schrecklichen Hunger, und Mutti gab mir noch von ihrem Brot, nachdem ich meines aufgegessen hatte. Während wir auf unseren Pritschen saßen und aßen, erzählten die Frauen einander, woher sie kamen und wie man sie verhaftet hatte … und wir alle versuchten uns auszumalen, wie es weitergehen würde.
Alle waren verzweifelt; nur eine junge Frau, Anfang zwanzig, die auf der Pritsche neben uns schlief, schien so etwas wie Mut und Zuversicht auszustrahlen. Frühmorgens half sie den Müttern, ihre Babys zu versorgen, tröstete weinende Frauen und machte allen Mut.
Gegen Mittag brachte man wieder eine Mahlzeit und sie setzte sich zum Essen zu mir auf mein Lager. Ihr Name war Francesca (Franzi), sie war in Amsterdam zur Welt gekommen, ihre Eltern aber stammten aus Russland. Aus ihrem Plan, an der Universität zu studieren, wurde nichts, als die Nazis nach Holland einmarschierten. Obwohl man ihre Mutter schon sehr früh verhaftet hatte – zusammen mit ihrem älteren Bruder und dessen Frau –, gelang es Franzi und ihrer jüngeren Schwester Irene, sich versteckt zu halten.
Das Baby ihres Bruders, Rusha, hatten sie mitgenommen. Wegen des Babys mussten sie ihr Versteck häufig wechseln, was nur mithilfe der holländischen Untergrundbewegung möglich gewesen war. Irene und Rusha kamen schließlich auf einem Bauernhof unter, wo sie als die Kinder des Bauern und dessen Frau lebten. Franzi hatte gebetet, dass man sie nicht entdecken möge. Letztendlich war es ihr so wie uns ergangen; man hatte sie für Geld an die Gestapo verraten.
»Wenigstens sind wir in einem ordentlichen holländischen Gefängnis«, sagte sie. »Die Holländer sind human, und wir sind hier relativ sicher.«
Am Ende unseres zweiten Tages war das Gefängnis hoffnungslos überfüllt, und wir nahmen an, dass man uns schon bald in das holländische Gefangenenlager auf dem Land in Westerbork deportieren würde.
»Meinst du, dass es uns dort besser geht?«, fragte ich. Immerhin waren wir die Gefangenen unseres Todfeindes.
Franzi nickte. Sie hatte schon von dem Lager gehört. »Es wird dort auf alle Fälle nicht so voll sein.« Sie sah sich in dem riesigen Schlafsaal um, in dem sich mittlerweile viele Frauen mit ihren Kindern ein Lager teilten. »Solange man uns in Holland behält, sind wir sicher. Man lässt auch die Familien zusammen.« Franzi hatte vollkommenes Vertrauen zu den Holländern.
Mutti saß ruhig, in Gedanken versunken, da. Plötzlich hatte sie die Idee, die Reitsmas zu bitten, uns ein paar Kleider zu bringen. Sie ging zu einem der Wachmänner und bat ihn, einen Brief schicken zu dürfen. Noch am gleichen Abend wurde uns ein Koffer mit Unterwäsche, Pullis, Röcken und Muttis Mantel ins Gefängnis gebracht.
13. Mai 1944
Am Dienstagmorgen rief man uns alle namentlich auf. Wir mussten uns eine nach dem anderen aufstellen und marschierten unter strengster Bewachung der Gestapo zum Bahnhof.
Dort bestiegen wir einen Zug mit mehreren Waggons. Als ich die Treppen hochkletterte, erhaschte ich einen Blick von Papi und Heinz im anderen Waggon.
Ein Pfiff und der Zug fuhr an. Wir verließen Amsterdam und rasten durch die Frühlingslandschaft. Die Obstbäume standen in voller Blüte, Kühe und Schafe grasten friedlich, die Bauern arbeiteten auf ihren Feldern, und ich wäre so gerne dort draußen in der Freiheit gewesen.
Drinnen im Waggon sprachen alle über das, was uns erwartete. Unsere größte Angst war, dass man uns in ein Konzentrationslager im Osten brachte. Vielleicht sogar nach Auschwitz. Die einzige Hoffnung, die uns blieb, war, dass der Krieg bald zu Ende sein würde und wir bis dahin in Westerbork bleiben konnten.
Als wir endlich ankamen, sahen wir, dass Franzi recht gehabt hatte. Die Unterkunft war einigermaßen in Ordnung. Wir bekamen saubere Betten und hatten Zugang zu ausreichend sanitären Anlagen. Das Beste aber war, dass wir uns frei bewegen, ungehindert miteinander sprechen und uns tagsüber mit den Männern treffen konnten. Papi und Heinz fanden uns bald und blieben in unserer Nähe.
In einem großen Speisesaal bekamen wir zu essen. Es gab Kartoffelpüree mit Karotten und Bratensoße – es schmeckte ausgezeichnet. Jeder am Tisch hatte etwas zu erzählen.
Die Häftlinge hier in Westerbork waren, außer einer Gruppe von Zigeunern – für die Nazis ebenso verabscheuungswürdig wie Juden – und ein paar Christen, die Juden versteckt gehalten hatten, fast ausschließlich Juden. Als Neuankömmlinge waren wir natürlich erst einmal am schlechtesten dran. Obwohl die Holländer das Lager unter Aufsicht der Deutschen verwalteten, waren viele Juden damit betraut, für den reibungslosen Ablauf des Alltags zu sorgen. Einige dieser Juden kannte Papi von früher.
Mutti und Papi beratschlagten, was zu tun sei. »Ich will versuchen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ich schon vor dem Krieg kannte«, sagte Papi. »Einige davon sind in sehr einflussreichen Positionen. Wenn sie uns Arbeit verschaffen können, gelingt es uns vielleicht, uns unentbehrlich zu machen, und damit wären wir sicher.« Er glaubte, dass das unsere einzige Chance sei.
Und er tat sein Bestes. Einige Freunde erkannten ihn wieder und beteuerten, alles, was in ihrer Kraft stand, zu tun, um uns zu helfen. Für uns war es das Wichtigste, so lange wie möglich in Holland zu bleiben.
Einer von Papis Freunden, George Hirsch, arbeitete im Hauptbüro. Er versprach, uns Arbeit zu verschaffen. Er war aufrichtig, freundlich und entgegenkommend. Er teilte sogar seine Hemden mit Papi und Heinz, da keiner der beiden Kleidung zum Wechseln hatte.
Zu unserem Entsetzen kursierten Gerüchte, dass nächsten Sonntag ein großer Transport von Zigeunern nach Auschwitz gehen sollte und immer noch ein paar Güterwagen leer waren, die man mit Juden füllen wollte. Da wir erst kurze Zeit hier waren, hatte Herr Hirsch noch keine Gelegenheit gehabt, uns für irgendwelche Arbeiten einzuteilen, und wir befürchteten, dass wir unter den Unglücklichen sein würden.
Wir waren uns darüber im Klaren, dass dies der erste Schritt auf dem Weg zur Hölle war. Auschwitz lag in Polen, das dem Deutschen Reich angegliedert war. Über die BBC hatten wir erfahren, dass Auschwitz als Vernichtungslager galt.
Wir versuchten dennoch, einander zu ermuntern. Bestimmt würden sie uns nicht umbringen, solange wir körperlich auf der Höhe und arbeitsfähig waren.
Papi schärfte uns immer wieder ein, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Kameradschaft sei, dass wir einander so helfen konnten zu überleben. Auch über die Bedeutung von Sauberkeit und Hygiene sprach er mit uns. Nachdrücklich schärfte er mir ein, mich nicht auf einen Toilettensitz zu setzen und mir immer danach die Hände zu waschen.
Ein bisschen ahnte er aber wohl schon damals, dass wir auf diese Dinge keinen Einfluss haben würden.