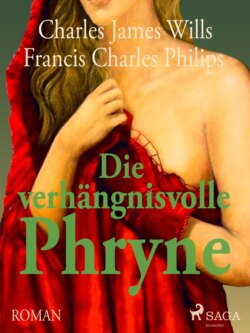Читать книгу Die verhängnisvolle Phryne - F. C. Phillips - Страница 4
Zweites Kapitel.
ОглавлениеUnter Nichtbeachtung der drei grossen dramatischen Einheiten bitten wir unsere Leser sich um achtundvierzig Stunden zurückzuversetzen.
Die Hitze in Paris war furchtbar. Die Boulevardbummler waren geflohen, die englischen und amerikanischen Vergnügungsreisenden waren zu Tausenden angekommen. Selbst das Quartier Latin war verlassen, denn die langen Sommerferien hatten eben begonnen, und wenn auch noch viele da waren, die allabendlich in ihre Wohnung zurückkehrten, so wandten sie doch tagsüber der heissen Stadt den Rücken und suchten sich in Auteuil oder sonstwo durch Bootfahrten auf dem Fluss, Landpartieen und Bäder zu erfrischen. Auch die Künstler waren alle fortgezogen, um malerische Gegenden aufzusuchen, und die besser Gestellten unter ihnen, die sich schon einen gewissen Namen gemacht hatten, suchten ihre Erholung in den zahlreichen Seeoder andern Badeorten. Der junge Leigh aber arbeitete noch tapfer in seinem grossen Atelier, das wahrscheinlich der kühlste Ort in Paris war, und Frau Pichon schob ihren alljährlichen Sommerausflug immer wieder hinaus.
Doktor Tholozans Behauptung, der selige Pichon sei als Millionär gestorben, war keineswegs übertrieben. Dieser hatte Fräulein Sophie Plon wegen ihrer unleugbaren Schönheit geheiratet, das heisst, er hatte einen herrlichen Teint, ein Paar strahlender, lachender Augen und ein Köpfchen, dessen Haare bis zu den Füssen der jungen Dame reichten, gegen sein Vermögen eingetauscht, und er hatte damit kein schlechtes Geschäft gemacht. Wo er mit seiner jungen Frau erschien, wurden die so erhandelten Güter allgemein bewundert. Allein der alte Herr sollte sich seines Triumphs nicht lange erfreuen. Sechs Monate nach der Hochzeit starb Herr Pichon und hinterliess alles, was er besass, bis zum letzten Pfennig seiner jungen Witwe. Während der ersten drei Monate war ihr Gram schrecklich anzusehen. Bei der blossen Erwähnung des seligen Pichon brach sie in Thränen aus. Sie hatte auf einer der schönsten Stellen des Père-la-chaise einen ungeheuren Sarkophag von weissem Marmor, ohne Rücksicht auf Kosten, errichten lassen. Ihr Vetter, Doktor Tholozan, hatte auf ihren Wunsch eine pomphafte lateinische Grabschrift verfasst, die in Buchstaben von vergoldeter Bronze an dem Sarkophag angebracht war. Die Witwe hatte sehr geschmackvolle und sehr tiefe Trauer angelegt und war täglich zur Messe gegangen, bis sie mit der Unbeständigkeit der weiblichen Natur die Trauer plötzlich wieder abgelegt hatte, weil der junge Leigh, — der als Künstler und folglich als Sachverständiger sprach — in einem schwachen Augenblick gesagt hatte, dass Schwarz ihr nicht gut stände. Schon am nächsten Tage erschien Frau Pichon in einem entzückenden Anzug in der blassesten Lavendelfarbe im Atelier, — denn da sie, wie erwähnt, eine nahe Verwandte des Doktors war, so verbrachte sie einen grossen Teil ihrer Zeit in dessen Haus. Sie vertrieb sich die Langeweile dadurch, dass sie dem jungen Maler als „Niobe, in Thränen schwimmend“ sass. Er hatte eben eine Studie von ihr als „Sigismonda, die in tiefer Trauer die goldene Kapsel betrachtet, die das Herz ihres Guiscardo umschliesst“, vollendet.
„Ah, Monsieur George,“ rief sie, als sie heute unerwartet in das Atelier des jungen Mannes trat, „Sie dürfen nicht schlecht von mir denken, weil ich das hässliche Schwarz abgelegt habe. Ich habe es nur aus Pflichtgefühl gethan, Monsieur George. Man muss es ertragen, schön zu sein, und ich habe meinen Empfindungen lediglich im Interesse der Kunst Gewalt angethan — und um Ihretwillen, lieber Monsieur George,“ fügte sie mit einem kleinen Seufzer hinzu. „Ich fühlte, dass es meine Pflicht sei, alles fernzuhalten, was Ihre göttlichen Eingebungen stören könnte. Me voici! Wie gefalle ich Ihnen?“ und dabei machte die strahlende Erscheinung einen kleinen Knix.
„Liebe Madame Pichon, Sie sind reizend, immer reizend, natürlich! Aber auf Ehre, wie eine Niobe sehen Sie weniger aus, als je.“
„Sie wollen doch nicht, dass ich immer Niobe bin, wie, lieber Monsieur George?“ fragte die junge Witwe mit einem allerliebsten Schmollen, und dabei funkelte etwas in ihren Augen, das möglicherweise eine Thräne war, das aber entschieden mehr wie ein Blick des Triumphs aussah. „Es ist mir einerlei, was Sie sagen,“ fügte sie schnippisch hinzu. „Niobe hätte doch auch nicht ewig weinen können.“
„Aber bedenken Sie doch, sie hat zwölf Kinder verloren, liebe Madame.“
„Zwölf!“ rief die Dame entsetzt. „Dann war’s mit ihrer Schönheit auch vorbei, und sie muss eine höchst langweilige Person, wenn nicht geradezu unanständig gewesen sein. Und ich muss sagen, ich kann es keineswegs als eine Schmeichelei Ihrerseits betrachten, dass Sie mich zum Modell für ein Frauenzimmer wählen, das zwölf Kinder gehabt hat.“
„Ah, Madame,“ erwiderte der Maler, sich entschuldigend, „für mich sind Sie die lebende Verkörperung untröstlichen Schmerzes gewesen.“
„In meinem Haar kann ich aber doch keinenfalls Schmerz zum Ausdruck bringen, und heute wollten Sie ja das Haar malen, nicht wahr, Monsieur George? Wird’s so gehen?“ fuhr sie fort, während sie sich träge in einen grossen Stuhl fallen liess und eine Stellung annahm, wie jemand, der sich photographieren lassen will. Frau Pichon war eine Dame, die ihre Reize ins beste Licht zu stellen wusste, denn sie war auf die Eroberung des Malers erpicht und fest entschlossen, ihn zu heiraten. Sie hatte kein Mittel unversucht gelassen, ihm alles, was ihre Persönlichkeit anziehend machte, vor Augen zu bringen. Bis jetzt aber hatte der junge Leigh noch durch kein Zeichen verraten, dass sich eine wärmere Empfindung in ihm rege; sie hatte ihm gesagt, wie reich, wie einsam, wie elend sie sei, aber alles vergeblich.
„Ah, liebe Madame,“ sagte Leigh, „ich darf es nicht wagen, Sie zu bitten, mir Ihre Zeit dadurch zu opfern, dass Sie mir für das Haar sitzen; das reizende Antlitz genügt vollständig für meinen Zweck.“
Frau Pichons Fuss, der für einen strengen Richter vielleicht etwas zu sehr in die Augen fiel, klopfte ärgerlich auf den Teppich, als sie diese schrecklich nüchterne Antwort des Malers hörte. „Und bitte, mein Herr, weshalb nicht?“
„Also erstens, liebe Madame Pichon, weil das Haar der Niobe aufgelöst und wirr sein muss, und es hiesse wirklich Ihre Güte auf eine allzuharte Probe stellen, wenn ich Sie bitten wollte, diese herrlichen Flechten aufzulösen.“
„Monsieur Leigh, es gibt nichts, was ich nicht um der Kunst willen zu thun bereit wäre. Sie machen sich nur über mich lustig; Sie sind gerade wie andre Männer. Männer sind immer sarkastisch und grausam,“ fügte die junge Witwe mit einem leisen Seufzer hinzu. „Ich weiss sehr wohl, was Sie sagen wollen. Sie bilden sich ein, dass das, was Sie in Ihrer grausamen, spöttischen Weise meine ‚herrlichen Flechten‘ nennen, nicht mein eignes Haar sei. Ich werde Sie sofort überzeugen. Hier, Monsieur George, und da! und da! und da!“ Und ehe der erstaunte Maler wusste, wie ihm geschah, hatte die entrüstete Kunstenthusiastin alle Kämme und Haarnadeln herausgerissen, und die wallenden kastanienbraunen Locken sanken in überreichen Wellen hernieder.
„Es ist alles eignes Wachstum,“ rief die Dame, wirklich gereizt. „Und nun vernehmen Sie Ihre Strafe. Ich verurteile Sie dazu, es nach Ihrem Belieben zu ordnen. Ich wiederhole, Monsieur George, es gibt kein Opfer, das ich nicht bringen würde, wenn ich die Kunst dadurch fördern kann.“
Der junge Maler errötete, aber er konnte weiter nichts thun, als gehorchen. Er trat auf die Erhöhung, auf der die Dame sass, und mit Fingern, die wie unter elektrischen Schlägen zuckten, ordnete er geschickt den üppigen Haarwuchs der Witwe des seligen Herrn Pichon. Als er sich darauf hinter seine Staffelei geflüchtet hatte, hielt er sich einige Minuten dort verborgen. In diesem interessanten Augenblick trat der Hauswirt des Malers und Vetter der Dame ins Zimmer.
„Bon jour, Sophie,“ begann Doktor Tholozan mit leichtem Nicken und liess dann ein leichtes Kichern hören. „Du nimmst wirklich den berufsmässigen Modellen das Brot vom Munde.“
„Sei ruhig, Felix; wenn nur ein einziges Haar verschoben wird, geht die ganze Wirkung verloren. Ich bin der personifizierte Jammer.“
„Das weiss ganz Paris,“ entgegnete er. „Ja, die Aehnlichkeit ist verblüffend, Liebste. Du bist augenscheinlich das Original der ‚Dame mit der Mähne‘, der Zauberin, die uns als Reklame eines amerikanischen Haarwuchsmittels in zwanzigfacher Lebensgrösse anlächelt. Leigh, ich gratuliere, wahrhaftig, ich gratuliere euch beiden.“
„Felix, ich schäme mich deiner,“ sagte die Dame. „Es gibt wirklich nichts, was deinem Witz heilig ist. Ich bin Niobe, mein Herr!“ fügte sie würdevoll hinzu.
„O, sehr möglich, meine Liebe, sehr möglich. Alles, was dir gefällt. Vom Standpunkt des Arztes aus möchte ich sagen, du seiest die Göttin der Gesundheit. Aber ich will nicht länger stören. Adieu, Niobe, leb’ wohl, Galatea, au revoir, Pygmalion, wir treffen uns beim Diner,“ und er verschwand diskret.
„Das ist wieder ganz Felix,“ sagte die Dame. „Wir waren so hübsch im Zug, und es war so gemütlich,“ fügte sie, wie ein Kätzchen schnurrend, hinzu, „da muss er hereinkommen und uns beide aus der Stimmung bringen, und er hat mich veranlasst, meinen Kopf zu drehen und aus der richtigen Stellung zu kommen. Ich bin ernstlich böse auf Felix. Was würde er wohl denken, wenn ich während seiner Sprechstunde in sein Konsultationszimmer käme, das möcht’ ich wohl wissen? Sie müssen wieder alles in Ordnung bringen,“ fuhr sie kokett fort, und der Künstler kam, errötend wie eine Päonie, aus seinem zeitweiligen Versteck hervor.
„O, ich weiss, was Sie gern thun möchten,“ fuhr die Dame fort. „Sie vergehen vor Verlangen zu rauchen. Ich bin ganz fest überzeugt, wenn ich ein gewöhnliches Modell wäre, würden Sie ohne Umstände rauchen. Tabaksrauch ist mir nicht im geringsten unangenehm, wahrhaftig, ich bin daran gewöhnt, denn der selige Pichon rauchte vom Morgen bis zum Abend. Sie werden ganz entsetzt sein, wenn ich Ihnen ein Geheimnis anvertraue. Er hat mich das Rauchen auch gelehrt, und sogar, eine Cigarette zu drehen. O, lassen Sie mich Ihnen eine Cigarette machen, ich kenne keinen grösseren Spass,“ und Niobe machte sich daran, mit ihren zierlichen Fingern einen kleinen weissen Cylinder aus türkischem Tabak zu drehen, denn sie hatte die dazu nötigen Materialien, zum Gebrauche bereit, auf einem grossen eichenen Tisch in der Nähe der Staffelei entdeckt. Als sie damit fertig war, überreichte sie Leigh ihr Machwerk mit einem gefälligen Knix und hielt ihm ein brennendes Streichhölzchen vor; dann drehte sie gewandt eine zweite Cigarette, und sich behaglich in den grossen Lehnstuhl kauernd, begann sie mit augenscheinlichem Genuss zu rauchen. „Sind Ihnen Unterbrechungen nicht sehr verhasst, Monsieur Leigh?“ fragte sie nachdenklich.
„In Ihrer Gesellschaft, Madame, müssen sie das jedem sein.“
„O, natürlich! Etwas andres konnten Sie ja gar nicht sagen, Monsieur George. Ob’s wohl wirklich Ihr Ernst ist?“
„Ehrlichkeit ist eine meiner wenigen Tugenden, Madame. Sie ist mir ost genug sehr nachteilig gewesen. Das Hässliche und Abstossende kann ich nicht malen, denn es ist mir die Gabe versagt, es zu mildern, ich bin faktisch eine Art unbarmherziger menschlicher Camera und — ich male die Leute so, wie mein Auge sie mir zeigt, und nicht so, wie sie gern aussehen möchten. Ich kann die Pfeffernüsse nicht vergolden, und ich kann nicht schmeicheln. Ich wollte, ich könnte es. Ich bin viel zu aufrichtig, Madame Pichon. Betrachten Sie sich zum Beispiel ’mal dies,“ dabei zog der junge Mann ein Bild hervor, welches, gegen die Wand gekehrt, neben der Staffelei stand. Es war ein grinsendes Porträt, und es zeigte so viel Frechheit und Verworfenheit, wie man sich im Angesichte eines anscheinend jungen und hübschen Weibes nur denken kann. „Das ist Mademoiselle Saint Ventadour vom Palais Royal,“ sagte Leigh. „Sie stellte mir den Antrag, sie als ‚Comédie‘ zu malen. Alle Welt hält sie für sehr bezaubernd und anziehend, mit einem Wort, sie ist jetzt Mode. Ich kann nichts Anziehendes an ihr finden, für mich ist sie weiter nichts, als eine grinsende Larve.“ Frau Pichon lächelte beifällig. „In einem schwachen Augenblick nahm ich den Auftrag an. Sie kam mit einer sehr achtbar aussehenden Mama hierher, die alle drei Minuten eine Prise nahm.“
„Schrecklich!“ rief Frau Pichon. „Ich bedaure Sie aufrichtig, Sie armer Monsieur George.“
„O, das ist noch nichts im Vergleich mit dem, was noch kommt. Ich hatte ihr nicht gestattet, das Bild zu sehen. Am Schluss der dritten Sitzung bestand sie aber darauf, und es war nichts zu machen. Ich drehte also die Staffelei herum, und wenn ich jemals ein wütendes Weibsbild gesehen habe, so war es da. Anfänglich war sie sprachlos, dann wurde sie totenblass, ballte die Fäuste und stampfte mit dem Fusse. ‚Herr!‘ schrie sie mit ihrer schrillen, durchdringenden Stimme — denn das Weib sprach, nicht die Schauspielerin — ‚ich hatte Sie beauftragt, mich als Muse des Schauspiels zu idealisieren, Sie aber haben eine nichtswürdige, erbärmliche und infame Karikatur gemacht. Sie haben mich als‘ — und hier schluchzte sie bitterlich — ‚als — ein leichtfertiges Frauenzimmer dargestellt, Monsieur Leigh. Aber ich werde mich rächen, ich bin nicht ganz ohne Freunde! Sie werden Sie in den Zeitungen herunterreissen, sie sollen Sie vernichten, verderben! Komm, Mama. Lass uns das Atelier dieses erbärmlichen Menschen verlassen, der sich nicht scheut, ein schutzloses junges Mädchen‘ (sie ist wenigstens vierzig) ‚zu beschimpfen.‘ Mit einer entrüsteten Handbewegung warf sie eine schöne Vase von alter Fayence auf den Boden, die natürlich in tausend Stücke zerschellte, und dann verliess sie das Atelier. Sie sehen also, welche Verlegenheiten mir meine Ehrlichkeit bereitet hat, denn ich habe sie so gemalt, wie ich sie sah. Sie ist ein leichtfertiges Frauenzimmer, wenigstens in meinen Augen.“
„Drehen Sie das Bild wieder herum,“ sagte die Witwe mit einem hübschen Zusammenschauern, „ich fürchte mich davor. Aber Ihre Erzählung erinnert mich daran, dass ich die Niobe auch noch nicht gesehen habe. Sagen Sie mir, Monsieur Leigh,“ und sie legte die Hand bittend auf den Arm des Malers, „Sie haben doch nicht auch ein leichtfertiges Frauenzimmer aus mir gemacht?“
Leigh würde wohl kaum so bereit gewesen sein, seine Staffelei umzudrehen, wenn die noch unvollendete Niobe nicht ein wirklich gutes Bild gewesen wäre. Es war in der That reizend; Frau Pichon war entzückt und klatschte in beinahe kindischem Jubel in die Hände. Und doch hatte der Maler seinem hübschen Modell nur Gerechtigkeit widerfahren lassen. Allerdings war es das Bild eines schönen Weibes in Thränen, aber wenn die Niobe dort auf der Leinwand Mutter von zwölf Kindern war, so sah man ihr ein dementsprechendes Alter nicht an. Der Künstler hatte die junge Witwe etwas idealisiert und aus einem Kinde dieser Erde eine Art weinenden Engel gemacht. Die grossen schwarzen Augen blitzten den Beschauer mit einem sehnsüchtig liebenden Blick an, der freilich den Ausdruck, mit dem die hübsche Frau Pichon Doktor Tholozans Mieter gewöhnlich ansah, getreu wiedergab. Er konnte ihr den Namen Niobe oder die Peri am Himmelsthor oder irgend eine andre romantische Bezeichnung geben. Man sah zwar ein Weib in Thränen, aber diese machten den Eindruck, als ob sie weder sehr bitter seien, noch sehr schwierig zu trocknen. Niobe war in der That so unleugbar hübsch, dass jeder gewöhnliche Beschauer Anstoss an dieser Auffassung einer Niobe genommen haben würde.
„Und Sie behaupten, dass Sie niemals schmeicheln, Monsieur? Sagen Sie mir ’mal ernstlich, gefällt’s Ihnen — mein Porträt, denn es ist mein Porträt? O, Monsieur George!“ rief die junge Witwe aufspringend. „Wie kann ich Ihnen danken?“ und sie ergriff seine beiden Hände.
Es ist immer eine verfängliche Lage für einen jungen Mann, wenn eine hübsche Frau ihn bei beiden Händen fasst, ihm mit überschwenglichen Worten dankt und ihn mit liebeglühenden Augen anblickt. Das sind Erfahrungen, welche gewöhnliche Männer nicht häufig machen, aber Künstler sind bevorzugte Leute. Wäre Leigh ein gewöhnlicher junger Mann gewesen, so würde er sofort auf die Kniee gestürzt sein und Frau Pichon Herz und Hand angetragen haben. Eine bessre Gelegenheit konnte sich ihm schwerlich bieten. Frau Pichon wäre jedenfalls selig und Doktor Tholozan ganz einverstanden gewesen, und die Gesellschaft würde in beifallspendendem Chor in ihre wohlbeschuhten Hände geklatscht haben. Leighs zahlreiche Freunde unter dem leichtlebigen Künstlervölkchen würden ihm zustimmend den Rücken fast wund geklopft und ihn einen „verfluchten Kerl“ genannt haben. Aber Künstler sind eben keine gewöhnlichen Menschen. George Leigh hielt der hübschen Frau Pichon Hände ruhig fest, versäumte es aber, deren begeisterten Druck zu erwidern, und machte nur einige hervorragend alberne Redensarten. Es war kein Blick der Liebe, womit er ihr ins Gesicht starrte und in ihre grossen, träumerischen schwarzen Augen sah, sondern nur eine Art künstlerischer Bewunderung. Frau Pichon hatte das Gefühl, als ob sie mit kaltem Wasser begossen würde und als ob etwas in ihrer Kehle emporstiege, als er statt der erwarteten Liebeserklärung einfach hervorstotterte: „Nein, Madame, ich bin nicht damit zufrieden. Ihre Augen gehen über meine Kräfte. Wenn Sie mir noch eine Viertelstunde gewähren können, will ich versuchen, ob ich mit dem Haar zustande komme.“
Nicht einmal die Cigarette hatte der Elende ausgehen lassen.
„Wie es Ihnen beliebt,“ sagte die Dame enttäuscht, und als der junge Mann sie nun zu ihrem Sitz zurückführte, sah sie mehr wie eine Niobe aus, als je zuvor.
Ruhig ordnete — oder richtiger, verwirrte — der Maler noch einmal das üppige Haar und zog sich dann wieder hinter seine grosse Leinwand zurück.
„Der Elende!“ sagte die Witwe bei sich, „der kalte, fischblütige, unbeholfne Tropf! Wie verschieden, wie so ganz anders würde sich der selige Pichon unter solchen Umständen benommen haben.“ Und ihre Gedanken wanderten unwillkürlich nach dem grossen Marmordenkmal auf dem Père-la-chaise, und zwei Thränen wirklichen Schmerzes — oder Aergers erschienen zwischen den langen seidnen Wimpern, welche die lieblichen Augen beschatteten.
Ja, George Leigh war augenscheinlich, was die Franzosen einen „Joseph“ nennen, ein herzloser, boshafter Joseph der schlimmsten Sorte.
„Mache ich Ihnen nicht sehr viel Mühe?“ fragte die verliebte Witwe nach einer langen Pause.
„Mühe, liebe Madame? Nein, wahrhaftig nicht! Sie sind das beste Modell, das man sich wünschen kann. In der Regel schwätzen die Modelle, und Sie haben gewiss seit zehn Minuten kein Wort gesprochen. Und dabei schwätzen sie meist Unsinn — und was für Unsinn! Wollen Sie so freundlich sein, das Kinn etwas zu heben, ich möchte versuchen, ob ich nicht den Lichtschimmer auf dem Haar festhalten kann.“
„Ah,“ dachte Niobe, als sie that, wie er gebeten, „an das Bild denkt er, nicht an mich. Ich glaube wahrhaftig, er betrachtet mich nur als eine Art lebendiger Gliederpuppe.“ Und sie warf einen feindseligen Blick nach der lebensgrossen Gelenkfigur von Papiermaché, die, als Niobe fertig drapiert, in einer Ecke des Ateliers stand. „Und was werden Sie mit mir anfangen, wenn ich vollendet bin, Monsieur Leigh?“ fragte sie nicht ohne Spannung.
„O, ich werde Sie nach dem ‚Salon‘ schicken,“ erwiderte der Maler in ruhigem, befriedigtem Ton.
„Und mich verkaufen?“ sagte die Witwe feierlich.
„Du lieber Himmel, nein,“ entgegnete der Künstler und betrachtete sein Werk mit halbgeschlossenen Augen. „Ich habe Sie schon lange verkauft. Israels nimmt alle meine Bilder.“
Die Witwe seufzte leise, aber dieser Seufzer ging an den Ohren des Enthusiasten vor der Staffelei ungehört vorüber.
Und wieder herrschte tiefes Schweigen.
Das war wirklich herzlose Undankbarkeit! Darum also hatte die schöne Frau Pichon so viele tödlich lange Stunden gesessen, als ob sie versteinert wäre, nur damit ihre lieblichen Züge von einem geldgierigen Fremden wiedergegeben und für die schmutzigen Banknoten eines filzigen Handelsjuden verschachert würden? Nein! Fleisch und Blut vermochten das nicht zu ertragen. Und die hübsche Frau Pichon, die unzweifelhaft von Fleisch und Blut war, sprang entrüstet auf.
„Ich fühle mich nicht ganz wohl, Monsieur Leigh,“ sagte sie mit Thränen in der Stimme. „Es gibt Augenblicke, in denen die Erinnerung an meinen lieben armen Pichon und der Gedanke an das, was ich mit ihm, dem von mir geschiedenen Engel, verloren habe, mich überwältigt. Sie müssen mich jetzt entschuldigen,“ fügte sie hastig hinzu, während sie ihre kastanienbraunen Flechten vor Leighs grossem venetianischen Spiegel sorgfältig wieder ordnete. Es waren zornige Augen, deren Glanz das Glas zurückwarf!
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, liebe Madame,“ sagte der Maler.
„Sprechen Sie jetzt nicht mit mir, Monsieur Leigh,“ rief sie, ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung abwehrend; „mein Herz ist zu voll.“ Mit diesen Worten schoss die ergrimmte Witwe aus dem Zimmer und schmetterte die Thür ins Schloss, wie sie noch niemals zugeworfen worden war.
„Weiber sind doch sonderbare Geschöpfe,“ murmelte Leigh für sich, während er fortfuhr, nach der Erinnerung Lichter und Schatten in dem Haar aufzusetzen. „Sie muss Monsieur Pichon aber doch innig geliebt haben, das arme Kind.“ Und dann fing er an zu pfeifen:
„Je suis le mari de la reine —
Ri de la reine, ri de la reine.“