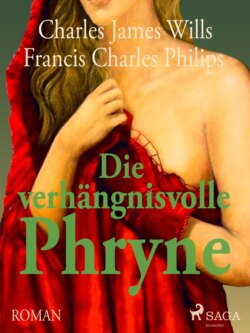Читать книгу Die verhängnisvolle Phryne - F. C. Phillips - Страница 6
Viertes Kapitel.
ОглавлениеDoktor Tholozans Flitterwochen waren mehr als zur Hälfte vorüber. Den ersten Teil hatte er in Folkestone verlebt, und jetzt wollte das neuvermählte Paar die Freuden des Landlebens und die Süssigkeiten des dolce far niente geniessen.
Für den Augenblick gaben sich Doktor Tholozan und seine Frau mit vollen Zügen diesem Genuss hin. Dem äussern Anschein nach waren sie von nagenden Sorgen jeder Art frei. Die junge Frau hatte keine Veranlassung, tägliche, schreckliche Verhandlungen mit der Köchin zu fürchten, denn die aufmerksame Fürsorge der Frau Pouilly hatte für die Villa „die beiden Grenadiere“ eine Künstlerin von unübertrefflicher Vorzüglichkeit in Dienst genommen, eine Frau von feiner Empfindung und fruchtbarer Einbildungskraft, welche die dreihundert Speisezettel des Baron Brisse an den Fingern herzählen konnte, eine gewissenhafte Frau, die sich eher in ihrem eignen Backofen zu Tode geröstet, als eine schlechte Mahlzeit auf den Tisch geschickt haben würde. Weder der Doktor noch seine Frau hatten England früher schon besucht gehabt, und die Ereignisse des täglichen Lebens in dem englischen Badeort war ihnen gewissermassen eine Offenbarung gewesen. Jetzt aber waren sie wieder in Frankreich und hatten sich auf vierzehn Tage in der reizenden kleinen Villa bei Banquerouteville, welche Einheimischen und Fremden unter dem Namen „die beiden Grenadiere“ bekannt ist, niedergelassen. Die Villa war das schönste, was ein neuvermähltes Paar sich zu vorübergehendem Aufenthalt wünschen konnte. Sie stand in einem kleinen Garten, einem Eden en miniature, in welchem nicht nur ein, sondern viele Apfelbäume wuchsen. Da gab es Lauben, ländliche Hütten und Sommerhäuschen, eine Grotte und einen Springbrunnen und Blumen in Hülle und Fülle, und das Klima von Banquerouteville ist, wie männiglich bekannt, ebenso balsamisch, wie gesund. Auch Obst war im Ueberfluss vorhanden, aber die Erdbeerzeit war vorüber, und die einzigen gegenwärtig reifen und essbaren Früchte in dem grossen, schattigen Garten waren Johannisbeeren, denen es etwas an Poesie fehlt, und die noch prosaischeren Stachelbeeren.
Doktor Tholozan und seine Frau waren in dem Garten umhergewandelt; sie hatten Stachelbeeren gegessen und alle Sehenswürdigkeiten von Banquerouteville-sur-Mer bewundert, und zweimal jeden Tag hatten sie eine Spazierfahrt auf staubigen Landstrassen und hübschen, heckenumsäumten Wegen gemacht. Aber, die Wahrheit zu gestehen, das Paar fühlte sich ein ganz, ganz klein wenig gelangweilt — ohne jedoch diese Thatsache, auch sich selbst gegenüber, auch nur einen Augenblick einzuräumen. Der Doktor rauchte etwas mehr, als gut für ihn war, und hatte etwas Heimweh nach seinen Patienten, seinem Klub und seinen ruhigen Abenden im grossen Atelier. Für einen Mann von sechzig Jahren hat es seine Schwierigkeiten, Gegenstände für die Unterhaltung mit einer neunzehnjährigen Frau zu ersinnen, und was kann wohl ein Mädchen von neunzehn einem Mann von sechzig zu erzählen haben? Einem jüngern Mann würde die goldige Zukunft Gesprächsstoff genug geliefert haben; mit sechzig Jahren ist jedoch die Zukunft für die meisten ein etwas peinlicher Gegenstand, und je weniger über die Vergangenheit gesagt wird, um so besser ist es.
Das Ehepaar sass in einer Laube auf bequemen Sesseln, durch dichtes Weinlaub vor den feurigen Strahlen der Nachmittagssonne geschützt. Sie starrten in die Massen des sonnendurchglühten Blätterwerks, wahrscheinlich aus demselben Grunde, aus welchem die Sterne auf uns herabblicken, nämlich, weil sie nichts besseres zu thun haben. Endlich brach der Doktor das Schweigen.
„Helene,“ sagte er, „ich fürchte, du musst deine jungen Gefährtinnen und das Leben in Madame Pouillys Hause vermissen.“
„O nein,“ erwiderte das Mädchen mit einem sonnigen Lächeln, „mir ist alles neu, die ganze Welt liegt vor mir, und ich bin nicht mehr ohne Freund, Felix,“ fügte sie mit einem allerliebsten Erröten hinzu, während sie ihre zarten Finger mit den reizenden Grübchen an den Knöcheln auf die weisse, kalte Hand des Doktors legte.
Ihr Gatte blickte sie mit einem erfreuten Lächeln an. Es war das erste Mal, dass sie ihn mit seinem Vornamen angeredet hatte.
„Bei Madame Pouilly war es wirklich sehr triste,“ fuhr das junge Mädchen fort. „Dort waren wir nur Maschinen, und jede Stunde der Woche hatte in langweiliger Einförmigkeit ihre vorher bestimmte Beschäftigung. Und dann mussten wir so früh aufstehen. Jetzt stehe ich mitten in einem Wirbel; immer gibt es etwas Neues und Aufregendes. Unsre Reise nach England und die sonderbaren, feierlichen Menschen, die wir dort sahen, die so wenig sprachen und so viel assen, werde ich nie vergessen. Und dann muss ich immer an die beiden englischen Sonntage denken, und wie trübselig alle die guten Leute aussahen. In Paris ist es doch nicht so, in Paris sind die Leute lustig, nicht wahr?“
„Ja, das ist unsre Beschäftigung in Paris, das traurige Geschäft unsres Lebens,“ sagte der Doktor mit einem tiefen Seufzer. „Wir sind ziemlich lustig in Paris, selbst die ganz Armen. Aber du darfst doch nicht zu viel erwarten, Helene, mein Kind, du wirst finden, dass es auch in Paris noch genug des Traurigen gibt, um den Wunsch in dir wachzurufen, dass du niemals dein stilles Heim bei Madame Pouilly verlassen hättest.“
„O, ich werde so viel zu thun und zu bedenken und zu lernen haben! Ach, ich sehne mich so sehr danach, mein neues Heim zu sehen.“
„Das that auch Madame Blaubart, mein Kind. Und sie war auch ohne Zweifel dort glücklich genug, bis ihr der Schlüssel zu dem geheimnisvollen Schrank in die Hände geriet und ihr Mann ihr den Kopf abschlagen wollte.“
„Aber er hat ihr doch den Schlüssel gegeben, Felix. Er muss sie doch sehr gern gehabt haben, wenn er das that.“
„Sie hat ihn ihm wahrscheinlich abgeschmeichelt, mein Kind.“
„Wenn er sich den Schlüssel abschmeicheln liess, kann er doch nicht so schlecht gewesen sein.“
„Das weiss ich doch nicht. Ihre fünf Vorgängerinnen hatten ihm ohne Zweifel auch der Reihe nach geschmeichelt, aber Boulotte fand sie trotzdem alle in dem blauen Schrank hängend, minus ihre kleinen Finger.“
„Aber das ist ein Märchen, und zu Hause gibt’s keinen blauen Schrank,“ — die Worte „zu Hause“ sprach das Mädchen mit einem liebevollen Zögern aus — „nicht wahr, Felix?“
Der Doktor lachte.
„Ausserdem,“ fuhr sie fort, „hast du auch nicht das geringste von einem Blaubart an dir.“
„Na, na. Ich bin ein schrecklich eifersüchtiges Ungetüm.“
„Nun, wenn du darauf bestehst, für einen Blaubart gehalten zu werden, Felix, dann erzähle mir doch ’mal etwas von meinen unglücklichen verstorbenen Nebenbuhlerinnen.“
„Ich bin keineswegs sicher, ob sie wirklich alle tot sind, mein Kind, namentlich Nummer eins. Sie hiess Ehrgeiz, und ich glaube, ich liebe sie noch immer.“
„Bleib ihr treu, Felix, und ich werde dich nur um so höher achten — und lieben,“ und die helle Farbe ihres schneeigen Nackens verwandelte sich in ein zartes Rosa. „Und die Uebrigen?“
„Die nächste hiess Geiz. Aber als mein armer Bruder starb, habe ich mich von ihr losgesagt, und sie ist schon lange begraben. Die Namen der andern drei habe ich vergessen, Madame Tholozan, seit ich das Vergnügen hatte, Ihre Bekanntschaft zu machen,“ sagte der Doktor mit einer altmodischen Höflichkeit, die ihm gar nicht schlecht stand.
„O, Vormund!“ rief das junge Mädchen, sich unbewusst wieder der Anrede bedienend, an die sie bis vor kurzem gewöhnt gewesen war, „wenn du nur wüsstest, wie gern junge Mädchen eine kleine Schmeichelei haben. In der Schule hört man so ’was nicht.“
„Doktor Tholozans Gattin wird in Paris genug zu hören bekommen und sie nach ihrem wahren Wert schätzen lernen, wie ich hoffe,“ fügte der Doktor hinzu.
„Und sehnst du dich noch nicht nach Haus, Felix?“ fragte Helene nach einer gedankenvollen Pause.
„Für einen Mann in meinem Alter, mein Kind, wird Gleichmässigkeit des täglichen Lebens eine Art von Notwendigkeit, aber dies Heraustreten aus ihr war sehr angenehm. Vielleicht wird es dich nicht kränken, Helene, wenn ich dir sage, dass ich mich niemals so glücklich gefühlt habe, als seit unsrer Verheiratung.“ Der Doktor sah zwanzig Jahre jünger aus, als er diese Worte sagte, und wieder stieg das verräterische Rot in die sprechenden Züge seiner Gefährtin.
„Ich glaube, Helene,“ fügte er hinzu, „du wirst es zu Hause vielleicht weniger langweilig finden, als hier oder bei Madame Pouilly, du wirst wenigstens Gesellschaft haben.“
„Die habe ich ja jetzt auch, Felix.“
„Aber Gesellschaft deines Alters, Kind.“
„Ja, Madame Pichon ist noch sehr jung, nicht wahr? Die Arme! Wie sehr sie leiden muss!“
„Im Gegenteil, mein Kind, Sophie ist die Heiterste der Heitern.“
„Dann wird sie mir wohl schwerlich gefallen, Felix.“
„Sophie hat noch niemand missfallen. Du und sie, ihr werdet geschworene Freundinnen werden, noch ehe ihr eine halbe Stunde beisammen seid. Alle Welt erklärt Sophie für reizend, und alle Welt muss doch recht haben.“
„Aber der Verlust, den sie erst vor so kurzer Zeit erlitten hat, Felix?“
„Sie weiss ihn zu tragen, mein Kind. Alles wird denen zu teil, die zu warten verstehen, selbst ein zweiter Mann. Ich würde durchaus nicht überrascht sein, wenn ich bei unsrer Rückkehr hörte, dass Sophie sich getröstet hat. Mein Freund, der Maler, scheint einen grossen Teil ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen, und Sophie sagt, für die Kunst könne sie alles thun, und ich zweifle keinen Augenblick, dass sie das ganz ernst meint, zumal wenn die Kunst durch einen jungen Maler von einnehmender Erscheinung verkörpert wird.“
„Sie lieben sich also?“
„Das wirst du ja selbst herausfinden, wenn du sie siehst, mein Kind. Hier ist ein Brief von ihr, den ich heute morgen erhalten habe; du kannst ihn lesen.“
Madame Tholozan ergriff den Bogen schweren, parfümierten Papiers, den ihr Gatte ihr reichte, und las:
„Lieber Vetter Felix!
Wir sehnen uns sehr nach eurer Rückkehr, — wenn ich sage ‚wir‘, so meine ich damit Mr. Leigh und mich, — ebenso, wie alle unsre Bekannten, denen ich das reizende Bild Deiner Frau gezeigt habe, und die alle, besonders die Männer, vor Verlangen vergehen, sie persönlich kennen zu lernen. Die Schicklichkeit gestattet mir natürlich jetzt nicht, ohne weibliche Begleitung in Dein Haus zu gehen, obgleich der Auftrag, Madame Tholozans Boudoir einzurichten, meine tägliche Anwesenheit dort zur Notwendigkeit macht. Monsieur Leigh hat mir den Vorzug seines kunstverständigen Rats zu teil werden lassen, und das Ergebnis ist reizend. Er war Feuer und Flamme für die Sache und hat die Freundlichkeit gehabt, mich in alle Möbelmagazine zu begleiten. Du musst uns beiden sehr dankbar sein. Es war ein Werk der Liebe, aber manchmal kam ich furchtbar in Verlegenheit, denn die Leute in den Läden hielten mich ganz hartnäckig für Georges Braut, und daraus sind schreckliche Verwicklungen entstanden. Wäre ich eine eitle Frau, so könnte ich mir einbilden, er mache gern Einkäufe mit mir, aber mein Verstand sagt mir, dass er sich für seinen alten Freund so opferwillig gezeigt hat. Und nun muss ich noch eine Verschwendung eingestehen. Ich habe, ohne dass es George weiss, das Bild der Niobe von dem abscheulichen Monsieur Israels gekauft. Nie in meinem ganzen Leben habe ich mich so furchtbar geärgert, als da mir George ganz kaltblütig mitteilte, er habe es verkauft. Wenn er nicht in Geldangelegenheiten so ausserordentlich sorglos wäre, würde ich ihn für habgierig halten. Und dazu war er bei der Gelegenheit noch recht unartig. Als ich mein Erstaunen aussprach, sagte er: ‚Niobe war doch nur ein Küchendragoner.‘ Hat er sich wirklich unterstanden, mich mit einer Köchin zu vergleichen, oder hat er nur andeuten wollen, dass das, was der selige Pichon ‚meine reizende Fülle‘ nannte, in prosaische Dicke ausartet? Ich glaube, das Ungeheuer meint, ich würde zu stark. Ich weiss leider nur zu wohl, dass Dickleibigkeit das unangenehme Ende ist, dem Schönheiten meines anziehenden Typus unabänderlich verfallen. Du, Felix, als mein Vetter und Ehrenleibarzt, hast mir das oft genug mit der grausamen Rauheit der ernstern Männer Deines Berufs gesagt. Ich habe versucht, George alles zu erklären; ich habe ihm gesagt, dass ich monatelang eine besondre, schreckliche Diät befolgt und ekliges Zeug gegessen, und dass ich mir sogar Bonbons versagt habe, ein Trost, zu dem junge Frauen in meiner Lage gewöhnlich ihre Zuflucht nehmen. An demselben Nachmittag bin ich aber mit ihm durch die Champs-Elysées gefahren, und wir haben bei dem kleinen Châlet am Teich Eis gegessen, aber nicht deswegen habe ich das Châlet besucht — obgleich es dort bekanntlich das beste Eis in ganz Paris gibt. Nein, ich hatte einen prosaischern Zweck. Ich wollte mich wägen lassen, und ich bin gewogen worden. Fünfundsiebenzig Kilo, Felix, nicht ein Centigramm mehr! Ich habe kein Wort gesagt, aber ich habe ihm einen triumphierenden Blick zugeworfen, der ihn völlig ausser Fassung zu bringen schien, und dann teilte er mir eine sehr interessante künstlerische Thatsache mit, denn er erzählte mir, fünfundsiebenzig Kilo sei genau das Gewicht der mediceischen Venus. Aber das war nicht das Ende meines Triumphs. ‚Ihre Venus von Medici,‘ sagte ich, ‚mag fünfundsiebenzig Kilo gewogen haben; ich bezweifle aber sehr, dass sie Handschuh Nummer sechs getragen hat, wie ich.‘ Ich hielt ihm meine Hand hin und zu meinem grössten Aerger, bang! platzte mein linker Handschuh über die ganze innere Handfläche. (Dieser Brief ist natürlich vertraulich, und Du darfst ihn unter keiner Bedingung Deiner Frau zeigen. Selbstverständlich thust Du das doch, das ist ganz sicher, denn, wie ich meinem armen seligen Pichon so oft gesagt habe: kein grössrer Narr, als ein alter Narr.) Und nun muss ich Dir noch einen guten Rat geben. Wenn Du Dich nicht unglaublich lächerlich machen willst, ist es ganz und gar unmöglich, dass George in derselben Weise weiter mit Dir lebt, wie bisher. Die Anwesenheit einer jungen, reizenden und wahrscheinlich falschen Frau — denn alle hochblonden Frauen sind falsch — würde ihn bei seiner Arbeit sehr stören, und da er thatsächlich bezüglich seines Lebensunterhalts einzig und allein auf seine Kunst angewiesen ist, so wäre das wirklich zu bedauern. Seit ich ihm als Sigismonda und Niobe gesessen habe, ist mir oft der Gedanke gekommen, dass es besser für ihn wäre, wenn er heiratete; denn wenn seine Frau wirklich hübsch wäre, so könnte er die geradezu unglaublichen Summen ersparen, welche er jetzt für Modelle verschwenden muss. Es ist für einen jungen Mann doch recht schlimm, wenn er sich so fortwährend ungestört in der gefährlichen Gesellschaft einer Reihe junger und nicht allzu spröder Frauenzimmer von bedenklich einnehmender Erscheinung bewegt. Als ich ihm eine dahin zielende Andeutung machte, meinte er, er wolle zunächst abwarten, welchen Erfolg die Sache bei Dir habe, und dann seinen Beobachtungen gemäss handeln. Um jedoch auf das zurückzukommen, was ich oben gesagt habe: Monsieur Leigh kann nicht mehr hier wohnen. Als ich ihm klar zu machen suchte, dass das unpassend sein würde, meinte er, Du würdest das wohl selbst am besten beurteilen können; er werde nie ein Atelier finden, das ihm so gut passe, als sein jetziges, und die Art, wie er die Photographie Deiner Frau fortwährend betrachtet, ist wirklich eine schwere Geduldsprobe. Er behauptet, er studiere sie, und er hatte die Kühnheit, die Frage auszusprechen, ob sie ihm wohl sitzen werde. Ich wies darauf hin, wie unmöglich und ungehörig das sein würde, und darauf entgegnete er mit wirklich frevelhafter Undankbarkeit, er könne nicht einsehen, weshalb sie, seines alten Freundes Frau, ihm nicht sitzen sollte, da doch ich, seines alten Freundes Cousine, ihm auch gesessen hätte. Wir hätten uns beinahe darüber gezankt, und wenn er jetzt schon so ist, Felix, wie wird er sich erst anstellen, wenn sie wirklich hier ist, namentlich, wenn sie ihn ermutigt, was sie sicherlich thun wird? Ich vergehe vor Sehnsucht, meines Vetters Gattin schwesterlich zu begrüssen. Bitte, sag dem lieben Kind, dass, so niedergebeugt ich auch durch meinen kürzlichen Verlust bin, ich doch noch ein Plätzchen in meinem Herzen für sie habe. Komm, sobald Du kannst, Felix. Ihr müsst ja jetzt beide des parfait d’amour überdrüssig sein, und ich habe eine grosse Sehnsucht nach den glücklichen Abenden im grossen Atelier. Vergiss nicht, kein Wort zu George in betreff der Niobe! Lebe wohl! Stets Deine liebevolle, aber trostlose Cousine
Sophie.“
Mann und Frau blickten einander an. Der Doktor lächelte, und Frau Tholozan brach in ein silberhelles Lachen aus.
„Madame Pichon,“ sagte sie, „erzählt uns sehr viel von ihrem Freund. Besteht da ein zartes Verhältnis?“
„Mein Kind, meine Cousine hat sehr ausgesprochene Neigungen. Ich bin übrigens der Ansicht, dass sie beide etwas Schlimmeres thun könnten. Sie ist leicht hingerissen und sehr reich, und er ist ein Träumer, aber ein verständiger Träumer, trotz alledem. Sie werden dir, glaube ich, beide gefallen.“
Der Doktor schloss die Augen. Er machte das Vorrecht des Ehemanns geltend und glitt rasch ins Land der Träume.
Helene schlief nicht, doch auch sie träumte; aber es waren Tagesträume, — die strahlenden, sonnigen Tagesträume eines unerfahrenen Mädchens. Die Aussicht auf den Verkehr mit den beiden Liebenden, welche sich jetzt augenscheinlich fortwährend missverstanden; die unbekannten Freuden der heitern Welt, die vor ihr lag und welche die goldnen Herrlichkeiten der grossen Stadt des Vergnügens so bald vor ihr aufthun sollte, das alles erfüllte sie mit angenehmen Erwartungen, und lächelnd blickte sie auf den schlichten goldnen Ring an ihrem Finger und drehte ihn gedankenvoll hin und her. Und dann stieg das innigste Mitleid mit der untröstlichen Cousine ihres Gatten, der vom Gram gebrochenen Sophie, in ihr empor, und sie lächelte, als ihr einfiel, dass die Witwe offenbar auf sie, wenn auch nur im Bilde, eifersüchtig sei. Die ihr ganz neue Behauptung, dass alle blonden Frauen falsch seien, erschien ihr verwunderlich, und sie fasste den Vorsatz, durch eine kleine, sich in der allermildesten Form haltende Koketterie mit dem jungen Mann, der über das Gewicht der mediceischen Venus so genau Bescheid wusste, Rache zu nehmen. Als ihr Blick jedoch auf ihren schlummernden Gatten fiel, verwarf sie diesen Gedanken wieder als schlecht und unedel, und darüber schlossen sich die elfenbeinweissen Lider, und die strahlenden Augensterne verbargen sich hinter den langen Wimpern. Vor dem Geiste des schlummernden Mädchens stiegen Märchenbilder empor. Die schreckliche Geschichte vom Rotkäppchen und dem Wolf konnte es wohl nicht sein, vielleicht war es das Märchen vom Prinzen Wunderhold; wer kann es sagen? Glückliche Bilder waren es gewiss, denn das Mädchen lächelte im Traum, und als der Doktor zusammenfahrend erwachte und sich die Augen rieb, blickte er mit überraschter Bewunderung auf das vom Zufall geschaffne Bild Dornröschens, welches er vor sich sah.
„Ah!“ dachte er, „bewundern kann ich sie, aber sie ganz zu würdigen, so wie sie es verdient, das vermag ich nicht. Wenn mein junger Freund jetzt hier wäre, wo könnte er wohl einen entzückendern Vorwurf für ein Bild finden?“ — —
In solcher Weise ging die Zeit müssig dahin. Ein Tag war ziemlich wie der andre in der Villa „die beiden Grenadiere“.
„Es war eine angenehme Zeit,“ dachte der Doktor, als er mit Packen fertig war und das Schloss seiner Reisetasche zuschnappen liess. „Ich habe, dünkt mich, während des letzten Monats in einem Narrenparadies gelebt. Ob wohl Helene, das arme Kind, den Vertrag schon bereut?“
Als aber die junge Frau jetzt ins Zimmer trat, war kein Zug des Schmerzes oder der Trauer um ein verlornes Lebensglück an ihr zu entdecken. In ihrem hübschen gemusterten Musselinkleid und dem grossen Strohhut mit der einen mächtigen weissen Straussenfeder sah sie frisch wie eine Rose aus.
„Bitte, knöpfe mir den Handschuh zu, Felix,“ sagte sie kokett, „und bemitleide mich, lieber Mann, bemitleide mich von Grund deines Herzens,“ fügte sie mit einem lustigen Lachen hinzu, „und hilf mir Madame Pichon die Mitteilung mit Vorsicht beibringen, wenn wir zu Hause sind, denn ich trage Nummer sieben, und sie sind schauderhaft eng.“