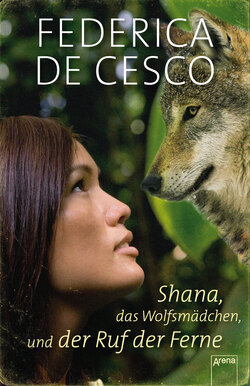Читать книгу Shana, das Wolfsmädchen, und der Ruf der Ferne - Federica de Cesco - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel
Würdest du ihm die Bilder mal zeigen?«, fragte ich Mike, als wir uns am Nachmittag wiedersahen.
Mike lachte etwas verlegen.
»Ach, die sind doch schlecht, die kann man doch nicht zeigen!«
»Vielleicht interessieren sie ihn trotzdem«, sagte ich.
»Warum will er sie denn sehen?«
Ich überlegte.
»Ich glaube… es gehört für ihn dazu. Um uns besser zu verstehen, meine ich.«
Mike ging mit manchen Dingen recht locker um. Er kam aus einer ganz anderen Familie als ich. Meine Mutter war gestorben und Elliot, mein Vater, saß lange in einer Heilanstalt für Trinker.
Mikes Mutter dagegen war Psychologin, der Vater Französischlehrer. Er hatte zwei Schwestern, von denen die jüngste, Carolyn, so gut in Judo war, dass sie zu der kanadischen Olympiamannschaft gehörte, die in London teilgenommen hatte. Carolyn hatte zwar keine Medaille gewonnen, dafür aber einen Riesenspaß gehabt und sich in einen Londoner Judoka verliebt. Jetzt lebte sie mit ihm in der britischen Hauptstadt und ich beneidete sie manchmal um diesen Schritt.
Nach kurzem Zögern war Mike also bereit, Robert Castaldi die Karikaturen zu zeigen. Der Professor schmunzelte, als er sich selbst als zeterndes Cello porträtiert sah. Während er allerdings die Bilder betrachtete, die Mike von mir gemacht hatte, nahm sein Gesicht einen sinnenden Ausdruck an. Da war zum einen die Zeichnung mit dem seltsamen, überdimensionalen Wolfskopf. Und auch ein Bild, auf dem ich als Baum dargestellt war, mit Wurzeln als Füße und Arme, die aus dem Laub wuchsen und Geige und Bogen schwangen. Mike arbeitete sehr akkurat, mit Tusche. Castaldi besah sich die Bilder lange und eindringlich. Schließlich legte er beide Skizzen vor sich auf den Tisch und verzog nachdenklich die Augenbrauen.
»Interessant«, meinte er. »Und wie würdest du dich selbst darstellen?«
Mike grinste etwas verlegen und legte Castaldi eine Skizze vor. Darauf saß er im Gras, die Geige unter dem Kinn, während ein Skunk – ein schwarz-weiß gestreiftes Stinktier – mit erhobenem Schwanz auf dem Bogen balancierte.
»Sehr humorvoll«, kommentierte Castaldi.
Er gab Mike die Bilder zurück. Wir spürten, dass er uns noch etwas zu sagen hatte.
»Was mir dein Selbstporträt zeigt, Mike? Du hast Talent und weißt es auch. Du magst deine Geige, aber du identifizierst dich nicht mit ihr. Du hast noch an dir zu arbeiten, junger Mann. Deine Disziplin lässt zu wünschen übrig.«
Mike rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Castaldi hatte seinen wunden Punkt genau getroffen.
»Zeichnungen sind oft sehr aufschlussreich«, fuhr der Professor fort, wobei er nach wie vor seine Worte an Mike richtete. »Du hast Shana als Wölfin und als Baum gezeichnet. Als Naturgeschöpfe also. Shana und ihre Geige sind eins.«
Mike schien plötzlich ein Licht aufzugehen. Er nickte und lächelte scheu vor sich hin. Dann wandte er mir das Gesicht zu, bezog mich in sein Lächeln ein.
»Ja, das stimmt. Shana macht Musik, wie sie atmet.«
Auf seine einfühlsame Art hatte uns Castaldi etwas sehr Wichtiges vermittelt. Während mir die Zeit, die ich dem Üben, meiner Fertigkeit auf dem Instrument widmete, nie mühsam oder zu lang vorkam, rebellierte Mike gegen die Strenge und Disziplin, die der Weg zur Perfektion von uns verlangte. Eine Perfektion allerdings, die immer unerreichbar bleiben würde. Das wusste jeder, auch wenn die Hauptfächer an der Musikfachschule vielseitig und anspruchsvoll waren und man uns forderte und förderte, wo es nur ging. Ich hatte einen großen Wissensdurst. In meinem Geburtsort Beaver Creek gab es nur eine Grundschule. Bevor Lela unsere Klasse übernommen hatte, war Anna Shriver da gewesen, eine hochnäsige Ziege, die Indianerkinder zu unterrichten für unter ihrer Würde hielt und uns wie Unterbelichtete behandelte. Aber Lela hatte unsere stinklangweilige Schule zu einem Ort der Kraft und der Magie gemacht und zwanzig störrische Teenager in Menschen verwandelt, die offen und neugierig für die Welt waren. Und der gutmütige Stanley Egger, der nach ihr kam, hatte dieses Erbe übernommen und weitergeführt.
Lela. Eine ganze Zeit hatte ich jeden Gedanken an sie weit weggeschoben, es war einfach zu schmerzhaft gewesen. Denn mit der Erinnerung an Lela war die Erinnerung an die graue Wölfin verbunden, die mich geführt und beschützt hatte. Wir glauben, dass die Ahnen immer bei uns sind und über uns wachen. Mit Lela war ich zwar nicht verwandt gewesen. Aber zwischen ihr und mir bestand trotzdem eine ganz besondere Beziehung. Wahrscheinlich hatte sie in mir ihre spirituelle Tochter gesehen, die einzige, der sie ihre wertvolle Geige anvertrauten konnte. Die Geige kam von ihrer Großmutter, die zum Volk der Sioux gehört hatte und eine berühmte Malerin gewesen war. Ihr Name »SunkeNagi« war ihr vor nahezu achtzig Jahren von den Stammesältesten verliehen worden. Eigentlich war dieser Name, der »Wolfsgeist« bedeutet, verdienstvollen Kriegern vorbehalten. SunkeNagi, eine der namhaftesten amerikanischen Künstlerinnen der Gegenwart, machte ihrem Namen alle Ehre. Die Geige stammte aus ihrem Nachlass. SunkeNagi hatte sie aus Italien mitgebracht, aus einer Stadt, die Cremona hieß und in der die berühmtesten Geigenbauer der Welt lebten. Auf dem Wirbelkasten war anstatt der üblichen Schneckenverzierung eine kleine Holzschnitzerei angebracht: der Kopf eines Wolfes. Es kommt manchmal vor, dass kostbare Geigen einen Namen haben. Und diese Geige trug den Namen »Die Wölfin«. Ich wusste, von diesem Instrument gab es kein zweites auf der Welt. Der Geigenbauer, Luigi de San Pietro, hatte die Geige jener Wölfin gewidmet, die Romulus und Remus, die sagenhaften Gründer Roms, aus dem Wasser des Tiber rettete, säugte und aufzog. SunkeNagi hatte ihre Gemälde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa ausgestellt. Sie lebte damals mit einem italienischen Musiker zusammen. Als dieser an Tuberkulose starb, vermachte er ihr seine Geige. SunkeNagi konnte recht gut Geige spielen, ihr Sohn Josua aber kaum und seine Frau Astrid, eine spröde New Yorkerin, hatte überhaupt keinen Sinn für Musik gehabt. Es war ihre Tochter Lela, die aus dem weiten Feld der Vorfahren ein Talent erbte, dessen Ursprung keiner verstand, aber alle zutiefst respektierten. Aber jetzt war Lela tot und die Geige gehörte mir. Ich musste dieses Instruments würdig sein. Das war ich den Ahnen schuldig. Denn durch Lelas Vermächtnis war auch ich mit ihren Ahnen verbunden. Ich war – sozusagen – ihr Adoptivkind. Das behauptete jedenfalls Mike, der in diesen Dingen sehr sensibel war.
»Du hast Lelas Geige. In ihrer Geige steckt eine Energie, die unverbraucht ist und nie verloren gehen kann. Wenn du ihre Geige spielst, weckst du diese Energie. Sie überträgt sich auf dich, verstehst du?«
Ich staunte, wenn ich Mike so reden hörte. Oft wirkte er so jungenhaft, so unbeschwert, als ob er sich über alles amüsierte. Aber dahinter war mehr, wie es sich in diesem Moment wieder gezeigt hatte.
»Du musst nicht denken«, sagte ich zu ihm – nachdem er Castaldi die Karikaturen gezeigt hatte –, »dass ich von diesen Dingen keine Ahnung habe.«
Wir wanderten am Strand entlang. Das Universitätsareal und die Musikhochschule befanden sich in einem Park. Es gab Tennisplätze und einen geheizten Swimmingpool. Aber auch der Strand war ganz nah. Man erreichte ihn durch ein Waldstück, das mit seinen hohen Bäumen an die freie Natur erinnerte, aber letztendlich nur ein schwacher, gebändigter Abglanz von ihr war.
»Das habe ich nie gedacht.« Mike lachte hell auf. »Du stehst da wie eine Mondsüchtige, aber dir entgeht nichts.«
»Deswegen mag ich keine Partys«, erklärte ich weiter. »Wird die Musik zu laut, kann ich mich nicht konzentrieren.«
»Ich weiß aber«, erwiderte Mike »dass du früher gerne bei Powwow-Festen mitgemacht hast. Deine Mutter doch auch, oder?«
Ich spürte einen Kloß im Hals.
»Ja. Sie war eine großartige Tänzerin. Bei den Wettbewerben gewann sie immer den ersten Preis. Ich war einfach nie so gut wie sie. Hätte Elliot ihr Kleid nicht verkauft, wäre die Sache vielleicht anders gelaufen. Aber so…«
»Ich verstehe«, sagte Mike.
Wir tauschten einen Blick. Ich nickte, während ein schwarzes Eichhörnchen flink und geschmeidig einen Baumstamm emporkletterte. Im Park gab es viele Eichhörnchen und alle waren sehr zutraulich, weil die Studenten sie mit Nüssen fütterten.
Ich betrachtete das Tier, sah es aber nicht wirklich. Meine Gedanken verweilten traurig in der Vergangenheit. Es war damals ganz schrecklich für mich gewesen, als mein Vater Melanies traditionelles, wunderbar besticktes Tanzkleid verkauft hatte, um sich Alkohol zu besorgen. Inzwischen hatte ich ihm alles verziehen, aber der Schmerz saß noch tief in mir und es genügte, daran zu denken, um ihn wieder ganz nahe, am Rande des Herzens, zu spüren. Ein solcher Schmerz vergeht nie und ich hatte mittlerweile akzeptiert, dass er zu mir gehörte und Teil meiner Lebenserfahrung war, die mir keiner nehmen konnte. Ich aber konnte diesen Schmerz in etwas Gutes verwandeln: in Musik.
Mike kannte diese Art von Problemen nicht. Er kam aus einer intakten Familie. Keine Wohlfahrt-Junkies, aber intellektuelles Milieu.
Das alles war bei uns nicht selbstverständlich. Die sozialen Probleme waren groß und das lag vor allem daran, dass einst unser Lebensmut gebrochen worden war. Wir – die First Nations – waren vielen Leuten im Weg gewesen. Leute, die unser Land, unsere Bodenschätze wollten. Sie hatten uns alles genommen und obendrein noch versucht, uns auszurotten. Aber das war ihnen nicht ganz gelungen. Wir holten wieder auf. Von einer Generation zur anderen wurde es besser. Bald würden wir wieder die gleiche Stärke besitzen wie früher.
Jetzt ergriff Mike wieder das Wort: »Fast niemand weiß, dass mein Vater aus dem berühmten Geschlecht der Shenandoah kommt. Zehn Generationen von Chiefs, stell dir das mal vor! Und meine Großmutter war eine sehr mächtige Frau, eine Heilerin, die von allen verehrt wurde.«
»Hast du sie noch gekannt?«
»Kaum. Ich war vier, als sie starb. Aber ich habe Bilder von ihr gesehen. Sie hatte ein Gesicht, das kannst du dir nicht vorstellen!«
»Wie sah es denn aus?«
Er zögerte.
»Die Weißen verehren ihren Gott und sagen, er hätte sie nach seinem Abbild geformt. Es hört sich vielleicht bescheuert an, aber wenn ich das Bild meiner Großmutter vor Augen habe, denke ich immer noch, Gott muss so aussehen wie sie.«
Bescheuert? Ich schüttelte den Kopf. Es gab einfach Dinge auf der Welt, die sich nicht erklären ließen. Trotzdem hatten wir vielleicht ein feineres Gespür dafür als die Weißen. Zumindest bildete ich mir das ein.
»Ich erinnere mich«, fuhr Mike fort, »wie geschockt ich war, als Castaldi mir ganz am Anfang mal erzählte, dass er manche Schüler über Jahre unterrichtet, ohne dass etwas passierte. Das brauche viel Geduld, hat er gesagt. Es sei, als pflege er eine Topfpflanze, ohne dass sie wächst. Ich dachte: Scheiße, jetzt setzt er mich vor die Tür. Aber dann hat er mich angeschaut, weißt du, mit diesen Augen, so blau und klar wie Wasser, und hat wie beiläufig hinzugefügt:
›Und dann, ganz unerwartet, beginnt die Pflanze zu blühen.‹«
Mike lachte sein schönes, offenes Lachen.
»Und da habe ich begriffen, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte!«