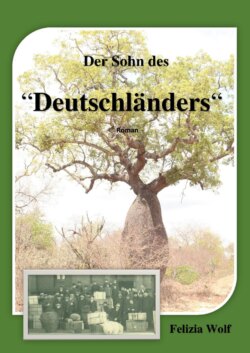Читать книгу Der Sohn des Deutschländers - Felizia Wolf - Страница 6
Kapitel III.
ОглавлениеKapitel 3
Im vorigen Kapitel habe ich über Justina und ihre Tochter Hildegard geschrieben. Arthurs Vater hatte bei seiner Ankunft überrascht und hoch erfreut festgestellt, dass die beiden Deutsch sprachen.
„Ich will die Herkunft der beiden näher beschreiben“, sage ich zu Arthur, nachdem er den bisherigen Text gelesen hat.
„Wozu?“, fragt er und sieht mich überrascht an. „Ich kenne ihre Lebensgeschichte und sie hat nichts mit mir zu tun.“
„Falsch. Ich rede auch noch gar nicht von Justinas Geschichte im Speziellen, sondern von ihrem religiösen Hintergrund.“
„Auch die Geschichte der Mennoniten ist mir auch zur Genüge bekannt und auch sie hat nichts mit mir...“
„Nichts mit dir zu tun? Dass ich nicht lache! Immerhin bist du zu den Mennoniten ‘übergelaufen’ und einer von ihnen geworden.“
„Ich bin nicht ‘übergelaufen’! Die mennonitische Gesellschaft war die einzige, die ich hatte, nachdem wir von Asunción nach Filadelfia im Chaco umgesiedelt waren!“
„Richtig. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass du dir die Herkunft und Entstehung dieser Gesellschaft noch einmal vor Augen führst und mir diese Geschichte genau erzählst.“
„Jetzt mach mich nicht schwach! Du hast genau wie ich in der Schule das Fach ‘Mennonitengeschichte’ durchkauen dürfen bis zum Geht-nicht-mehr! Auβerdem haben wir uns seit Jahren nächtelang über den Sinn und Unsinn von Abspaltungen in der Christlichen Kirche unterhalten.“
„Arthur, mein Freund, wir haben uns über alles unterhalten. Über dein ganzes Leben! Und trotzdem willst du jetzt, dass ich es aufschreibe. Es geht ja nicht um mich und was ich über dich und dein Leben weiβ, sondern darum, dass du alles, dein ganzes Leben schwarz auf weiβ lesen willst. Wenn ich über deine Begegnung mit Justina und Hildegard schreibe und ihr leicht verschrobenes Verhältnis zum Glauben, dann kommen wir doch an einer näheren Betrachtung der Mennoniten gar nicht vorbei. Schlieβlich sind Justina und Hildegard zentrale Figuren in deinem Leben geworden. Also – wie und wann sind die Mennoniten entstanden?“
„Im 16. Jahrhundert, wie du weiβt“, antwortet Arthur muffelig.
„Woher kommt der Name ‘Mennoniten’?“
Jetzt muss Arthur doch grinsen. „Ja, eigentlich hätten sie genauso gut ‘Simoniten’ heiβen können. Einer der ersten Anführer dieser Gruppe hieβ Menno Simons. Wenn sich die ersten Lutheraner auch nach dessen Vornamen benannt hätten, dann hieβen sie heute Martiniten und nicht Lutheraner.“
Ich gehe über diesen schlechten Witz hinweg und fordere Arthur auf, mir Näheres über Menno Simons zu erzählen.
Aber Arthur schnaubt nur ärgerlich. „Wenn du meinst, dass das hier wichtig ist, dann erzähle doch, was wir beide in der Schule über die Geschichten der Mennoniten gelernt haben. Ich habe nichts dagegen. Aber ich habe absolut keine Lust, diese ganze Geschichte noch einmal durchzukauen. Schlimm genug, wenn ich das Ganze nachher lesen muss.“
Ich lasse mich nicht beirren in meiner Meinung, dass die Entstehungsgeschichte der Mennoniten und ihre „Völkerwanderung“ Teil seiner eigenen Geschichte sind. Immerhin war Justina im Jahr 1933 zusammen mit einer gröβeren Gruppe dieser Religionsgemeinschaft nach Paraguay eingewandert. Und Arthur muss zugeben, dass sie ein Teil seines Lebens geworden war, genauso wie Luisa und Maria Celeste. Auf die beiden kommen wir sicherlich auch noch näher zu sprechen.
Menno Simons war im Jahr 1524 in Friesland, einer Provinz der Niederlande, katholischer Priester geworden, ohne je die Bibel in der Hand gehabt zu haben. Nur ganz wenige Kirchenmänner hatten damals das Vorrecht, eine Bibel zu besitzen. Das muss man sich einmal vorstellen: da predigt einer jahrelang, und weiβ gar nicht genau, welche Botschaft er eigentlich vertritt. Es gab damals in sämtlichen kleineren Kirchgemeinden nur so etwas wie mündliche Unterweisung. Simons muss zu Gute gehalten werden, dass er sich trotzdem eine Bibel beschafft und sie genau durchstudiert hat. Keine Selbstverständlichkeit zu jener Zeit.
Er stellte fest, dass es nirgendwo in der Bibel heiβt, Säuglinge müssten getauft werden. Diese Feststellung hatten vor ihm auch andere namhafte Priester gemacht und versucht, diese Tradition als unbiblisch abzuschaffen. Aber die Säuglingstaufe war ein fester katholischer Brauch. Fast alle Aufwiegler waren deshalb durch die katholische Kirche, die ja das Glaubensmonopol innehatte, grausam hingerichtet worden. Trotzdem entstanden irgendwann so genannte Wiedertäufer-Bewegungen. Das heiβt, erwachsene Gläubige lieβen sich erneut taufen, weil laut Bibel eine überzeugte Glaubenshaltung der Taufe vorausgehen sollte.
Durch diese Erwachsenentaufe grenzte sich eine Gruppe von den anderen Protestanten ab. Einer dieser anderen Protestanten war Martin Luther gewesen, der ja schon sieben Jahre bevor Menno Simons zum Priester geweiht wurde, eigene Verbesserungsvorschläge öffentlich gemacht hatte.
Neben der Taufe im Erwachsenenalter machte sich Simons unter anderem dafür stark, dass Gewalt und Kriegsdienst sich für einen Gläubigen nicht gehören. Gewalt hatte lediglich in der Kindererziehung ihren Platz, nicht aber im öffentlichen Leben. Ebenso wenig wie das Schwören. Alles, was einer Vereidigung bedurfte, wurde abgelehnt. „Eure Rede sei ‘ja’ und ‘nein’, was darüber ist, ist von Übel“, heiβt es schließlich in der Bibel.
Simons fing damals an, kleine Traktate zu schreiben und wurde dadurch in seinen Kreisen immer bekannter und gefragter. Historischen Berichten zufolge wurde er von einer Gruppe tiefgläubiger Menschen gebeten, ihr „Ältester“ zu werden. Er reiste daraufhin eine Zeit lang predigend durch die Gegend, was zu jener Zeit, um 1545, keine leichte Aufgabe gewesen sein dürfte. Es gab viele Feinde seitens der staatlichen Kirche. In Aufzeichnungen heiβt es, Simons sei „einer der wichtigsten Führer der verfluchten Sekte der Wiedertäufer“ gewesen. Seine Ansichten und Hartnäckigkeit passten offensichtlich vielen Politikern und auch Kirchenmännern nicht, zumal er, wie andere Reformer und Wiedertäufer auch, vehement dafür sprach, dass Staat und Kirche voneinander getrennt werden sollten. Das bedeutete für ihn, dass er damals gefährlich lebte. Sie haben ihn aber, soweit ich weiβ, nie gekriegt, denn er soll eines natürlichen Todes gestorben sein. Aber bevor er starb, war es ihm gelungen, eine relativ groβe, in sich geschlossene Gruppe von gläubigen Christen zusammenzubringen, die sich streng an seine Grundsätze halten würde.
Diese Gruppe von Christen, die von anderen Protestanten und Katholiken spöttisch „Mennisten“ genannt wurde, wuchs immer weiter. Man war darauf bedacht, Gemeinschaft untereinander und Traditionen zu pflegen. Allerdings waren die Gebiete, in denen das möglich war, stark begrenzt, obwohl gewisse Staatsoberhäupter bemerkten, dass dort, wo Mennoniten ansiedelten, Fortschritt und wachsender Reichtum die Folge waren. So war es ihnen beispielsweise gelungen, die Sumpflandschaften der Weichselniederung trockenzulegen und in Weideland zu verwandeln. „Betet und arbeitet“ war einer ihrer wichtigsten Grundsätze geworden.
Die Landstriche aber, die sie über mehrere Generationen lang bewirtschaften und dabei die eigene Lebensweise pflegen durften, wurden zu eng. Man brauchte weitere Ausdehnungsmöglichkeiten. Und man hat sie bekommen: In Russland, am Schwarzen Meer, gab es genug Ländereien, wo freiwillig und ohne schwerwiegenden Grund niemand hin wollte. Katharina die Groβe hatte von den ganz und gar nicht arbeitsscheuen Mennoniten gehört...
Etwa 900 Mennoniten waren im Jahr 1788 nach Russland ausgewandert. Neuer Reichtum an den Ufern des Dnjepr und der Wolga! Diesem neuen Reichtum waren, wie ich gerechterweise erwähnen muss, harte Arbeit und viele Entbehrungen vorausgegangen. Es war ihnen sicherlich nichts geschenkt worden. Wenn ihnen der Kommunismus erspart geblieben wäre, hätten sie in Russland heute sicherlich groβe Landesteile besiedelt. Aber der Kommunismus sollte kommen und viele der deutschstämmigen Siedler, die in ihren Kirchen kein Deutsch mehr singen und predigen durften, sind nach Kanada, in die USA und von dort aus auch nach Mexiko gezogen. Und eine Gruppe beschloss eben, nach Paraguay auszuwandern, weil es hieβ, dass man dort in Ruhe beten und arbeiten, aber auch deutsche Predigten hören dürfte.
Justina war in Russland geboren worden und hatte als kleines Mädchen an dem Teil der Wanderung teilgenommen, der eine relativ kleine Gruppe des „mennonitischen Volkes“ von Russland über Deutschland nach Paraguay gebracht hat.
„Mennonitisches Volk!“, hat Arthur gerufen, nachdem er meinen extrem zusammengefassten Bericht über den Ursprung der Mennoniten gelesen hatte.
„Sie sind doch kein Volk, sondern eine Religionsgemeinschaft! Zuerst so etwas wie eine Abspaltung der Protestanten, dann eine ganz eigenständige Bewegung. Jeder kann sich heutzutage auf den mennonitischen Glauben taufen lassen und einer von ihnen werden!“
„Das ist schon richtig, aber du wirst mir wohl kaum widersprechen, wenn ich sage, dass sie sehr genau wissen, wer seine Wurzeln in der ursprünglichen Gemeinde hat und wer nicht. Selbst ihre alte, plattdeutsche Mundart grenzt den Kern ihrer Gruppe ganz stark gegen alle dazugekommenen Mitglieder ab. Bis heute.“
„Na gut, das mag stimmen.“
Justina konnte sich nur noch dunkel daran erinnern, jemals in einem anderen Land als Paraguay gelebt zu haben. Schlieβlich war sie bei der Auswanderung aus Russland erst ganze sechs Jahre alt gewesen. In ihren Erinnerungen schwebten noch langsam verblassende Bilder vom ukrainischen Dorf, in dem sie als Kleinkind gelebt hatte. Ganz deutlich erinnerte sie sich allerdings an die Ungewissheit und die niedergedrückte Stimmung, die auf der Flucht spürbar gewesen waren. Niemand hatte ihr damals erklärt, warum sie alles stehen und liegen lassen mussten und wohin die lange Reise gehen sollte.
Das Leben hatte im Chaco neu angefangen... und war dort für sie auch in gewisser Weise zu Ende gegangen. Zwischen ihrem jetzigen Dasein in der Stadt und dem behüteten Leben, das sie in der mennonitischen Siedlung im Chaco geführt hatte, herrschte ein krasser Gegensatz. Sie hatte sich „der Unzucht schuldig gemacht“. Schande und Verbannung in die Stadt. Ausbürgerung. Kein Weg zurück. Deshalb war sie jetzt fest entschlossen, überhaupt nicht an dem städtischen Leben teilzunehmen.
„Nicht an dem Leben in der Stadt teilzunehmen! Was soll denn das schon wieder heiβen?“ Arthur kann es nicht lassen, an meinen Formulierungen herumzumeckern.
„Dann schreib doch selber, wenn es dir nicht passt!“
„Es geht nicht darum, ob es mir passt oder nicht, ich finde deine Ausdrucksweise nur manchmal ein bisschen seltsam, so melodramatisch, fast theatralisch!“
„Was ist daran theatralisch, wenn ich behaupte, Justina hätte am Leben nicht teilgenommen! Sie ging in Asunción nie aus, hatte keine Freunde, die sie besuchten, sie hörte noch nicht einmal Radio!“
„Ja, ja, das stimmt ja alles.“ Arthur denkt eine Weile nach. Dann sagt er: „Vielleicht war es mir nur bisher nicht wirklich bewusst, dass es ihr eigener Entschluss war, sich vollkommen auszugrenzen.“
„Ich fand es, nach allem was du mir über eure Zeit im Hinterhaus erzählt hast, immer ganz offensichtlich, dass sie sich selbst bestrafen wollte, indem sie das Leben einer Büβerin lebte. Sie muss ja sehr wohl mitgekriegt haben, dass andere Stadtbewohner, obwohl sie oft arm waren, so etwas wie Lebensfreude zeigten. Es gab in der Nachbarschaft Feste und Feierlichkeiten, es gab selbst in der nächsten Nachbarschaft Kneipen oder Restaurants in denen getrunken, gelacht und getanzt wurde. Wahrscheinlich hat sie diese öffentlich zur Schau gestellte Lebensfreude als das erkannt, was man bei ihr zu Hause als ‘verderbliches Verhalten’ bezeichnet hatte. Und davor war sie schlieβlich, neben der ‘Unzucht’, immer gewarnt worden, seit sie denken konnte.“
„Hm. Ja. Sie hat ihre eigenen kategorischen Grenzen gezogen, weil sie die Groβstadt als mögliche Rutschbahn in den Sündenpfuhl gesehen hat.“
„Musste sie ja! Schlieβlich war vorher, in ihrem Dorf im Chaco alles gut, richtig und gottgefällig gewesen. Hier war alles ganz anders, also schlecht. Aber ganz offensichtlich hatte sie die Hoffnung nicht aufgegeben, am Ende doch noch von höherer Instanz als guter Mensch bewertet zu werden. Sie hat ja ihre abendliche Andacht nie versäumt, wie wir von deinem Vater wissen. Auch die permanent gut gelaunte Luisa hatte es längst aufgegeben, sie zu einem Abendspaziergang oder zu einem Plauderstündchen am Lagerfeuer einzuladen. Justina soll bei solchen Angeboten immer nur mit ernster Miene den Kopf geschüttelt und gesagt haben: ‘Ich muss in meiner Bibel lesen, ich will nie wieder meinen Weg verfehlen’.“
Arthur denkt lange nach ohne ein Wort zu sagen.
Schlieβlich sage ich: „Übrigens, bei aller Kritik an meiner Schreiberei: Ob es dir passt oder nicht, ich schreibe auch solche Gespräche auf, wie das, das wir gerade geführt haben.“
„Wenn du meinst“, sagt er nur, zuckt die Achseln und geht aus dem Zimmer.