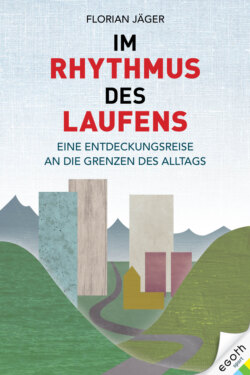Читать книгу Im Rhythmus des Laufens - Florian Jäger - Страница 10
ОглавлениеIn der achten Runde senken sich meine Augen dem Boden zu, wie um der trügerischen Hoffnung zu entgehen, die ein aufrecht gerichteter Blick birgt. Der Körper trägt den Kopf dabei, so gut er kann. Gedanklich gehe ich schon die nächste Runde durch, immer das Gleiche: der enge Durchgang zwischen Säulen und Treppe des Sportheims, der begraste Weg am Metallzaun, über mir aufragend die Flutlichter.
In der Peripherie meines linken Auges nehme ich die schwarz-grünen Salming-Schuhe meines Trainers wahr, Egidijus; darüber blonde Härchen, eine rote Adidas-Hose. Die Oberkante meines Blickfelds endet an Egidijus’ Hand, in der in natürlicher Verlängerung die Stoppuhr erscheint, ein längliches Sechseck mit unzähligen Knöpfen und Funktionen, mit denen Egidijus die Zeiten unserer ganzen Trainingsgruppe gleichzeitig und für jede Runde einzeln aufnimmt.
„Jawoll, sieht gut aus.“
Ich nicke so kraftsparend wie möglich, laufe weiter. Den Blick habe ich starr auf einen imaginären Punkt etwa 20 Meter vor mir gelegt; ich folge ihm wie der konditionierte Hund dem fahrenden Lichtpunkt in einem nächtlichen Hunderennen.
42 Runden liegen noch vor mir, insgesamt 50-mal soll ich das Oval des Mommsenstadions in Berlin-Grunewald umrunden – nicht unten auf der 400-Meter-Tartanbahn, wie man es eigentlich tut, nein, auf dem schmalen Stück außen um die Tribünen, als wäre dies eine anerkannte Strecke für besondere Läufe. Egidijus sagt, außen herum sei besser. Auf dem Oval der Tartanbahn würde man ja auf Dauer verrückt werden. Ich laufe die 500 Meter der Außenbahn, 50 Mal. Ob ich verrückt dabei werde, kann ich nicht beurteilen.
Bis Runde 25 zähle ich aufwärts. Danach arbeite ich die Runden im Countdown ab. Ich schaue hinunter ins Stadion. Filip, Matt und Nikolai bewegen sich nicht. Was machen die denn, haben die schon Feierabend? Ich laufe weiter. Nachdem wir letzte Woche in der späten Dämmerung beinahe im Dunkeln liefen, zeigt sich der Platzwart heute kooperativ: Die großen Stadionlichter gehen an, erst als schwacher Schein, dann als immer helleres Leuchten.
Alle paar Runden wartet mein Trainer Egidijus auf den obersten Stufen der Tribüne, unbarmherzig, wirft mir irgendeine Zahl zu, die ich auf den nächsten 300 Metern einzuordnen versuche. Wenigstens habe ich dadurch etwas zu tun.
Ich versuche, gleichmäßig weiterzulaufen, versuche, das Vergehen der Zeit zu beschleunigen: Jede Runde schaue ich an der Einbiegung zur Haupttribüne einmal auf die große Stadionuhr. Der Zeiger dreht sich ähnlich langsam wie die Rundenzahl sich reduziert.
Von oben sehe ich, wie die anderen sich umziehen, Matt und Nikolai verabschieden sich. Filip bleibt noch ein paar Runden.
Er ruft mir etwas zu: „Come on, Flo, don’t give up.“
Ich ärgere mich, weil ich das nicht vorhatte.
Glücklicher Nebeneffekt: Das Ärgern gibt mir Energie. Je näher ich der letzten Runde komme, desto deutlicher spürbar wird der benötigte Energieaufwand. Er bewegt sich nicht linear, viel eher ist es so, als würde er sich von Runde zu Runde potenzieren. Der Körper baut ab, er schreit nach Nährstoffen, nach Sauerstoff, nach Erholung. Jetzt trägt der Kopf den Körper, bis ins Ziel. Ich stoppe, erleichtert.
Egidijus, der verzögert aufschaut und fragt: „Waren das schon 50?“
-----
Ich erlebe kaum mehr Unmittelbarkeit als in den letzten Momenten eines anstrengenden Trainings oder eines Wettkampfs: Ich muss bloß laufen, sonst nichts, jede Aktion ruft eine Reaktion hervor. Das Weiterrollen meiner Beine bestimmt über die Zeit: Sie wird angehalten, konserviert, sobald ich die Ziellinie erreiche. Zeit wird zu etwas sehr Konkretem, wenn sie auf einer Stoppuhr festgehalten wird; im Training und Wettkampf bekommt sie eine fassbare Bedeutung.
Die auf der Uhr festgehaltene Zeit ist – im besten Fall – ein Gradmesser des Erfolgs. Weitere sind, überhaupt Zeit zum Laufen gefunden zu haben und dadurch die Zeit zum Laufen gebracht zu haben.
An manchen Tagen schleppe ich mich zum Training, angezählt vom Arbeitstag, bin schon vor dem Warmlaufen erschöpft. Dann ist der erste Erfolg, auf die Bahn zu treten, der zweite durchzuhalten und der dritte, mich einem übergeordneten Ziel anzunähern. Durch Wettkämpfe, Zeitträume, sozialen Ansporn bildet sich ein feingliedriges Zielkonstrukt, das bis in die kleinste Ebene eines Trainings reicht und Wirkung aus ihr zieht.
Die Unmittelbarkeit: Der Erfolg ist genauso greifbar wie die Qual auf dem Weg dorthin.
Und manchmal ist auch die Qual selbst schon Erfolg, an Tagen, die in spröder Belanglosigkeit dahingegangen sind, an denen sich die Existenz abgenutzt anfühlt. Dann ist der maßvolle Schmerz eine willkommene Empfindung – er fühlt sich bedeutungsvoll an.
Das Stadion ist ein Ort des Wissens. Ich lerne bei Egidijus mehr, als ich überhaupt an existentem Wissen erahne, die elementaren Unterschiede der Trainingssysteme in Ost- und Westeuropa, Gemeinsamkeiten von Marathonlaufen und Balletttanzen. Egidijus hat mir eine Reihe virtueller Trainer und Betreuer abgelöst, denen beinahe jeder recherchefreudige Laufanfänger einmal begegnet: dem berüchtigten „Countdownplan“ von Peter Greif, „[Der Plan] ist hart, fordert viel und ist extrem gefährlich – vor allem für Ihre Bestzeit“; der „Laufbibel“, dem „Standardwerk zum gesunden Laufen“; und Herbert Steffnys „Großem Laufbuch“, samt den Fotos von Steffnys unvergleichlichen Wuschellocken. Mit Egidijus habe ich endlich einen Trainer aus Fleisch und Blut gefunden. Nebeneffekt: jemanden, der bemerkt, wenn ich mal etwas abkürzen möchte, der darauf reagiert.
Eigentlich hatte ich nach Erreichen einer neuen Bestzeit beim Berlin-Marathon, 2:39:46, mit dem intensiven Laufen aufhören wollen.
Egidijus tippte sich bloß mit dem Zeigefinger an die Stirn: „Einmal Läufer, immer Läufer.“
-----
Mir bleiben 10,5 Wochen bis zum Marathon. Eng bemessen für einen, der gerade erst wieder ins Training einsteigt – und für einen, der sich einredet: Ich habe Großes vor. Immerhin nichts Neues: Für meinen ersten Marathon, im Herbst nach der Fuji-Belaufung, habe ich sechs Wochen trainiert, für die folgenden acht und zehn. Zwischendurch mehrmonatige Laufabstinenzen. Meine Laufroutine besteht aus dem totalitären Diktat eines „Ganz oder gar nicht“. Während ich beides will, ertrage ich weder das eine noch das andere als Dauerzustand.
Aus dem „Gar nicht“ heraus ist es dann jedes Mal irgendein nicht vorherzubestimmender Impuls, ein Zufall, eine Unzufriedenheit, eine attraktive Möglichkeit, und es heißt: Jetzt ist Marathonzeit.
Filip, der schlaksige Belgier und unverzichtbare Laufkamerad, fragt nach jedem Marathon: „Na, Flo, wie lang geht’s dieses Mal in den Winterschlaf?“
Wie er das sagt, in seinem flämischen Akzent, klingt das wie die süßeste Verlockung, die auf der Welt vorstellbar ist.
„There is a time for everything.“ Alles hat seine Zeit.
Natürlich gibt es da dieses immerwährende Ziel, das auch da ist, wenn ich nicht trainiere: irgendwann den Marathon unter 2:30 laufen. Die magische Marke.
Die Wiederholungen des Trainings sind selbstverordnete Zwangshandlung, das Laufen ein Wahn, von dem ich nicht lassen kann. Das Gefühl, einen Sinn zu haben, die konkrete Ahnung, wie ich diesem zutragen kann. Marathonmonate sind Sucht, sie bestimmen mein Leben vollumfänglich; sie sind Therapie: Sie geben mir einen klaren Fokus; nicht zuletzt Illusion: das Gefühl von Plan und Kontrolle.
Der Wahn wird sichtbar, wenn meine Ziele und der Weg dorthin sich sehr von denen anderer unterscheiden. Indem ich abweiche, meine Zeit und Mühen nicht in den nächsten Karriereschritt oder materielle Anschaffungen investiere.
-----
Als ich mich nach dem 50-Runden-Dauerlauf auf mein Fahrrad schwinge, krampfen meine Waden. Ich strecke die Beine durch. Geduldig warte ich auf den Moment, wenn sich die Verhärtungen lösen, und radle dann in fixem Tempo am Grunewald entlang durch den Tunnel der S-Bahn-Station; vorbei an den Botschaften von Kuwait, Katar und Benin, Villen von Familiendynastien, die ihr Geld in Industrie oder Anwaltschaft gemacht haben; kreuze die Straßen am Wilden Eber – der kleinen Bronzestatue, die Paul Gruson in den 1920er-Jahren schuf; heute markanter Punkt während des Berlin-Marathons: ein Gewusel an Menschen, herausgeputzt in Grunewald-Schick und mit Weinglas-Armen; Kinder, die mit Glücksgesichtern kleine Hände zum Abklatschen ausstrecken. Die letzte Steigung meines Nachhausewegs, vom Friedrich-Wilhelm-Platz zur Feuerbachstraße, ziehe ich noch einmal an, plötzlich energetisiert vom nahen Ziel. Als ich ins Treppenhaus trete, krampfen meine Waden erneut. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist die Zeit für Salz.
Weil ich zu faul bin, meinen Schlüssel herauszuholen, klopfe ich an die Tür.
Lydia, mit der ich seit einem Jahr in der kleinen Wohnung in Berlin-Friedenau wohne, öffnet verspielt die Tür nur einen Spalt.
„Na, hast du dich verlaufen?“ Sie zwinkert mir zu.
Ich weiß nicht, was ich antworten soll, und bin sehr froh, als sie die Tür komplett aufzieht.
Ich stürze geradeaus in die Küche und trinke drei volle Ladungen Wasser aus einem bunt beklebten Weizenglas, eine Erinnerung an den Mittelrhein-Marathon. Eine davon versetze ich mit einem Viertel Teelöffel Kochsalz.
Wir essen Lachsfilet mit Rosmarinkartoffeln und Salat, Romana, Tomaten, Karotten und Rote Beete für die Eisenzufuhr. Bei jedem Bissen Lachs fühle ich nicht nur die Zartheit des Fischfleisches, ich spüre regelrecht, wie die Regeneration in meinem Körper voranschreitet; wie die Eiweiße und Fettsäuren mich dabei unterstützen, schon am nächsten Tag wieder alles geben zu können. Für einen Moment schließe ich genüsslich die Augen.
Lachs-Luxus. Eine Ausnahme, die ich mir angesichts des hohen Fettanteils nur nach wirklich harten Einheiten erlaube. Ich tanze Tango mit meiner Psyche, in wechselnder Führungsrolle. Manchmal tragen die sehnsuchtsvollen Gedanken an das Essen durch ein gesamtes Training. Lachs, wahlweise auch Kaiserschmarrn. Nie schmeckt mir Essen besser als nach einem fordernden Training.
Als Nachtisch gibt es Magerquark mit Banane und Walnuss – nicht zu viel, auch wenn es die guten Fette sind. Ich überlege, noch ein Stück Schokolade zu essen, vertage das aber aufs Wochenende.
„Super“, sagt Lydia, „nun habe ich ein schlechtes Gewissen, mir ein Stück zu nehmen.“
Zum Glück tut sie es trotzdem.
Aus dem Ratgebersatz „Marathon muss nicht nur Verzicht sein“ höre ich als zentrale Botschaft: „Marathon ist Verzicht.“ In jeder Trainingsphase stürze ich mich in eine Gladiator-Attitüde und Verzichts-Heroismus. Morgens Haferflocken, Obst, streng rationierte Krümel Knuspermüsli; mittags ein Sonderdeal mit der Kantine: Kartoffeln, zweierlei Gemüse, keine Sauce, manchmal Couscous-Salat, mit ein, zwei Bröckchen Schafskäse; abends nicht selten Brot – aber nicht zu viel, kurz vorm Schlafengehen brauche ich die Energie der Kohlenhydrate kaum – oder Linsen-, Tofu-, Eiergerichte. Beinahe immer dabei: Magerquark und Rohkost.
Das Essen von rohen Karotten hat sich mittlerweile zur Antwort auf alle möglichen Herausforderungen des Lebens entwickelt. Es ist wahr, wenig spendet mir so viel Trost wie das Knacken des Möhrenbruchs.
Das Ziel dabei ist es, möglichst schnell zu einem fitten Körper zu kommen, fit gleich fettarm und funktionstüchtig – Phänotyp hager und sehnig. Dazu versuche ich, auf Genussmittel zu verzichten, konzentriere mich auf die entscheidenden Nährstoffe.
Ich lese von einer Studie, in der Ratten die Einnahme ihrer gewohnten Nahrungsmittel entzogen wurde, ihnen stattdessen die Nährstoffe in Rohform gespritzt wurden. Alle Versuchsratten starben.
Manchmal gehe ich abends noch mit einem kleinen Resthunger ins Bett, verlasse mich darauf, dass die Träume ihre Rolle als Hüter des Schlafs erfüllen und ich, um nicht aufzuwachen, in meinen Träumen die fehlende Nahrung aufnehme.
Was ich mittlerweile merke, selbst Essbedürfnisse und -gewohnheiten sind spiralenförmig angelegt, wirbeln in die eine oder andere Richtung. Mache ich keinen Sport, spüre ich automatisch ein erhöhtes Bedürfnis, mich ungesund zu ernähren. Ich habe dann nicht nur mehr Lust auf Süßes und Fettiges, ich finde auch, eine Tüte Chips, Bier und ein paar Kekse auf der Couch passen einfach gut zu dem Lebensstil, den ich da gerade führe. Beginne ich dann – aus welchem Anlass auch immer – damit, wieder Sport zu treiben, ändern sich meine physiologischen Bedürfnisse automatisch mit. Ich habe wieder mehr Lust auf Kartoffeln und Quark, Gemüse, Tofu, Linsen, Fisch, logisch, ich brauche schlicht mehr Nährstoffe, etwas Reales. Der Körper merkt das, er fordert das ein; innere Prozesse, die den Appetit steuern. Und plötzlich ist auch der Lifestyle einer gesunden Ernährung wieder verdammt attraktiv, Fett, Zucker, all das Klebrig-Gemütliche hingegen verpönt.
So einfach ist das.
-----
Wir räumen die Teller ab und lassen uns auf die Couch fallen: erstmal runterkommen. Ich hänge da, völlig erschöpft, aber auch irgendwie leutselig, stolz auf das Durchgestandene, entrückt optimistisch. Als ob ich gerade eine große Prüfung bestanden hätte und das Glück darüber mitsamt dem Im-Mittelpunkt-Stehen noch weiter auskosten wollte. Rein aus Vernunftgründen geht’s dennoch ins Bett. Einer der wichtigsten Faktoren für eine gute Regeneration: viel und gut schlafen.
Schnell findet Lydias Atem einen gleichmäßigen und ruhigen Rhythmus. Ich liege da, müde, doch an Schlaf ist nicht zu denken. Das Adrenalin wirkt nach, die körpereigenen Hormone, die mich warnen: Bleib wachsam, die Gefahr ist nicht gebannt, irgendetwas kommt da noch. Ja klar, aber doch sicher nicht mehr heute. Oder? Dazu die Britzelbeine, etwas Wunderbares, weil Lebendiges: Es arbeitet in meinen Waden, alienhaft bewegen sich Muskelstränge, drängen unter der Hautoberfläche hervor, kleine Delfine, die springend und spielend Touristen auf einem Ausflugsboot unterhalten. Ich schaue ihnen gerne zu, wie sie kommen, gehen, überraschend auf- und abtauchen, merke, wie sie ihre sanften Sprünge unter meiner Haut vollziehen. Die Muskeln versuchen, sich nachträglich an die eben geforderten Leistungen anzupassen. Unbedingt wollen sie es beim nächsten Mal richtig machen, besser.
Irgendwann schlafe ich ein. Im Schlafen werde ich dann selbst zum Delfin: Ein Auge und eine Gehirnhälfte bleiben wach, stets bereit. Das ist der Kompromiss.
Ich wache dreimal auf in der Nacht, um mich, durchgespült durch das späte und wiederholte Wasserhumpen-Stürzen, zu entleeren. Am nächsten Morgen bin ich gerädert. Nur mühsam komme ich in Tritt auf meinem Zehn-Kilometer-Regenerationslauf zur Staatsbibliothek Ost nahe der Friedrichstraße.
Ich zwinge mich dazu, aufmerksam an der Dissertation zu arbeiten, bedränge mich, zu schreiben, zu lesen, zu denken. Immer wieder schweifen meine Gedanken ab. Durch die Müdigkeit gnädig gebe ich den Abschweifungen jede Stunde ein bis zwei Minuten nach. Ich spüre den Körper, das Körperrumpeln nicht, bis ich aufstehe und sich mein Körper in Einzelteilen zur Treppe aufmacht. Die Treppe der Bibliothek ist das zentral im Raum angelegte Portal, jeder, der sich zu ihr hin oder von ihr fort bewegt, wird von den anderen aufmerksam beäugt. Dichtes Arenaflimmern: Für die soziale Akzeptanz ist es unablässig, hier eine gute Figur zu machen. Ich greife nach dem Geländer und frage mich, ob die anderen das Heroische in meinen kantigen Bewegungen erkennen.
Oder bloß einen Humpelnden sehen. Einen vorschnell Gealterten.
Meine Dehnübungen am Tisch verschleiere ich durch das Fallenlassen und Aufheben einer Papierseite.
Die Verabredung zum Mittagessen sage ich ab. Zu anstrengend.
-----
Der Marathon ist immer da: Er hockt im Halbschatten des Unbewussten, geiernd auf den richtigen Moment, ins Licht zu rücken; eine kleine Nachlässigkeit, eine Lücke zwischen zwei Konzentrationszügen, und er überspringt die Gleise hinüber zur Seite des Bewussten, seine Gegenwärtigkeit umso deutlicher machend, als er es direkt ausschreit: „Ich bin da, ständig.“
Manchmal erscheint er auch als der blinde Passagier, den man, einmal entdeckt und akzeptiert, aus den Gedanken ziehen lässt – der sich jedoch bei jeder Fahrkartenkontrolle wieder in die Erinnerung drängt.
Es hat etwas Teuflisches, wie sich der Marathon in verschiedenen Wesen äußert: als Gedanke an das gestrige Training, als plötzlicher Schmerz, als wundervolles fernes Ziel, als wundervolles nahes Ziel, als Druck, als Aufgabe, als gedankliche Vorstellung eines körperlichen Aktes, als etwas, das nach Optimierung verlangt.
An manchen Tagen schaffe ich es, die Gedanken in den Abend zu schieben, auf das Aufwärmen für das Tempotraining oder einen regenerativen Lauf.
Filip sagt, es kann kaum etwas Besseres passieren, zwei große Projekte, intensive Arbeit und Marathon, zur selben Zeit.
„Es ist doch ganz einfach, Flo, du kannst die Disziplin und die Konzentration aus dem einen ins andere mitnehmen. Schau mal, so bist du darauf eingestellt, die Sachen aktiv voranzutreiben. Gleichzeitig hast du wenig Raum und Zeit, zu hinterfragen. Optimal. Du bist doppelt diszipliniert, die Rhythmen stabilisieren sich gegenseitig. Ist doch geweldig, Flo, voller Fokus.“
Ich weiß nicht.
Es ist schwer, gegen diese Logik zu argumentieren. Trotzdem will ich schreien, Filip, ich bin erschöpft, doppelt erschöpft und nur halb anwesend; weder beim Laufen noch beim Arbeiten bin ich voll da.
„Eh, Flo, du bist doch hier, läufst, verbesserst dich – was jammerst du.“
Im Grunde hat Filip recht, voller Fokus: Wenn ich eh schon beim Training bin, kann ich dort auch alles geben. Und genauso: Wenn ich eh in der Bibliothek bin, kann ich mich dort auch auf das konzentrieren, was dort für mich zählt. Es sind die Gedanken an das jeweils andere, die mich abwesend sein lassen – nicht der Umstand, dass das andere auch existiert. Es kommt darauf an, beides auseinanderzuhalten, jeweils nur eins zu sein: Wenn ich trainiere, bin ich Läufer, wenn ich in der Bibliothek bin, dann als Wissenschaftler und Schreiber.
Bin ich im „Weder noch“ – im Bett, beim Essen, auf Wegen, mit Freunden –, schwirrt mein Geist im Zwischenraum. Oft greift er sich dann an den Vorstellungen fest, die ihm am meisten Halt versprechen: Träume von schnellen Läufen und weiten Strecken. Vorstellungen, die sich real anfühlen, weil nur das Training, ein paar Wochen Zeit, mich noch von ihnen trennt.
-----
Ganz abstreifen lassen sich die Zweifel nicht. Brutal ist es, wenn ich merke, dass die Arbeit meine Laufleistung einschränkt. Wenn ich nicht im Maximum trainieren kann – wofür das Ganze? Es fühlt sich an wie Selbstsabotage. Für Momente erliege ich wehrlos dem „Ganz oder gar nicht“-Druck. Und schon habe ich nicht zwei große Projekte, die einander ergänzen, sondern zwei, die sich gegenseitig bedrohen. Ist es wirklich so kompliziert?
Profiläufer haben das Problem nicht, bei ihnen sind Arbeit und Laufen eins. Nachdem Filip von einem Höhentraining in Äthiopien zurückgekehrt ist, erzählt er schelmische Geschichten von westweltlichen Aussteigern, die günstig wohnen, von Tag zu Tag leben, von Tag zu Tag laufen; er erzählt von Amateuren und Profis, die sich gezielt sechs, acht, zwölf Wochen vorbereiten, um im nächsten Lauf noch eine Minute rauszuholen; er erzählt von dem niederländischen Profiläufer, der in der achten Woche das Laufen gründlich satt hat, ständig meckernd längst nicht mehr einem eigenen Ziel zuläuft; der weitertrainiert, Tag für Tag, zwei- bis dreimal; der trainiert, weil es sein Job ist.
-----
Durch das Laufen lerne ich, dass es vier verschiedene Arten von Müdigkeit gibt: eine des Kopfes, auf den Körper bezogen: „Ich kann nicht mehr“; eine des Kopfes, um sich selbst kreisend: „Ich will nicht mehr“; eine des Körpers, auf den Kopf bezogen: „Ich werde nicht mehr“; und eine des Körpers, auf sich selbst bezogen: „Es geht nichts mehr“. Beinahe in jedem Lauf meldet sich eine von ihnen zu Wort.
Kreist der Kopf willensentleert um sich selbst, trösten ihn die Beine, die einfach weiterlaufen; der stummgestellte Kopf verliert seine Wirkkraft, die monotonen Körperbewegungen dröhnen laut. Droht der Körper dem Kopf mit Kündigung, ist es am Kopf, zu trösten: „Gleich geschafft, nur noch ein kleines Stück, wirklich.“ Der Körper ist naiv, er lässt sich besäuseln, ausbeuten, bis der Kopf sein Ziel erreicht.
Manchmal ist der Kopf stur und der Körper erschöpft. Einer spricht sein Missfallen laut aus, der andere fühlt sich ermutigt. Sie verbünden sich, rebellieren, steigern sich in eine Kaskade, an deren Ende ich langsam laufe oder stehe. Was bleibt denn da überhaupt noch, das weiterlaufen will?
An manchen Tagen bin ich dem Marathon machtlos ausgeliefert.
Lydia, die sich am Frühstückstisch beschwert: „Wann reden wir einmal über etwas anderes als den Marathon und dein Training?“
Die Marathonvorbereitung beeinflusst auch das Sexleben: Ständig zwickt irgendetwas, der Körper ist angespannt, oder ich bin erschöpft. Anfangs hadern wir noch, wagen zarte Versuche; im Laufe der Vorbereitung gewöhnen wir uns daran und peilen insgeheim die Zeit nach dem Marathon an.
An manchen Tagen wache ich mit kaltem Schweiß am ganzen Körper auf; an den Oberschenkelinnenseiten und den Waden verdichtet er sich zu einer Art fettem Talg.
-----
Ich schalte das Licht an meinem Arbeitsplatz aus. Ein paarmal ist der Marathon in den Bibliotheksnachmittag eingebrochen, hat sich an der Eingangskontrolle vorbeigeschlichen. Wir finden einen Kompromiss: Ich suche nach Studien, die sich mit dem Thema Marathon auseinandersetzen. Studien, die sich mit Laktatschwellen beschäftigen, dem Einfluss von Barfußlaufen auf den Laufstil, der Güte von mit Wasser gestrecktem und mit Salz versetztem Apfelsaft nach einem Lauf. Ich konsumiere die Studien in Form von kurzen Artikeln, die für Sportmagazine geschrieben sind: Einzeluntersuchungen, denen ich folge, als wären es unumstößliche Wahrheiten.
Zum Tagesabschluss laufe ich in gemütlichem Tempo von der Bibliothek nach Hause. Der Marathon läuft neben mir.
Auf die Party des Freundes am Abend verzichte ich, ich kenne das: Die Alkohol trinkenden anderen kommen mir Nüchternem albern vor; ich langweile mich unter den Beschwipsten. Wenn ich keiner von ihnen sein kann, bleibe ich lieber zu Hause.
Der Marathon reist überallhin mit, er hat einen festen Platz im Gepäck und eine klare Meinung.
-----
Alkohol und Marathon, das ist ein Thema.
Der Ägypter Abdel-Kader Zaaf hatte sich am 27. Juli 1950, mitten während der Tour de France, wegen Erschöpfung einen Moment unter einem Baum ausruhen müssen, irgendwo zwischen Perpignan und Nîmes. Zum Wachwerden träufelten ihm ein paar Zuschauer Wein auf die Zunge. Es half ihm tatsächlich auf die Beine, er düste los. Leider in die falsche Richtung.
Mehr als 65 Jahre nach dieser Episode höre ich ein Radiointerview. Die Interviewte, eine große Managerin, die kurz vor ihrem zehnten Marathon steht, schnaubt verächtlich: Längst habe sie das abgestellt, das allzu amateurhafte „in der Trainingsphase auf Alkohol verzichten“. Anschließend zählt sie ihre Lieblingswodkamarken auf.
Marathon und Alkoholverzicht. Es ist ja so: Nach den ersten herausfordernden Wochen sinkt das Bedürfnis von ganz allein.
Trotz Alkoholverzichts arbeite ich auch in der Marathonzeit einmal wöchentlich in einem Weinladen: Statt zu trinken, schwenke ich die Weine ausgiebig, halte meine Nase tief ins Glas. Es muss wunderlich aussehen.
Manchmal sitzt auch dort im Laden der Marathon und sortiert Weine. Er klimpert mit den Flaschen, beißt beherzt von einer Möhre ab, streckt sich.
„Weißt du“, sagt er kauend, „wenn ich dich hier so sehe … Vielleicht solltest du doch lieber in einem Quarkgeschäft arbeiten.“
-----
Es dauert noch ein paar Wochen, bis ich den Marathon endlich abschüttle – indem ich ihn laufe. Im Verhältnis zur Vorbereitung ist der Lauf selbst bloß ein Wimpernschlag.
Vielleicht macht gerade das ihn so bedeutsam.