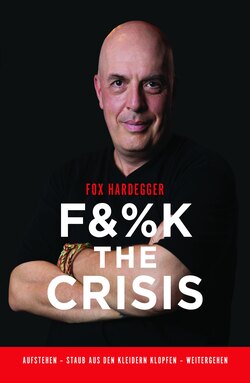Читать книгу F&%K THE CRISIS - Fox Hardegger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHimmlisch gute Unterhaltung
Als 20-Jähriger stand ich vor der Frage, was ich beruflich machen will. Mein Grossvater war mittlerweile verstorben. Während seiner schweren Krankheit war ich zu unreif gewesen, um ihn zu begleiten. Ich erinnere mich an einen Besuch im Spital. Es ging dem Ende entgegen, das wusste ich und wollte ihn unbedingt noch einmal sehen. Er war ein Schatten seiner selbst. Ich versuchte ihm zu erklären, wer ich bin und dass ich nicht Matthias heisse. Er war vollgepumpt mit Opiaten, erkannte mich nicht.
Ich besuchte ihn nicht mehr, weil ich seine Hilflosigkeit und seine Verzweiflung nicht ertrug. Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie er gewesen war. Monate später lag er aufgebahrt in seinem Haus. Wir waren allein und ich erinnere mich an eine tiefgehende Begegnung, die mit dem intensiven Gefühl verbunden war, dass von uns allen wenig bleibt. Und: Irgendwann gibt es nichts mehr nachzuholen. Später realisierte ich, dass ich etwas verpasst hatte, als ich ihn nicht mehr besuchte. Dass wir uns verpasst haben. Eine schmerzhafte Erkenntnis. Eine andere Gewissheit vermittelte mir jedoch ein wenig Trost: Mein Grossvater war ein Lebemann gewesen, er konnte seine Neigungen, seine Extravaganz ausleben, hatte selbst wohl nichts verpasst, war auf seine Art glücklich gewesen.
Heute lasse ich mich bewusst im romantischen Glauben, dass mein Grossvater da oben auf einer Wolke sitzt, zusammen mit meinem Vater. Im Glauben an mich werden sie sich kolossal amüsieren, wenn ich wieder einmal scheitere, und gross ist ihre Freude, wenn ich erfolgreich bin, eine glückliche und gute Phase folgt. Es muss eine himmlisch gute Unterhaltung sein. In der Gewissheit, dass auch ich das Leben voll auszuschöpfen weiss, Niederlagen keine allzu grosse Wichtigkeit beimesse und den buddhistischen Rat verinnerlicht habe, dass man das Leben mit einem Lächeln meistert oder dann gar nicht, sind sie vermutlich zufrieden mit mir.
Die Erfahrungen mit meinem Grossvater, seine Krankheit und sein Tod, sollten meinen weiteren Lebensweg beeinflussen. Zum ersten Mal tat ich, was ich in den folgenden Jahrzehnten so oft tat. Interessierte mich eine Thematik übermässig, machte ich einen Beruf aus ihr. Nun wollte ich mich vertieft mit dem Alter und der Endlichkeit auseinandersetzen und hochbetagte Menschen in der letzten Lebensphase begleiten. Mit anderen Worten: Ich absolvierte ein Praktikum als Altenpfleger. Trotz vieler positiver Aussagen aus meinem beruflichen Umfeld gab es in den folgenden Jahren immer neue Ausreden, warum ich die Ausbildung an einer Schule für Krankenpflege nicht absolvieren darf. In der Hoffnung, dass es doch noch klappen wird, absolvierte ich ein zweites und ein drittes Praktikum.
Nun war ich also Hilfspfleger, trug einen weissen Kittel und die Menschen, die ich betreute, waren meine Patienten. Ich liebte meine Schützlinge, die mich an ihren Lebenserfahrungen teilnehmen liessen. Nicht nur klug, sondern auch abgeklärt und sogar ein wenig kaltschnäuzig, rechneten viele in fast amüsanter Weise mit ihrem Dasein ab. Ich lernte von ihnen Langmut, Tapferkeit und Toleranz. Probleme wussten sie oft zu relativieren. Sich selbst nahmen sie nicht wahnsinnig wichtig oder ernst und vieles beurteilten sie weniger engstirnig als meine jugendliche Peergroup.
Mit der Zeit ergaben sich persönliche Beziehungen. Zum Beispiel mit Berta. Stark übergewichtig setzte sie das Motto «chill your life» sehr konsequent um. Die Tage verbrachte sie, die Decke bis zum Kinn hochgezogen, am liebsten im Bett. Wenn wir sie zu einer Aktivität animieren wollten, stellte sie sich schlafend. Oder gab vor, von einem anderen Pfleger bereits bettfertig gemacht worden zu sein, was quasi als Absolution galt, sich ungestört dem Faulenzertum widmen zu dürfen. Da die Decke zu kurz war, mussten wir nur einen Blick in Richtung Bettende werfen, um den Schwindel zu entlarven: Ihre Füsse steckten in Schuhen! Sie genoss die provozierte Aufmerksamkeit, wie ihr diebisches Lächeln verriet. Gemäss Pflegeverordnung sollen Patienten nicht den ganzen Tag im Bett liegen und so kam es, wie es kommen musste. An Bertas Bett wurde tagsüber ein Gitter angebracht.
Nun war es vorbei mit den spontanen Nickerchen. Doch nach einige Tagen zeigte ich ihr heimlich, wie das Gitter entfernt werden kann. Vor allem am Stationsrapport gab es nun lange Diskussionen und unterschwellig war Bewunderung zu spüren: Wie hatte es Berta bloss geschafft, das Hindernis zu demontieren?
Fortan war ich Bertas Liebling und auch die übrigen alten Menschen brachten mir viel Wertschätzung und Zuneigung entgegen. Ein anderer positiver Aspekt meiner Tätigkeit war, dass ich einer der wenigen heterosexuellen Pfleger auf der Station war.
Nach der Arbeit ging ich selten allein nach Hause. Dieser Vorteil setzte sich fort, als ich doch noch eine Chance erhielt, um die reguläre Ausbildung zu absolvieren. Als einziger Mann der Klasse war sogar die Lehrerin in mich vernarrt. In vielen Fächern war ich unter den Klassenbesten und den Zwischenabschluss schaffte ich mit Bravour. Dies verhinderte nicht, dass ich bald glaubte, alles erlebt und ausgeschöpft zu haben, was mit diesem interessanten Beruf zusammenhängt und die Einsicht festigte sich, dass ich bald zu neuen Ufern aufbrechen will.
Ohne genauen Plan, was ich machen will, stand ich vor der Frage, wie es weitergehen soll. Taxifahren kann jeder und spült als Tätigkeit sofort Bares in die Tasche. Leider wusste ich nicht, dass man als Taxifahrer eine Ausbildung machen muss. So landete ich als Kurierfahrer beim Paket- und Brief-Express-Dienst, DHL. Die junge Firma befand sich damals in amerikanischen Händen. Ich liebte meinen Job sofort, denn die Anforderungen waren hoch, dass Tempo schnell und: Bis in die Chefetagen hinauf waren alle miteinander per «Du».
Je mehr die anderen stöhnten, desto grösser war mein Elan. Egal, wie viele Pakete an einem Tag auf mich warteten, ich würde sie alle zustellen. DHL war damals noch ein Start-up, sehr chaotisch, undiszipliniert, jedoch auch offen, dynamisch und unbürokratisch. Heute ist DHL Teil der deutschen Post. Einige Menschen, die damals an mich glaubten, sind noch heute in der Firma beschäftigt.
Der Kurierdienst machte Spass, doch ich wusste, dass es keine Aufgabe ist, die mich bis ans Ende meiner Tage herausfordern wird. Ich wollte an die Front, dorthin wo die Post wirklich abgeht.
Ich sah meine Kollegen, die als Verkaufsmanager teure Anzüge trugen und spannende Aufgaben zu bewältigen hatten. Das wollte ich auch. Doch es gab keine offenen Stellen in diesem Bereich. Für einmal kam nun meine Mutter ins Spiel. Sie kannte ein Generalagent bei der ältesten, grössten und wohl auch konservativsten Lebensversicherungs-gesellschaft der Schweiz und vermittelte mir den Kontakt.
Beim ersten Vorstellungsgespräch liess man mich wissen, es gäbe keinen objektiven Grund, um mich einzustellen. Ich solle selbst einen Grund nennen, der für eine Anstellung spreche. Ich war jung, wild und hatte, aus welchen Gründen auch immer, sehr viel Selbstvertrauen. Meine Antwort lautete: «Weil ich mehr Umsatz machen werde als der Rest des Verkaufsteams.» Dieses umfasste immerhin 75 Kollegen. Ich versprach: Sollte es mir nicht gelingen dauerhaft unter den Top-10 zu bleiben, werde ich wieder kündigen. So viel Kaltschnäuzigkeit beeindruckte sogar den Direktor der Region. Ich verliess das Gebäude beschwingt, denn bald würde ich in Anzug und Krawatte durch die Gegend spazieren und mit dem Verkauf von Lebensversicherungen viel Geld verdienen.
Die Anstellung war der einfachere Teil gewesen. Nun musste ich liefern und zuvor vor allem sehr viel lernen: Das Sozialversicherungswesen mit all seinen Feinheiten in kurzer Zeit zu begreifen und anzuwenden, hatte seinen Preis. Drei Monate lang sass ich Tag und Nacht über den Büchern. Ich bestand alle Prüfungen und erhielt grünes Licht, um auf die Piste zu gehen und Kunden zu besuchen. Vor einer fremden Haustüre zu stehen, zu klingeln und die Leute von meinem Angebot zu überzeugen, erwies sich als harte, aber lehrreiche Schule. Ich verkaufte sehr gut und innerhalb von neun Monaten hatte ich mein Versprechen eingelöst, den Grossteil des Verkaufsteams hinter mir zu lassen. Ich konzentrierte mich – anders als jene Kollegen, die stets diverse kleinere Eisen im Feuer hatten – auf die grossen Fische und veränderte meine riskante Strategie auch nicht, als mir alle davon abrieten. Meine Devise, ich will lieber die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand, machte sich bezahlt. So kam es, dass ich als ehemaliger Schulabbrecher und schwer erziehbarer Jugendlicher Anfang Zwanzig bereits sechsstellig verdiente. Dass mein Gehalt mit denjenigen meiner studierten Kollegen mithalten konnte, vermittelte mir noch mehr Selbstvertrauen und einen Kick. Um meinen Erfolg auch nach aussen sichtbar zu machen, lebte ich bald in einer tollen Attikawohnung, kaufte mir einen schönen Kaschmir-Mantel von Boss und legte mir ein standesgemässes Fahrzeug zu. Ich war erfolgreich und sehr hungrig und im Wissen um meine Talente wollte ich viel erleben, viel erfahren und viel Geld verdienen.
Natürlich wurde in diesem Business mit harten Bandagen gekämpft, was ich als spannende Herausforderung erlebte. Vor allem lernte ich, mich zu verkaufen. Es bedeutet, dass man sich präsentieren kann, die Sachen auf den Punkt bringt, die Ziele in einem Gespräch so formuliert, dass man sie erreicht. Ob man selbst verstanden wird, so lernte ich bald, ist kein Zufallstreffer. Man muss dafür sorgen, dass man sich verständlich machen kann, was auch bedeutete, dass man anderen zuhört, sie verstehen will. Als weitere Meilenstein in diesem Prozess erwies sich das Vermögen nicht aufzugeben, wenn man brutal zurückgewiesen wird. Rückblickend kann ich sagen: Bei all diesen Erfahrungen handelte es sich um eine wertvolle Lebensschule.
In den folgenden Jahren genoss ich das Geld und viel Freiraum. Ich erkannte meine Begabung mit Menschen umgehen zu können, gleichzeitig verfügte ich über einen untrüglichen Jagdinstinkt. Zwei Jahre kostete ich dieses Leben in vollen Zügen aus, doch mit der Zeit verstärkte sich mein Bedürfnis, mich mit anderen Themen als nur dem materiellen Erfolg zu befassen. Ich wollte eine Aufgabe finden, die mich auf einer kreativen und geistigen Ebene erfüllt und so beschloss ich eine ziemlich radikale Kehrtwende. Ich machte – mein seit Jahren gepflegtes Hobby – zum Beruf und fristete künftig des Daseins eines Künstlers.
Meine dritte berufliche Tätigkeit ging ich mit ähnlichem Elan an, wie alles was ich bisher getan hatte. Mein Atelier befand sich in einer ehemaligen Brauerei und lag direkt am Wasser, an der Aare. Es verfügte über eine eigene Dachterrasse, die zum Fluss hin ausgerichtet war: Ein regelrechtes Paradies, das ich dem Besitzer abgeschwatzt hatte. Mein neues Leben besiegelte eine ausschweifende Einweihungsparty. Aufgrund der Lage mit vielen Badenden, die von meinem Boden aus direkt in die Aare springen konnten, machte ich viele spannende und unkonventionelle Bekanntschaften. Es folgte ein perfekter Sommer: Ich besass Ersparnisse, an den Wochenenden verdiente ich als Barkeeper zusätzlich etwas Geld und meine künstlerischen Ambitionen hätte ich gemächlich angehen können. Doch bereits nach einigen Monaten fanden die ersten Vernissagen statt. Die bunten und grossflächigen Werke sprühten vor Energie und Lebensfreude und verkauften sich – sogar zu meinem Erstaunen – wie frische Semmeln.
In dieser wunderbaren Phase trat ein Engel in mein Leben: Eines Nachts, ich arbeitete in der angesagten Bar der Stadt, der Laden brummte, stand sie plötzlich vor mir: Tina. Das faszinierendste Geschöpf, das ich jemals gesehen hatte. Zwei winzige aufgeklebte Diamanten liessen ihre Augen strahlen, über Schulter und Armen baumelte eine Federboa und eine wilde Haarmähne. Ein Fabelwesen von einem anderen Stern. Geheimnisvoll. Und wunderschön. Bei ihrem Anblick fühlte ich, was ich bisher noch nie gefühlt hatte. Wir schauten uns an, wechselten einige Worte und ich war sofort unsterblich verliebt. Heute glaube ich nicht mehr an Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht ist sie der Jugend vorbehalten, wenn man noch echte Romantik und wenig Erfahrung in sich trägt. Aber damals war alles möglich und ich wusste: Es ist eine magische Begegnung.
Sie war erst 17 Jahre alt, stammte aus Glarus und durfte nur im Ausgang sein, weil ihre ältere Schwester auf sie aufpasste. Was diese auch tat. Ich wusste, dass ich Tina auf keinen Fall gehen lassen durfte. Bevor die Gruppe übereilt aufbrach, verabredete ich mich mit ihr: Obwohl sie keine Ahnung hatte, wie sie ihre Eltern davon überzeugen sollte, dass sie sich in Bern mit einen wildfremden Typen treffen wollte, um das Wochenende mit ihm zu verbringen, versprach sie mir, die dreistündige Zugfahrt auf sich zu nehmen und in genau zwei Wochen, zur genannten Zeit, am Bahnhof, auf mich zu warten.
Die Situation war verzwickt, denn drei Tage später flog ich nach Vietnam. Ich wollte das Land, in dem sich mein Vater während meiner ganzen Kindheit und Jugend, sechs Monate pro Jahr, aufgehalten hatte, kennenlernen. Ohne Vorbereitung und ohne ihn zuvor kontaktiert zu haben, bestieg ich den Flieger Richtung Asien und landete in Saigon.
Vietnam traf mich mit voller Wucht. Nicht nur weil ich Tina vermisste, empfand ich das Land als frustrierend und bedrückend.
Unsinnige Regeln und Restriktionen sowie eine desolate Infrastruktur erschweren den Menschen das Leben. Der Vietnamkrieg war schon lange zu Ende, aber die extreme Armut war allgegenwärtig. Das Elend von kriegsversehrten Menschen, darunter viele ohne Beine, die auf selbstgebastelten Rollbrettern, die sie auf Bodenhöhe mit den Händen antrieben, durch die dreckigen Gassen bewegten, schockierte mich. Dass viele Bettler Jagd auf mich machten, verstand ich und andererseits schränkten sie meine Bewegungsfreiheit zusätzlich ein. Ausser den Denkmälern von Ho Chi Minh und anderen Kriegsdenkmälern gab es – anders als heute, wo prächtige Hotelanlagen, kilometerlange Strände, ein ausuferndes Freizeitangebot und eine fantastische Infrastruktur viele Touristen anlocken – nicht viel zu sehen und jene Zustände, die sich bei meinen kleinen Reisen über das Land präsentierten, vermochten meine Stimmung auch nicht zu heben. Die Amerikaner warfen in Vietnam mehr Bomben ab als die Alliierten im zweiten Weltkrieg über Hitler-Deutschland. Von dieser Zerstörung und den traumatischen Folgen des Kriegs hatte sich das ländliche Vietnam in den 1990er-Jahren nicht erholt. Der Aufenthalt war demoralisierend: Mir war es schleierhaft, wie mein Vater hier ein Imperium hatte aufbauen können und ebenso rätselhaft fand ich es, dass er sich in Vietnam offenbar wohlfühlte. Getroffen haben wir uns übrigens nicht. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt hielt er sich in der Schweiz auf und zeigte sich ein wenig enttäuscht, dass ich meine Reise nicht mit ihm abgesprochen hatte.
Ich fieberte der Rückreise und vor allem dem Wiedersehen mit meiner Traumfrau entgegen und spielte, etwas unsicher geworden, verschiedene Szenarien durch: Würde Tina die Vereinbarung einhalten, war es ihr ähnlich ergangen wie mir? Hatte sie mich vermisst oder vielleicht bereits wieder vergessen? Möglich war auch, dass die Eltern ein Veto eingelegt hatten, sie nicht gehen liessen. Nach der Landung in Zürich reichte die Zeit knapp, um nach Bern zu fahren, eine Dusche zu nehmen, mich in frische Kleider zu stürzen. Dann stand ich am vereinbarten Treffpunkt, sah sie bereits von Weitem auf mich zulaufen und wusste augenblicklich: Alles ist gut. Wir schwebten durch die Stadt, liessen uns treiben, hielten immer wieder inne, küssten uns, umarmten uns. Sehr verliebt und unglaublich glücklich war uns beiden klar; wir würden unzertrennlich bleiben. Zu Hause angelangt, war es kurz und diskret zusammengefasst so: Wir verliessen die Wohnung bis am Sonntagabend nicht mehr.
Nur wenige Tage später besuchte ich Tina – und vor allem ihre Eltern – in Glarus. Ich wollte einen guten Eindruck hinterlassen, war etwas nervös. Doch sie nahmen mich mit offenen Armen auf. Ich fühlte mich wohl bei ihnen. Die Mitglieder dieser Familie begegneten einander mit Interesse und Wohlwollen. So ein Zuhause hatte ich mir auch gewünscht. Und: Sie schienen mich zu mögen, vertrauten mir.
Tina und ich. Ich und Tina. Eine wundervolle Zeit brach an. Ich liebte dieses Mädchen vom ersten Tag an und die gemeinsamen Erfahrungen schweissten uns eng zusammen. Wenn ich die Woche über in Bern sein musste, vermisste ich sie extrem. Als sie sich entschloss, in Zürich eine Lehre zu absolvieren, hängte ich meine Karriere als Kunstmaler an den Nagel, beschloss den Wegzug von Bern. Von dieser Entscheidung erhoffte ich mir ein gemeinsames Leben unter einem Dach. Ich erinnerte mich an meine Zeit beim Kurierdienst und den grosszügigen Lebensstil, den sich die Verkäufer bei DHL leisten konnten.
Kurz entschlossen, meldete ich mich bei der Firma zurück und wurde tatsächlich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, das bereits einen Tag später stattfinden sollte. Ich kramte aus meinen Künstlerklamotten ein zerknittertes Hemd hervor. Ein Bügeleisen besass ich nicht mehr. Also setzte ich Wasser auf, wartete, bis es sprudelte, goss es ab und fuhr mit dem heissen Boden der Pfanne über das vor mir liegende Kleidungsstück. Zum Gespräch erschien ich in einem fast perfekt gebügelten weissen Hemd und zwei Stunden später verliess ich das Gebäude als «Field Sales Repräsentative /DHL Schweiz». Zum rasanten Aufstieg als Aussendienstmitarbeiter gehörten ein Firmenwagen und ein sehr gutes Gehalt.
Nun stand dem Zusammenleben mit Tina in Zürich nichts mehr im Weg. Ich mietete eine exklusive Dachwohnung, die über drei Terrassen und ein Cheminée verfügte. Beim gemeinsamen Zuhause handelte sich um einen Neubau, sehr edel mit hohem Giebeldach und einer Raumhöhe von fast vier Metern. Wir verbrachten wunderbare Jahre. Doch dumm und arrogant wie ich damals war, glaubte ich es mit der Treue nicht so genau nehmen zu müssen. Ich setzte mein Glück aufs Spiel und fügte jenem Menschen, den ich liebte, Schmerz zu. Tina verzieh mir jahrelang, immer wieder, doch heftige Auseinandersetzungen gingen der Vergebung jeweils voraus. Einmal eskalierte ein Streit, ich warf meinen Schlüsselbund nach ihr, der sie nur knapp verfehlte und krachend zu Boden fiel. Wir erstarrten förmlich, blickten uns erschrocken an. Schlagartig wurde mir bewusst. Es ist vorbei. Das gemeinsame Strahlen war erloschen.
Die Trennung war schlimm. Wir liebten uns noch immer, aber es ging nicht mehr. Ich war am Boden zerstört, sicherte Tina zu, die Miete für die nächsten Monate zu übernehmen und zog Hals über Kopf aus. Wohin? Keine Ahnung! So landete ich auf einem Zeltplatz in Wollishofen am Zürichsee. Ich mietete einen zwölf Meter langen Wohnwagen. Meine Nachbarn waren jetzt Pensionisten und abgebrannte Touristen. Mein Parkplatz fürs Auto lag zuhinterst auf dem Areal. Ich war jetzt 27 Jahre alt und stürzte mich ehrgeiziger denn je in die Arbeit. Mehrere Male wurde ich bei DHL befördert und durfte mich nun «Account Manager ABB» nennen. Zuständig für unseren grössten Schweizer Kunden, leitete ich in dieser Zeit einige der spannendsten und wichtigsten Logistik-Projekte für die Firma und hatte weitreichende Entscheidungsgewalt.
Am Morgen überquerte ich den Campingplatz, frisch geduscht, voll gestylt mit Krawatte und im Anzug. Die Anhänger der Badehosen-Adiletten-Front, die zu diesem Zeitpunkt verschlafen, rauchend und Kaffee schlürfend auf den Vorplätzen sassen, staunten nicht schlecht. Bald war ich auf dem Campingplatz bekannt wie ein bunter Hund und die Abende verbrachte ich mit meinen neuen Kollegen. Tina fehlte mir wahnsinnig, ich litt unter heftigem Liebeskummer.