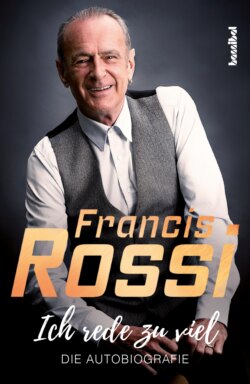Читать книгу Ich rede zu viel - Francis Rossi - Страница 7
ОглавлениеIch lernte Gitarre, indem ich mir Platten anhörte und dazu mitspielte. Zuerst Pop-Scheiben, die ich mochte, danach einfach alles. Ich erinnere mich noch an Guy Mitchell, den Lieblingskünstler von Mum, zu dessen Musik ich klampfte. „Everybody’s Somebody’s Fool“ von Connie Francis gehörte auch zu den Stücken, die ich mir schnell „draufschaffte“.
Aber Achtung, als Kind war ich in Connie Francis verknallt und stellte mir vor, sie zu treffen und durch meine unglaubliche Fähigkeit zu beeindrucken, ihre Hits zu spielen. Ich liebte ihre Stimme: Dieser besondere Gesangskniff machte ihre Musik für einen vor-pubertären Jungen ungemein sexy. Hinzu kam noch, dass sie Italienerin war. Erst viel später merkte ich, mir eine Art Pop-Version amerikanischer Country-Musik angehört zu haben. Seitdem gefällt mir Country.
Aus mir sollte nie ein Virtuose werden. Ich nahm nur eine einzige Stunde Gitarrenunterricht bei einem zweifelhaften alten Knacker von Len Stiles Music in der Lewisham High Street. Es war ein Plattenladen, der auch Musikinstrumente verkaufte, darunter E-Gitarren. Len Stiles war der Shop, in dem man abhing, Nelson-Zigaretten qualmte und über Musik fachsimpelte. Der Verkäufer gab Unterricht, und ich glaubte, es sei der beste Ort, um das Gitarrenspiel zu lernen. Doch als ich ihn bat, mir einige Everly-Songs zu zeigen, sah er mich wütend an. „Wir machen hier keinen Mist, Bübchen!“ Mich „Bübchen“ zu nennen, schreckte mich sofort ab. Das klang so altbacken. Ich ging raus und kam nie wieder. Im Grunde genommen waren es sogar zwei Unterrichtstunden – meine erste und meine letzte!
Danach hatte ich das Gefühl, dass allein der Versuch, ein Instrument zu lernen, veraltet ist. Die Lehrer, die meist alte Tanzlieder oder Balladen zum Unterricht anboten, halfen mir auch nicht weiter. Ich wollte „(Till) I Kissed You“ von den Everlys lernen, nicht irgendeinen steinalten Walzer. Anscheinend musste man zum Autodidakten werden, wollte man die modernen Sounds nachspielen, die im Radio liefen. Zwischen der jüngeren und der älteren Generation bestand damals gar keine Verbindung, was besonders die Musik anbelangte. Die Musiklehrer weigerten sich, jüngeren Instrumentalisten wie mir so einen „Mist“ wie die Everlys oder die Beatles beizubringen. In Letztere hatte ich mich natürlich verliebt, so wie auch alle anderen 1962. Sie ähnelten den Everly Brothers, da sie auch Gitarren spielten, doch sie hatten eingängigere Songs und diesen brillanten Satzgesang, bei dem ihre Stimmen wie eine einzelne klangen.
Natürlich werden sich bei dieser Information jetzt einige Klugscheißer da draußen „einen abkichern“ und sich darüber wundern, wie das die „beschränkte Bandbreite“ der Musik Status Quos erklären könnte, und uns wieder dieses alte Label aufdrücken – Gesenkte-Köpfe-drei-Akkorde-purer-Boogie. Und ich will einräumen, dass sie auch Grund für die Kritik haben – bis zu einem bestimmten Punkt. Ich war vielleicht niemals in der Lage, Gitarre auf einem so hohen „Jetzt klappt dir aber die Kinnlade runter“-Niveau zu spielen wie Eric Clapton oder Jeff Beck, doch ich zeigte mich fest entschlossen, ein verdammt guter Songwriter zu werden.
Mal ganz nebenbei bemerkt: Wenn man sich die Musik genau anhört, lässt sich erkennen, dass sowohl ich bei einem eher straighten Song wie „What You’re Proposing“ – 1980 ein großer Hit für Quo – als auch Clapton in seiner leidenschaftlichen Cream-Ära oft dieselben Akkorde nutzten. Es geht nicht darum, wie viele – oder wie wenige – Noten man spielt oder wie schnell, sondern darum, ob die Musik die Seele berührt – oder die Gegend da „unten rum“! Auf einer Gitarre kann man so viele unterschiedliche Noten und Akkorde spielen, doch es kommt letztendlich auf das „Wie“ an. Das bedeutet, dass es wichtig ist, wer du wirklich bist, nicht, was du vortäuschst. Es kursiert eine Story über den großartigen amerikanischen Gitarristen Chet Atkins, die ich wirklich mag. Chet konnte alles spielen, von Country bis hin zu Pop und auch die dazwischenliegenden Stile. Man kannte ihn als Mr. Guitar. Nun, diese Story über ihn mag wohl ein wenig merkwürdig erscheinen, drückt aber alles aus. Chet Atkins saß einmal in einem Gitarrenladen auf einem Stuhl und klimperte so aus Spaß ein wenig auf der Klampfe herum. Einer der Kunden unterbrach ihn und sagte: „Meine Güte, Mr. Atkins, die Gitarre klingt aber wunderschön.“ Chet blickte zu ihm auf und antwortete mit einem einfachen „Yeah“! Er stand auf, stellte die Gitarren in den Ständer und fragte: „Und wie klingt sie jetzt?“
Die Moral der Geschichte: Jeder kann eine Gitarre in die Hand nehmen, doch ein Musiker wird immer nur wie er selbst klingen. Und darauf sollte man auch abzielen: aus der Gitarre etwas herausholen, das einem was bedeutet. Natürlich benötigte ich lange Zeit, um mir darüber klarzuwerden. Wenn irgendwelche Leute sich über Quo als Drei-oder-vier-Akkord-Band lustig machen, sagt das viel mehr über sie selbst aus als über die Leistungen, die Quo als Band abgeliefert haben.
In dem Moment, in dem ich die grundlegenden Akkorde beherrschte, sah es mit dem Lernen nicht mehr so rosig aus. Das trifft auch auf Übungen zu, die ich damals nicht benötigte und die ich auch aus dem Fenster warf. Ich behaupte aber nicht, dass das sinnvoll war. Heutzutage übe ich jeden Tag, doch als Jugendlicher war ich noch unbeirrbarer, was eine eigene Band anbelangte. Ich wollte raus in die Welt und überall spielen, wo man uns nur ließ.
Als ich Alan Lancaster traf, stand ich auf die „ganz harten“ Sachen. Damit meine ich den amerikanischen Rock’n’Roller Jerry Lee Lewis, der mir eine Höllenangst einjagte, und all die anderen wilden und durchgeknallten Sänger wie Little Richard, Eddie Cochran, Gene Vincent, Chuck Berry … Damals entdeckte ich auch Buddy Holly, der den Everly Brothers ähnelte, abgesehen davon, dass er sich durch einen bestimmten außergewöhnlichen Stil absetzte – eine Stimme, mit der er einen Schluckauf simulierte, und eine fantastische Begleitband. Nicht zu vergessen diese Songs, die besten komponierte er selbst … und er trug eine Brille und zählte nicht zu den üblicherweise gutaussehenden Popstars. Damit glich er damals vielen jungen aufstrebenden britischen Musikern. Ich dachte mir, wenn er es geschafft hat, gibt es für uns alle eine Chance.
Alan und ich musizierten noch mit unseren Blasinstrumenten im Schulorchester, als er und der andere Alan – Key – sich darüber unterhielten, außerhalb der Penne eine kleine Beatband zu gründen. Keys älterer Bruder spielte in Rolf Harris’ Begleitband, die einige Hits hatte mit „Tie Me Kangaroo Down, Sport“ und „Sun Arise“, das damals eine ganz große Sache war. Er erlaubte Alan seine Ersatz-Stratocaster zu benutzen, weshalb ich ihn zutiefst beneidete. Ein anderer Freund aus der Schule, Jess Jaworski, spielte Orgel und Alan Lancaster den Bass. Irgendwie gelang es ihm, dass seine Eltern für einen hellblonden Höfner Bass blechten. Ich war verblüfft – und beeindruckt. Es war ein wunderschön anzusehendes Instrument, doch er konnte sich keinen Koffer leisten, weshalb er den Höfner in einer alten Einkaufstüte aus Plastik mit sich herumschleppte.
Der Drummer war ein Typ namens Barry. Ich kann mich nur noch an seinen Vornamen erinnern, wofür er mich wohl hassen wird, doch wahrscheinlich hasst er mich sowieso. (Einen Moment noch, dann werde ich das erklären.) Damit blieb ich an der Gitarre über, was okay war, denn wir „muckten“ rum und versuchten uns an Shadows-Instrumentals wie „Apache“ und „Kon-Tiki“. Nicht dass ich in der Lage gewesen wäre, wie ein Hank Marvin zu spielen! Für solch raffinierte Soli war ich viel zu faul, weswegen Jess einen Großteil der Soloarbeit auf der Orgel übernahm. Doch dann wollte die restliche Band einen Sänger – und ich sollte es sein! Nicht, dass ich darum gefeilscht hätte. Es war eine Sache, den Text von „Wake Up Little Susie“ oder „Love Me Do“ zu kennen, aber eine ganz andere, ihn auf der Bühne vor einem Publikum zu singen. Doch sie erklärten in aller Deutlichkeit, sich um einen anderen Sänger zu kümmern, wenn ich es nicht machen wolle. Ich hielt also die Luft an und sprang ins tiefe Becken. Und … es schien zu funktionieren. Ich glaube, ich sang „Michael (Row The Boat Ashore)“. Tja, da wir so einen Krach veranstalteten, konnte man den Gesang nicht wirklich gut hören, womit ich für den Moment erst mal sicher war. So sah ich das damals zumindest.
Der ganze Firlefanz mit dem Singen fing in der Schule im Orchester an. Im Grunde genommen orientierten wir uns an Kenny Ball and His Jazzmen, einer der neuen, aber auch traditionell ausgerichteten Combos aus Essex, die in den frühen Sechzigern einige Hits hatten. Der Bandleiter Kenny Ball legte an einigen Stellen seine Trompete zur Seite, um einige Worte zu trällern. Wir spielten einen von Kennys großen Hits, „When The Saints Come Marching In“.
Doch es war lediglich Schulkram, wir wussten das. In einer Band zu singen, während man noch Gitarre spielt, war auf einer ungleich höheren Ebene angesiedelt. Heute kann ich darüber lächeln, denn wir schafften es nicht – und da bin ich mir ziemlich sicher –, auch nur einen einzigen Auftritt zu machen. Wir probten lediglich in Jess’ Zimmer. Die Band hieß übrigens die Scorpions. Doch dann entschied sich Alan Key, der ironischerweise die Gruppe ins Leben gerufen hatte, zum Ausstieg. Er gab die Absicht bekannt, seine Freundin zu heiraten – sie war tatsächlich das Mädchen von nebenan –, sobald sie beide 16 Jahre alt seien. Für ihn schien es das Beste zu sein, von seinem Posten abzutreten und uns damit genügend Zeit zu geben, uns nach einem neuen Organisten umzusehen. Alan war sehr liebenswert, immer höflich und bedacht. Man möchte behaupten, viel zu nett, um Profimusiker zu werden.
Zurückzutreten, stellte für einen 14-Jährigen eine noble Geste dar, sehr großzügig und vorausschauend. Wir ich später herausfand, müssen sich junge Musiker in einer Band früher oder später mit der Frage auseinandersetzen, ob sie mit einem Partner sesshaft werden wollen oder alles aufgeben, um es als Musiker zu versuchen. Die meisten schieben die Entscheidung aber viel zu lange auf. Das behindert entweder die Bandarbeit oder zerrüttet die Beziehung. In meinem Fall traf das Letztere zu. Alan Key sah das hingegen alles voraus und machte das für ihn Richtige. Seine Belohnung: Er ist immer noch mit dem Schwarm seiner Teenagerzeit zusammen. Meine Belohnung: Ich spiele immer noch in einer Band.
Ich hatte nie das Gefühl, aus einer sicheren häuslichen Situation in die Welt hinauszugehen, wo mein Weg in ein sogenanntes normales Leben schon vorgezeichnet war – Schule, Job, Frau, Kinder, Tod. Für die Familie Rossi bedeutete Schule das, was wir zuhause lernten, Jobs das, was wir von zuhause aus machten, und Frauen mussten sich da irgendwie einfügen. Kinder waren Frauensache, und der Tod stand für etwas, das mir niemals zustoßen würde, vielen Dank auch!
An diesem Punkt tauchte dann John Coghlan in der Geschichte auf. Nicht als Ersatz für Alan Key, sondern um Barrys Aufgabe zu übernehmen. Das lief alles ein wenig kompliziert ab, weshalb ich mich auf die Kurzversion beschränke. Barrys Dad hatte uns einen anständigen Proberaum beschafft, eine alte Garage in der Lordship Lane, Dunwich, im Süden Londons. Sie lag direkt neben dem Hauptquartier des Air Training Corps (ATC). Alle Piloten in Ausbildung mussten dorthin, und so trafen wir auf John, einen der Kadetten. Wir spielten erst seit einigen Wochen in dem Garagenkomplex, als wir entdeckten, dass die Soldaten ihre eigene Band hatten, die ebenfalls dort probte. Sie nannten sich – lassen Sie sich überraschen – die Cadets. Eines Abends gingen wir zu den Musikern rüber – die alle ein wenig älter waren als wir –, um sie uns mal anzuhören. Obwohl sie noch nicht viele Gigs gespielt hatten, wurde schnell klar, dass sie uns haushoch überlegen waren – besonders der Drummer.
Das brachte uns auf verschwörerische Gedanken. Barry war ein guter Typ, doch ein ziemlich durchschnittlicher Drummer. Das überraschte kaum, denn er war noch blutjung, so wie wir alle. John spielte als Schlagzeuger schon in einer anderen Klasse. Es war ein Unterschied, der augenblicklich auffiel. Wenn man kein guter Gitarrist oder Bassist ist, kann man das bis zu einem gewissen Grad irgendwie vertuschen, doch die Drums sind so wichtig in einer Band, dass man es entweder „hat“ oder nicht „hat“.
Ich muss gestehen, dass es aber auch noch einen anderen Grund gab, warum wir Barry nicht mehr bei uns haben wollten. Ich „traf“ seine Freundin. Soweit ich mich erinnere, kann man sie als „Anstifterin zur Tat“ bezeichnen. Sie war größer als ich und bekam immer das, was sie wollte. Ich behaupte nicht, dass sie mir eine Pistole an den Kopf hielt, doch als sie mir das erste Mal einen blies, verstand ich nicht so recht, warum sie ihren Kopf nach unten neigte. In Wahrheit wusste ich gar nicht, was sie vorhatte – etwa meinen Schwanz in den Mund nehmen? Gütiger Himmel! Was wird ihr wohl das nächste Mal einfallen?
Als der Gedanke aufkam, John für unsere Band zu „stehlen“, verriet ich den anderen nichts davon, doch man kann durchaus sagen, dass ich mich erleichtert fühlte. Dafür steht doch eine Band: selbstsüchtig bis auf die Knochen zu sein! Ich hätte zuerst eigentlich „junge Bands“ gesagt, doch in Wahrheit betrifft das Bands in jedem Alter. Man will immer besser in der Musik werden – und den Pimmel zur Schau stellen. Tut mir leid, Barry. Aber vielleicht hättest du auch so gehandelt.
Und so brachten wir John in die Band, und er trommelte fantastisch – sein Spiel ließ uns in eine andere Liga aufsteigen. Wir hießen nun The Spectres und begannen, zeitgleich mit Johns Einstieg alles sehr ernst zu nehmen. Drei Jahre älter als der Rest hatte John zuvor die Gesamtschule Kingsdale in Dunwich besucht und war nun angehender Pilot, was ihm einen Hauch von Autorität verlieh. Das traf natürlich nicht auf Alan Lancaster zu, der jeden herausforderte, egal wie alt – und fast immer gewann. Besonders wichtig für uns: John Coghlan war schon das, was man einen „richtigen Drummer“ nannte. Er hatte bei einem gewissen Lloyd Ryan Unterricht genommen, der nun wirklich ein „richtiger Drummer“ war und schon mit Matt Monro und Gene Vincent gespielt hatte. Ryan lässt sich als wunderbarer Mensch beschreiben, der in den Sechzigern mit allen nur erdenklichen Stars auftrat, darunter P. J. Proby, die New Seekers und Tony Christie. Und er wurde auch – interessanterweise, wenn auch ein wenig bizarr – der Manager und Sprecher des maskierten Wrestlers Kendo Nagasaki.
Als John zur ersten Probe kam, wussten alle, dass wir einen Gang höher schalteten. Er tauchte in einem Minicab auf. Diese Vehikel waren 1962 der letzte Schrei, und wir dachten, man hätte ihn chauffiert! Später, als John zur Band gehörte, gab er den Ratschlag seines Vaters preis: „Lass es protzig aussehen, mein Sohn.“
Glücklicherweise war John der unscheinbarste Typ, dem man begegnen konnte, und überhaupt kein Aufschneider. Für einen Drummer – die meist ziemlich verrückt sind – verhielt er sich recht ruhig. Abgesehen von den Episoden, in denen das nicht zutraf. Es gab Zeiten, da wurde er richtig sauer und explodierte förmlich. Um es mal so auszudrücken: John war kein Gemeinschaftstyp. Er machte alles mit sich selbst aus, sah sich nicht gezwungen, etwas vorzutäuschen, was nicht zutraf – und spielte einfach weiter auf seinen Drums. Aber die Hauptsache war, dass er gut Schlagzeug spielen konnte – und er wusste, dass er es konnte. Wir anderen versuchten, musikalisch gut zu sein – eines Tages. Und genau hier zeigte sich der Vorteil von Alan Lancasters verdammter Starrköpfigkeit.
In dieser Besetzung – meine Wenigkeit, Alan Lancaster, John Coghlan an den Drums und Jess Jaworski an der Orgel – begannen wir als die Spectres zu arbeiten. Alans Dad hatte uns ein Engagement im Samuel Jones Sports Club beschafft, was einen Aufritt pro Woche bedeutete. Mein Dad verfrachtete das Equipment hinten im Eiswagen und fuhr uns dorthin. Das war noch keine große Sache, denn bis auf die Familien und einige Freunde erschien dort kaum jemand. Allerdings drängte ich die Gruppe, so lange zu warten, bis Alans Mum aufgetaucht war, denn ihre Zustimmung bedeutete mir sehr viel. Einmal angefangen, spielten wir dann einige Coverversionen – Instrumentals sowie Songs aus den Charts – und machten nach einer halben Stunde Pause. Die Erfahrung zwang uns, professionell zu werden oder, besser gesagt, semi-professionell. Für einen Haufen Kids von der Schule war das verdammt hart, aber auch für John, der die Schule schon mit 15 verlassen hatte und mit uns klarkommen musste. Es wäre ein Leichtes gewesen, das ganze Projekt im Sande verlaufen zu lassen.
Das lief aber alles so weiter, bis nach Ende eines Gigs ein Typ auf uns zukam und die unsterblichen Worte murmelte: „Ich will euch managen.“ Für uns klang das wie: „Ich will Stars aus euch machen!“ Der Grund: Wir wussten nicht so recht, was ein Manager überhaupt so tat. Wir dachten, er gäbe uns Geld und würde uns ins Fernsehen bringen. Oder so was Ähnliches. Zuerst wussten wir nicht, was wir machen sollten, und antworten: „Da musst du Alans Mum fragen.“ Und so nahm ihn May unter die Lupe, entschied, dass er möglicherweise der Richtig wäre, und plötzlich hatten die Spectres einen Manager. Whoopee!
Er hieß Pat Barlow, und wie sich herausstellte, hatte er im Musikgeschäft null Erfahrung. Er arbeitete bislang als Gasinstallateur und hatte nun einen Ausstellungsraum für Zubehör. Barlow gehörte nicht zu den reichen Knackern, aber er war „flüssig“, wie man so schön sagt. Bislang hatte er schon einiges Geld gemacht und spielte nun mit dem Gedanken, „bei diesem Popmusik-Spielchen mitzumischen“. Warum auch nicht? Die Beatles freuten sich zu der Zeit über ihre ersten großen Hit-Singles. Die Rolling Stones hatten zwar noch keine Platte veröffentlicht – wie auch die Kinks oder The Who noch nicht –, doch plötzlich hatte man überall dieses Gefühl, und insbesondere in London, dass man etwas bewegen konnte, speziell, wenn man jung und „dabei“ war. Vielleicht haben alle Teenager das Gefühl, wenn sie nach ihrer Schulzeit die ersten eigenständigen Schritte machen?
Egal, Pat Barlow wollte die Spectres in die nächsten Shadows verwandeln oder sogar in die Beatles. Oder wenigsten einen Profit rausholen. Was am wichtigsten erschien: Pat schuftete für uns, woraufhin die Gigs kamen. Er mag zwar nichts vom Business verstanden haben, besaß aber das Talent, Leute zu beschwatzen, und gab niemals auf. Er hängte sich ans Telefon und ließ nicht mehr locker, bis er etwas für seine „Jungs“ angeleiert hatte.
Nun spielten wir in Locations wie dem El Partido in Lewisham, aus dem ein allseits bekannter Mod-Club wurde. Pat beschaffte uns auch ein regelmäßiges Montagabend-Engagement im Café des Artistes in Chelsea. Obwohl die meisten von uns noch zur Schule gingen, traten wir dort bis in die frühen Morgenstunden auf. Unsere Eltern wussten, dass Pat anwesend war, auf die Band aufpassen und uns auch wieder nach Hause fahren würde, was sie beruhigte. Einmal, als meine Haare ziemlich lang geworden waren – lang für die damalige Zeit, was bedeutete, dass sie über den Kragenrand des Hemdes reichten –, packte mich Pat am Nacken und schnitt mir mehr als zehn Zentimeter ab. Ich ließ die Tortur über mich ergehen, da ich noch ein Schuljunge war und er ein Erwachsener. Damals durften sogar die Nachbarn einem Kind „eins hinter die Ohren geben“, wenn sie dachten, es sei unartig. Die Eltern sagten gar nichts dazu.
Wir und auch unsere Familien vertrauten Pat – besonders, als die ersten Gagen flossen. Mum und Dad mögen nicht viel von unserer Musik verstanden haben, doch als die ersten Zahlungen eintrudelten, kapierten sie, was in dem Geschäft vor sich ging.
Über Nacht wurde unser Equipment besser. Ich war nun in der Lage, mir eine neue Guild-Halbakustik anzuschaffen. Alan verprasste seine Kohle für einen neuen Burns Bass. Und wir alle achteten nun auf anständige Kleidung – Klamotten hieß das damals! Zuerst bedeutete das, so wie die Beatles auszusehen, weshalb wir in den gleichen blauen Anzügen auftraten. In den frühen Sechzigern bis ungefähr zur Mitte des Jahrzehnts traten alle Popgruppen in einheitlicher Tracht auf. In Lambeth arbeitete ein Schneider, der uns die Outfits für zwölf Pfund das Stück anfertigte. Alan legte Wert auf einen besonderen Anzug, da er sich immer noch als Boss fühlte und sich optisch absetzen wollte – und somit musste er 25 Pfund blechen. Allerdings konnte man keinen Unterschied feststellen, wenn wir auf der Bühne standen, da alle Anzüge blau waren. Doch für Alan war sein Anzug ein bisschen besser, was ihn freute.
Auf unsere Art wurden wir damals alle ein wenig forscher und aufmüpfiger. Der nächste logische Schritt bestand in der Veröffentlichung einer Platte, doch niemand wusste, wie man so ein Wunder bewirkt. Sogar Pat gelang es nicht, den Managern der Plattenfirmen genügend Honig um den Bart zu schmieren, damit sie sich in den tiefen Londoner Süden stürzten, um uns spielen zu sehen. Das lief so monatelang, bis Pat die kluge Idee hatte, uns einen gemeinsamen Auftritt mit einer der Band zu besorgen, die die Meute der Platten-Scouts nicht ignorieren konnte. Wieder einmal galt: leichter gesagt als getan.
Irgendwann Ende 1964 entdeckte Pat eine Anzeige für die Hollies, die in der Orpington Civic Hall in Kent auftreten sollten. Daraufhin wollte er sein Glück versuchen und uns der populären Gruppe als Vorband aufschwatzen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie Pat es gemacht hat, doch irgendwie gelang es ihm. Als wir in Orpington auf die Bühne gingen – zu Beginn des Jahres 1965 –, waren wir fest davon überzeugt, dass das unser großer Durchbruch würde. Dass der ganze Saal nur so von Impressarios des Musikbusiness wimmle, die dafür sterben würden, diese neue, heiße Gruppe unter Vertrag zu nehmen, von der sie schon so viel gehört hatten.
Natürlich träumten wir davon. Ich habe keine Ahnung, ob an dem Abend überhaupt jemand aus dem Musikgeschäft zu den Besuchern zählte, betete jedoch dafür, dass dem nicht so wäre. Wir spielten schrecklich! Unsere Nervenkostüme waren so zerrüttet, dass wir kaum gerade stehen konnten, mal ganz abgesehen vom Spielen und Singen. Das Ganze fühlte sich wie ein enormer Rückschlag an, und ich dachte: Jetzt haben wir es richtig vermasselt. Doch ich war erst 15, ein Alter, in dem man noch viele Chancen hat und nicht schon vor dem Aus steht. Hinsichtlich eines Rückschlags würde ich dann später noch „erfolgreicher“ sein, nachdem wir berühmt geworden waren …
Unser großer Durchbruch – nicht, dass wir das damals jedoch so sahen – kam dann, als Pat sich selbst übertraf und uns ein Vorspiel für den Job einer ganzen Sommersaison in Butlin’s Holiday Camp in Minehead, Somerset, besorgte. Das stellte eine wirklich aufregende Aussicht dar! Ein halbes Jahrhundert später ist Butlin’s immer noch ein preisgünstiges Ferienziel für Familien mit kleinen Kindern und Senioren. Schon 1965 wurde es als Großbritanniens Antwort auf Las Vegas gesehen. Bis Butlin’s eröffnete, bestand der typische Urlaub für eine Familie aus der Arbeiterklasse aus einer Woche in einem Bed and Breakfast am Meer, für gewöhnlich einem Haus mit einigen leerstehenden Zimmern, aus dem man den ganzen Tag ausgesperrt war. Als Butlin’s seine Angebote offerierte, durfte sich Großbritannien tatsächlich über „Resorts“ freuen. Nun hatten wir Freizeiteinrichtungen, in denen die Kids den ganzen Tag auf dem Rummel spielten und die Erwachsenen sich am Abend einen Drink genehmigten und die Füße hochlegten. Für Teenager bot Butlin’s die bisher unbekannten Freuden, manchmal monatelang weit weg von zuhause zu leben. Man wurde mit allen Mahlzeiten versorgt und jagte so vielen Mädchen nach, wie man finden konnte. Und da musste man natürlich nicht lange Ausschau halten.
Als wir dort die ersten Abende als The Spectres spielten, dachte ich, ich wäre tot und im Himmel. Die Anlage von Butlin’s in Minehead hatte erst wenige Jahre zuvor eröffnet und war somit die neuste und glamouröseste dieser Einrichtungen im Land. Der Tag der Ankunft stellte sich für uns als nahezu monumental dar. Es war mein 16. Geburtstag – und wer hielt sich in dem Moment wohl am Empfang auf? Rick Parfitt, der Bursche, der mein lebenslanger musikalischer Partner werden sollte, und meine zukünftige Frau Jean Smith! Natürlich kannte ich die beiden zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.
Als Teil der „Abendunterhaltung“ wurden wir natürlich mit großer Aufmerksamkeit bedacht. Es war mein erster Sommer, nachdem ich die Schule verlassen hatte, und somit war das eine Art Initiationsprozess. Das mag jetzt ein wenig prätentiös klingen, doch ich kann nicht stark genug betonen, welch ein großer und bedeutender Schritt das Engagement bei Butlin’s für uns war.
Kurz nach der Schulentlassung entschied Jess Jaworski, dass er genug von nächtlicher Arbeit und unsicherem Einkommen hatte, und ging wieder zurück an die Penne, um das Abitur nachzuholen. Für aufstrebende junge Musiker ist das eine Art weiterer „Jetzt-oder-nie“-Moment. Man kann nur eine bestimmte Zeit für seine Träume leben. Hat man es nach einer gewissen Zeit noch nicht gepackt, ist es nur vernünftig, das Handtuch zu werfen und sich nach einem normalen Job umzusehen.
Das Butlin’s-Engagement stand für einen Wendepunkt in der Karriere der Band, was Jess richtig erkannte. Für ihn war es an der Zeit, sich Gedanken über eine mögliche Ausbildung zu machen, die Universität oder handfeste Jobs mit sicherer Bezahlung. Bei einigen ehrgeizigen Musikern fällt der Entschluss zum Aufgeben erst im Alter von 30 oder 35 Jahren. Einige geben den Traum auch niemals auf und suchen sich Jobs, die ihnen genügend Zeit für Auftritte am Wochenende lassen, oder was auch sonst immer nötig ist. Jess ersparte sich – und uns auch – eine Menge unnötiger Unannehmlichkeiten, indem er seine Entscheidung schon so früh fällte, was sicherlich auch für ihn positiv war.
Pat gelang es, mit dem Organisten Roy Lynes einen Ersatzmann aufzutreiben. Roy verhielt sich noch lässiger als Alan Key und war älter als John Coghlan. Als er mit 22 Jahren zur Band stieß, waren Alan Lancaster und ich gerade erst 16. In dem Alter ist das eine große Kluft, doch was für ein liebenswerter Bursche er war – und zugleich was für ein großartiger Keyboarder. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er in einem Vollzeitjob als Inspekteur in einer Fabrik für Autoersatzteile gearbeitet. Er besaß eigenes Equipment, konnte erstklassig spielen, fügte sich optimal ein und tauchte rechtzeitig zum Engagement bei Butlin’s auf. Wir witzelten immer, dass Roys Orgelspiel die ganzen Fehler überdecke, die Alan und ich auf unseren Instrumenten machten.
Nachdem wir erst mal erkannt hatten, in was für einer Tretmühle wir steckten, ließ die Begeisterung über die neue Erfahrung allerdings nach. Man hatte der Band den Nachmittagsauftritt überlassen, wo man von uns erwartete, die Besucher bis zu drei Stunden zu unterhalten. Am selben Abend folgte eine Wiederholung des Sets, an dessen Ende wir kaum mehr Energie hatten, um ins Bett zu kriechen, mal ganz davon abgesehen, scharfe Puppen zu jagen, wie man sie damals charmanterweise nannte. Wir spielten bei jedem Set 50 Songs – zwei Mal am Tag, sechs Tage die Woche. In der dritten Wochen hatten wir uns in Zombies verwandelt und performten praktisch im Schlaf. Ich verdrückte zum Frühstück regelmäßig ganze Pakete von Halspastillen, da meine Stimme so rau geworden war. Doch in dieser Zeit wurden wir zu abgebrühten Profis. Bei so einer Arbeitsbelastung gibt man entweder schnell auf und geht nach Hause oder lässt sich darauf ein und meistert die Herausforderung. Tja, und wir wollten uns auf gar keinen Fall verziehen. Letztendlich wurden wir als Individuen stärker und bildeten zugleich eine zusammengeschweißte musikalische Einheit. Bei der Rückkehr nach London – am Ende der Sommersaison – hatten wir uns grundlegend verändert. Niemals wieder würde uns ein Gig einschüchtern! Wir waren zwar immer noch „Jungs“, aber Jungs, die auf sich selbst aufpassen konnten. Profis! Wir lebten das, atmeten es tief ein. Wir waren abgebrüht, abgehärtet und keine Jungfrauen mehr. In allen Belangen!
Damals lernte ich auch, wie man mit dem Publikum kommuniziert, egal, ob es sich nun freundlich oder feindselig gab – und bei Butlin’s kam das manchmal gleichzeitig vor. Man hatte uns im Rahmen der Promotion für den Pig & Whistle gebucht, der so war, wie er klang – ein Pub. Allerdings ein ziemlich abgewrackter und mieser Pub. Dort fanden problemlos 1.200 Gäste Platz, doch sie saßen alle an Tischen oder auf Hockern. Vor der Bühne war zum Tanzen kaum Platz. Die Leute flegelten sich also an ihre Tische und tranken – und tranken und tranken. Und dann rückten sie uns auf die Pelle und torkelten, ähm tanzten.
Ganz in der Nähe lag ein weiterer Veranstaltungsort, der Rock and Roll Ballroom. Wir verstanden zuerst nicht, warum man die Band für den Laden buchte. Letztendlich überredeten sie uns aber, und wir sahen das als eine willkommene Abwechslung an – bis zum ersten Auftritt, denn kaum jemand tauchte dort auf. Die Leute waren alle im Pig & Whistle, wo sie sich volllaufen ließen, und wir sahen bei einigen unserer Sets lediglich 20 Zuschauer. In der letzten halben Stunde – Pig & Whistle hatte nun geschlossen – strömten dann jedoch wahre Menschenmengen in den Laden!
Im Ballroom gelang es uns endlich, eine kleine Fangemeinde aufzubauen. Auch lernten wir, das Programm nicht überambitioniert zu gestalten. Wir erschienen dort mit der Einstellung, die aufregende neue Band zu sein, total angesagt aufgrund unserer modernen Ideen, wobei wir einen Mix aus eigenen Songs und Coverversionen präsentierten. Wir spielten anfangs aber keine naheliegenden Songs oder Stücke aus den Charts. Mein lieber Freund, das änderte sich allerdings schnell. Bei den ersten Shows versorgten wir das Publikum mit einer wirklich coolen Auswahl von Hits der Everly Brothers, Chuck Berry, einigen frühen Elvis-Titeln und ein paar eigenen Nummern – und starben einen schmerzhaften Tod. Die Leute brüllten Songwünsche oder gingen sofort.
Den Hinweis, wie wir die Besucher beglücken konnten, lieferte Roy, als er den Leadgesang bei einer wirklich schmalzig-süßlichen Fassung von Elvis’ „I Can’t Help Falling In Love“ übernahm, die er wie ein Pub-Sänger brachte, der sich am King versuchte. Das löste einen regelrechten Begeisterungstaumel aus. Die Zuschauer standen am Ende auf und applaudierten frenetisch. Nun lernten wir eine weitere bedeutende Lektion: Es war vollkommen egal, welche Songs wir mochten, es zählte nur, welche Songs das Publikum mochte. Das war eine immer gültige Regel, die sogar noch nach der Veröffentlichung der ersten Platten und den ersten Hits Bestand hatte. Auf Alben darf man problemlos seine „künstlerischen Visionen“ verwirklichen, doch Gnade dir Gott, wenn du die Hits nicht live spielst.
Diese Regel gilt besonders, wenn man vor einem zahlenden Publikum auftritt, denn eben dieses hält das Zepter in der Hand und nicht du. Wir lernten die harten Fakten bei Butlin’s und vergaßen sie nie. Man beobachtete das auch bei den anderen Bands, wie sie sich anpassten und das spielten, was den Massen gefiel. Eine Band, die Olympic Five, arbeiteten sich durch ihr Set, bis sie zu dem Song mit dem Titel „The Hucklebuck“ kamen, diese Chubby-Checker-Nummer, ein Nachfolger des populären Hits „The Twist“, die aber nie in Großbritannien erschien. Die Band hatte eine optimale Fassung des Titels ausgearbeitet, die großartig ankam. Je betrunkener die Menge wurde, desto frenetischer reagierte sie. Wenn die Gruppe mit „The Hucklebuck“ startete, rastete der ganze Laden aus.
Wir schauten uns das an und dachten – okay, das haben wir kapiert! Nun wussten wir, was man machen musste. Allerdings hatten wir noch nicht die richtigen Songs. Nach unseren Erfahrungen bei Butlin’s konnten wir aber mit zwei wichtigen Aspekten auftrumpfen – wir waren eine dynamischere Live-Band und besaßen größere Professionalität. Auch hatten wir – obwohl das noch niemand von uns wusste – ein neues Bandmitglied in unseren Reihen. Sein Name lautete Ricky Harrison, und als ich ihm das erste Mal begegnete, war ich überzeugt, dass er schwul ist, obwohl wir das Wort damals nicht benutzten. Volles blondes Haar, knallenge Hosen und ein Grinsen bis über beide Ohren. Überaus freundlich. Und das genau machte mich stutzig, denn ich war es nicht gewohnt, wenn sich andere Jungs so nett verhielten. Ich kannte nur Muskelprotze und harte Kerle. Und dieser Ricky Harrison glich ihnen in keiner Weise.
Wie sich herausstellte, spielte er in dem Jahr mit einer anderen Band bei Butlin’s – einem kleinen Kabarett-Trio namens The Highlights, das aus Ricky und zwei Mädchen bestand – Zwillingen mit den Namen Jean und Gloria Harrison. Die Mädels hatten dunkle Haare, und Ricky war blond, was im Kontrast ihr Image ausmachte. Sie begannen ihre Show mit „Whole Lotta Shakin’ Going On’“ und einigen anderen gefälligen, Publikums-tauglichen Nummern, wonach die Mädels sich zu einem Kostümwechsel zurückzogen und Ricky „Baby Face“ sang. Kitschig bis zum Abwinken, doch das Publikum liebte es.
Sie waren für das Gaiety Theatre gebucht, das im Gegensatz zu unserem Schuppen hauptsächlich von Omis und Kids besucht wurde. Man sollte den Eindruck haben, dass Ricky der Bruder der beiden Mädels war, was wir auch glaubten, bis er uns erklärte, dass dies alles Teil des Konzepts sei. Er verriet uns seinen richtigen Namen, Richard Parfitt, und dass er das Parfitt seit jeher nicht möge, weshalb sich Harrison angeboten habe. Natürlich muss man nicht erwähnen, dass er sich ganz und gar nicht wie ein Bruder verhielt und mit beiden zu bestimmten Zeiten Affären hatte. Diese spezielle Art des Beziehungs-Wirrwarrs sollte sich – wie wir, und besonders ich, schon bald herausfanden – wie ein roter Faden durch Ricks ganzes Leben ziehen.
Rick war während eines Gigs am Nachtmittag auf uns zugekommen und hatte sich vorgestellt. Als er sah, was wir machten, stellte sich ziemlich schnell heraus, dass er lieber in einer Popband spielen wollte, da es besser zu ihm passte, als mit zwei Mädels zu trällern. Er war ein großer Cliff-Richard-Fan und sah sich in seinen Träumen als frühen Cliff, einen ungezogenen, aber liebenswürdigen Rock’n’Roll-Sänger. Ich mochte ihn auf den ersten Blick, obwohl ich annahm, er sei eine Tunte, ein Begriff, den wir damals benutzten. Als er mich über seine sexuelle Orientierung aufklärte, konnte ich es kaum fassen.
Rick freundete sich schnell mit mir und Alan an. Da Roy so viel älter war und John ein unbeschriebenes Blatt, wie man so sagt, fand ich es toll, einen gleichaltrigen Freund an meiner Seite zu wissen, mit dem man sich herumtreiben und Spaß haben konnte. Rick wurde sieben Monate vor mir geboren, im Sternzeichen Waage – eins der Zeichen, mit dem Zwillinge wie ich gut harmonieren. Er stammte aus Woking, Surrey, das im Grunde genommen tief im Südwesten Londons liegt, nahe genug an der Gegend, aus der Alan und ich kamen, womit er beinahe einer von uns war.
Rick war einfach nett und locker, ein Mensch, den man gerne in seiner Nähe weiß. Im Gegensatz zu mir plagten ihn weder Ängstlichkeit noch Unsicherheit. Ihm fiel scheinbar alles zu. Zumindest hatte man den Eindruck. Rick war Einzelkind, der wie die meisten alleine aufwachsenden Kids mit Liebe und Zuneigung überschüttet worden war – jedoch nicht so verzogen, dass er meinte, er sei unschlagbar. Rick sah immer die positiven Seiten. Er gab niemals auf, war einer der Menschen, die immer positiv denken („Warum sollte ich mir Sorge machen?“), einer derjenigen, die mit strahlendem Lächeln im Gesicht herumlaufen, von denen man gemocht werden will. Schon allein aus dem Grund wurden wir schnell Freunde, aber auch, weil er mir so wenig ähnelte, für mich eher ein Vorbild darstellte. Erst viel später erfuhr ich, dass Rick tatsächlich so wie ich werden wollte, aber dazu kommen wir noch.
Rick bewies mir seine Freundschaft, als man mich aus der Unterkunft warf, in der wir wohnten. Ich hatte dort mit einem Mädchen geschlafen, und sie erwischten mich dabei. Es war das Mädchen, das ich bald heiraten sollte. Sie hieß Jean Smith und arbeitete mit ihrer Schwester Pat im Butlin’s. Ich weiß, dass es unglaublich schmalzig klingt, aber als ich sie das erste Mal ins Visier nahm, schwor ich mir: „Ich werde sie heiraten.“ Ich wusste es einfach.
Ich werde niemals den Morgen vergessen, an dem man mich rausschmiss, denn es war der Tag, an dem Jean und ich zum ersten Mal Sex miteinander hatten. Sie war noch Jungfrau – wie damals alle „braven Mädchen“ vor der Hochzeit, ha, verdammt noch mal, ha, ha, ha –, und ich hatte meine Probleme, ihr meinen Pimmel reinzustecken. Wir versuchten es zwei oder drei Tage hintereinander, bis mir endlich die große Tat gelang. Als es endlich funktionierte, war es mehr Erleichterung als alles andere. Ich zweifle stark daran, dass einer von uns Spaß dabei hatte. Wir machten uns jedenfalls an jenem Morgen gerade wieder ans „Spiel“, als die Hauswirtin – eine fiese, fette Schottin – reinplatzte und mich wortwörtlich von Jean herunterriss.
Zuerst warf sie Jean raus – „Du verdorbene Schlampe“ – und dann mich. Ich musste mich dann damit abfinden, allein am Strand zu nächtigen, bis mir Rick zu Hilfe eilte, indem er Jean sein Zimmer überließ und anbot, sich am Strand zu mir zu gesellen. Wir schliefen die nächsten Nächte unter einigen alten Liegestühlen, die wir zu einer Art Hütte zusammenstellten. In anderen Nächten hockten wir uns in Telefonzellen oder schliefen in öffentlichen Toiletten.
In dieser Zeit näherten wir uns freundschaftlich an, während mein ehemals gutes Verhältnis zu Alan einer Achterbahnfahrt glich. Wir fetzten uns ständig. Wenn Rick die Streitereien erlebte, fühlte er sich höchst unwohl. Eines Tages kamen wir gerade von der Bühne und schlugen uns beinahe die Köpfe ein. Ich habe Gewalt immer gehasst, habe danach immer geweint. Ich glaube aber, dass Rick durch den Zwischenfall noch mehr aus der Bahn geworfen wurde als Alan oder ich. Als Nächstes verzog sich Alan mit einer der Zwillingsschwestern, aber ich kann mich nicht genau erinnern, mit welcher er schlief. Sie ähnelten sich so sehr! Rick stand in dem Moment neben sich selbst, denn er war total in Jean verknallt (der von seiner Band, nicht in meine Jean). Obwohl ich vermute, dass Alan sich Gloria schnappte, stieg der Zwischenfall Rick zu Kopf. Davon abgesehen, verstanden sich Rick und Alan verdammt gut. Sie waren im selben Alter, teilten ähnliche Interessen und standen beide auf Mode – Alan mit seinen aufgemotzten Anzügen und Rick mit den knallengen Hosen.
Als sich die Saison ihrem Ende näherte und wir uns auf die Rückkehr nach Hause vorbereiteten, sah man Rick seine Traurigkeit an. Er war schon zu einem Teil unserer verschworenen Gemeinschaft, unserer Gang geworden. Dennoch erzählte er mir erst später von seiner Absicht, einzusteigen. Ich hingegen nahm an, dass Rick weitermachen und der nächste Des O’Connor werden wollte. Doch glücklicherweise blieben wir in Kontakt, hauptsächlich durch Alan. Rick tauchte gelegentlich auf und übernachtete in der Wohnung von Alans Eltern. Manchmal besuchte er uns auch bei Konzerten.
Ungefähr zu der Zeit nahmen wir endlich eine Platte auf. Pat Barlow war es irgendwie gelungen, einen Deal mit Piccadilly Records anzuleiern, einem Ableger von Pye, dessen populärster Act Joe Brown and the Bruvvers war.
Wir hatten einige Nummern aufgenommen – sie locker-flockig in einem winzigen und nur für einen Nachmittag gebuchten Studio in Soho eingespielt –, und Pat schickte Kopien des Tonbands zu verschiedenen Plattenfirmen und Musikverlagen. Das Resultat: absolut keine Resonanz, bis sich aus heiterem Himmel ein Typ namens Ronnie Scott meldete – der Vorstand des Musikverlags Valley Music und nicht zu verwechseln mit dem berühmten britischen Jazz-Musiker, der später den gleichnamigen Club in Soho eröffnete. Er sagte Pat, dass er das Demo gehört habe, dass es Potenzial erkennen lasse und wir ihn aufsuchten sollten, um einen Vertrag zu diskutieren. Daraus resultierte die Einladung, Aufnahmen mit John Schroeder zu machen, dem Hausproduzenten von Pye.
John ließ sich als „alter, erfahrener Kopf auf jungen Schultern“ beschreiben. Er wurde schon mit 26 Jahren mit dem Ivor Novello Award für seine Co-Autorenschaft bei „Walkin’ Back To Happiness“ ausgezeichnet, einer Nummer für Helen Shapiro. Daneben leitete er das John Schroeder Orchestra, das einige Easy-Listening-Hits hatte und Themen für Serien wie Auf der Flucht produzierte. Er war ein liebenswerter Mann und machte den Musikern immer Mut. John erklärte Pat: „The Spectres sind so weit von Glanz und Glorie entfernt!“, wonach er mit den Fingern schnippte. Wir liebten ihn regelrecht.
Trotzdem war die erste Single mit John eine Coverversion von „I (Who Have Nothing)“ – bitte kein Gelächter auf den billigen Plätzen –, womit Shirley Bassey 1963 einen großen Hit gehabt hatte. Abgesehen von der Tatsache, dass er auf dem italienischen Stück „Uno Dei Tanti“ basierte, hatte ich überhaupt keine Affinität zu dem Song. Die Verantwortlichen bei Piccadilly hielten es jedoch für eine gute Idee, und wer waren wir schon, um uns mit einem bewährten Hit-Produzenten wie John anzulegen? Außerdem stand Alan auf den Song. Ich glaube, er schlug ihn sogar vor. Als brave Jungs spielten wir ihn also ein. Sie können sich das Stück heute auf YouTube anhören, doch ich würde es als großen persönlichen Gefallen wertschätzen, wenn Sie es lassen! Letztendlich brachte beinahe jeder eine Coverversion des Titels heraus – von Joe Cocker über Petula Clark bis hin zu Liza Minelli, Katherine Jenkins und Donny Osmond –, doch ich kann Ihnen versichern, dass unsere die schlechteste ist. Lasst uns nie wieder darüber reden.
Rick dachte dennoch, das sei die wohl fantastischste Aktion, die jemals realisiert worden war. Als er die Platte das erste Mal in Händen hielt, begann er sogar zu zittern. Damals hatten sich die Highlights aufgelöst, und wir alle wussten, dass er sich nach einer neuen Band umschaute. Er schuftete als Fahrer eines Brotlieferwagens und tat mir wirklich leid, da ich wusste, wie knapp ich dem Schicksal eines Eiswagenfahrers entronnen war. Doch damals mussten wir aus finanziellen Gründen alle verschiedenen Teilzeitjobs nachgehen. Alan verdingte sich als Fensterputzer, und ich arbeitete zeitweise als Gärtner für die Londoner Stadtverwaltung und half beim lokalen Optiker aus.
Dann hatte Pat Barlow eine weitere seiner zündenden Ideen. Ein besonders schlauer Kerl von Piccadilly hatte ihm den Vorschlag unter die Nase gerieben: Warum nahmen wir nicht Rick in die Band auf? Wir brauchten doch sicherlich eine zusätzliche Stimme und einen Gitarristen. Tatsächlich wollte er mich als Frontmann ablösen, doch das wurde mir erst einige Zeit später klar. Er suchte einen Musiker mit einer besseren Stimme, einen „richtigen“ Sänger.
Wie üblich, machten wir kommentarlos mit. Davon abgesehen, war Rick ein wahrer Freund. Hätte das bedeutet, Fremde zum Vorsingen einzuladen, hätten wir möglicherweise abgelehnt. Doch es war nun mal Rick – mit seinen blonden Haaren und diesen knallengen Hosen. Und er konnte singen. Auch die anderen empfanden das als gute Idee, sogar Alan, was mich verblüffte, denn meist hinterfragte er jede Entscheidung, ob wichtig oder nicht. Später erfuhr ich, dass Pat ihn auf raffinierte Weise überredet hatte, bevor er mit der restlichen Band sprach.
Und so baten wir Pat also, Rick anzurufen und zu fragen. Ich glaube, er willigte ein, noch bevor Pat seine Frage beendet hatte. Am nächsten Tag erschien er in unserem neuen Probedomizil, das im Keller von Pats Ausstellungsraum am Lambeth Walk lag. Er setzte sich hin, schob den Klinkenstecker in den Verstärker – und heraus kam ein schrecklicher Krach. Bis zu dem Moment hatte noch niemand bemerkt, dass Rick nicht besonders gut Gitarre spielte. Vor unserem geistigen Auge sahen wir ihn immer nur „Baby Face“ schrubben.
Nachdem er gegangen war, wollten die anderen ihn unbedingt wieder loswerden, doch ich bestand darauf, dass er blieb. Ich spürte, dass er etwas hatte – und natürlich gut sang –, und glaubte fest daran, dass er auf der Gitarre nur noch besser werden konnte. Murrend stimmten die anderen zu. Beim ersten Gig stöpselten wir seine Gitarre jedoch insgeheim aus. Doch das war das einzige Mal, dass wir zu so einer Notlösung griffen. Rick sah den Einstieg in die Band als seine große Chance und zeigte sich zum zügigen Üben fest entschlossen. Und das tat er auch.