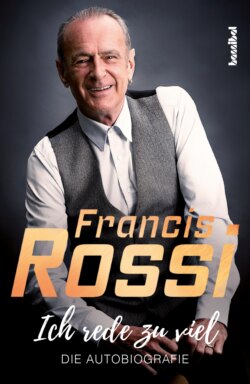Читать книгу Ich rede zu viel - Francis Rossi - Страница 8
ОглавлениеRick Parfitt – wie man ihn nun nannte – in der Band zu haben, verlief nicht nach den Vorstellungen von Pat Barlow und den anderen. Ich glaube, sie erhofften sich einen neuen Frontmann, der singen und Gitarre spielen konnte. Stattdessen entwickelten Rick und ich von Anfang an eine Art harmonisierendes „Frontmann-Duo“, dass ich mir seit den Tagen wünschte, als ich meinen Bruder für eine Band im Stil der Everly Brothers gewinnen wollte. Als Rick zu uns stieß, waren die Beatles das größte Ding überhaupt, und sie hatten mit John Lennon und Paul McCartney ein ähnliches Line-up. Das glich auch Mike Pender und Tony Jackson von den Searchers und vielen anderen Bands der Ära wie den Merseybeats.
Es gab noch einen zusätzlichen Punkt, der sich durch Ricks Einstieg bei der Gruppe verbesserte, zumindest meiner Auffassung nach. Welchen? Ich mochte ihn! Roy war für mich viel zu alt, um mit ihm auf einer gleichberechtigten Ebene zu stehen. John war eher verschlossen – bis er nicht mehr verschlossen war und durch die Decke ging. Und Alan gab sich viel zu dominant, weshalb ich mich nie richtig entspannen konnte.
Rick und ich hatten dasselbe Alter, und er verhielt sich immer sehr angenehm. Er war einfach nur nett – eine wahrhaft sanfte Seele mit einem großartigen Sinn für Humor. Bei ihm fühlte ich etwas, das ich bei den anderen Bandmitgliedern nicht erlebte. Wenn ich als Teenager die Schnauze voll hatte oder genervt war, begann ich schnell zu weinen. Alan schäumte dann vor Wut: „Hör sofort damit auf! Das ist doch peinlich“ Doch Rick ging auf mich zu, umarmte mich kurz und versuchte, mich zu trösten. Er war immer ein richtiger „Umarmer“.
Beim ersten gemeinsamen Gig lieh ich ihm einige meiner Klamotten, denn er hatte keinen „trendigen“ Bühnendress – sagte er zumindest. Natürlich besaß er einige schicke Outfits, doch er wollte sichergehen, stilistisch zu uns zu passen.
Man kann uns tatsächlich als Brüder bezeichnen. Bei den frühen Tourneen schliefen wir manchmal sogar in einem Bett. Aber nicht wie Bowie oder Elton – wie ich unterstreichen möchte. Eher wie Morecombe and Wise in den Sketchen, wo sie zusammen in einem Bett liegen und sich zanken und auf den Arm nehmen. Damals mussten sich junge Männer häufig ein Bett teilen. Waren es Einzelbetten schoben wir sie immer zusammen. Das war alles okay, bis auf den Fall, wenn einer von uns eine Mieze anschleppte. Oftmals lag Rick mit irgendeinem Mädchen im Bett neben mir, und ich musste mir anhören, was da vor sich ging. Einmal stritt er sich mit einem Mädel, und sie stand auf und fluchte: „Ich muss pissen!“ Ich erinnere mich noch an den Kommentar, den ich in Gedanken anbrachte: „Die Frau hat Klasse!“ Dann kam sie zurück und giftete: „Ich hab das Gefühl, dass ich heute noch einen erdolchen muss!“ In der Nacht machte ich kein Auge mehr zu. Rick auch nicht.
Da damals anscheinend jeder glaubte, Rick sei schwul – oder eine Tunte, wie man sagte –, machten wir uns manchmal einen Spaß daraus und hielten in der Öffentlichkeit Händchen.
Das brachte Alan und John – die buchstäblichen Macho-Typen – auf die Palme. Besonders Alan ärgerte sich, denn ich glaube ernsthaft, dass er so seine Zweifel hegte. Um den Kontext herzustellen und das Verständnis solcher Vorurteile zu erleichtern, muss man darauf hinweisen, dass Homosexualität in Großbritannien bis 1967 illegal war. Gab man sich öffentlich „homo“, musste man sich auf jeden nur erdenklichen Ärger einstellen. Das begann mit der Ahndung des Gesetzesverstoßes und endete – war man nicht vorsichtig – mit Alan, der zu brüllen anfing.
Die Live-Szene hatte sich über den Sommer unseres Gastspiels hinweg verändert, und die Art von Beatband mit ausgeflippten Sachen, für die die Spectres standen, war aus der Mode gekommen. Wir hatten schon eine zweite Single mit dem Titel „Hurdy Gurdy Man“ auf den Markt gebracht. Nein, nicht den superben Donovan-Hit, der ein Jahr später erschien, sondern ein kleines Liedchen, das Alan angeschleppt hatte. Es war schmissig und poppig und ein totaler Reinfall. Es gab auch noch die dritte Single „(We Ain’t Got) Nothing Yet“, das Cover eines Songs der Blues Magoos, früher im Jahr ein Hit in den USA. Ich glaubte, mit der Nummer eine Chance zu haben, da wir das Original beinahe Note für Note kopierten. Das Stück klang packend und vereinnahmend. Aber nein, auch diese Single starb ihren frühzeitigen Tod.
Es war der Beginn der Mod-Ära und neuer Londoner Formationen wie der Small Faces, der Kinks und von The Who. Plötzlich konnte Pat kaum mehr Gigs für die Spectres buchen, und deshalb nannten wir uns Traffic – bis man wenige Monate später bekanntgab, dass Steve Winwood die Spencer Davis Group verlassen habe, um eine neue Gruppe ins Leben zu rufen – mit dem schönen Namen Traffic. Es schien einfach nicht fair zu sein, dass er das so einfach machen konnte, da wir eindeutig die ersten mit dem Namen gewesen waren. Doch er hieß nun mal Steve Winwood, hatte mit Singles wie „Keep On Running“ und „Gimme Some Lovin’“ Hits gehabt, und ich mähte immer noch Grünanlagen. Somit änderten wir den Namen in Traffic Jam – jetzt haben wir es dir aber gegeben, du „Idiot“! Die biederen Anzüge und die schmalen Krawatten gehörten nun auch der Vergangenheit an, und wir „experimentierten“ mit bemusterten Hemden mit offenen Kragen. Verrückt!
Pat, der Dank gebührt ihm, versuchte sein Möglichstes, um die Show am Laufen zu halten. Mit dem Namen Traffic Jam sicherte er uns mehr Gigs und brachte die Band sogar in den Saturday Club von Radio 1, die beliebte Samstagmorgensendung mit Brian Matthew. Wir ergatterten auch einige Auftritte als Begleitmusiker für amerikanische Künstler wie P. J. Proby, damals weniger berühmt für seine Gesangskünste, sondern eher dafür, dass er die Hosennaht bei fast jedem Konzert im Schritt platzen ließ! Die Band arbeitete auch für eine weibliche Gesangsformation mit dem Namen Dixie Cups, die mit „Chapel Of Love“ und „Iko Iko“ zwei bekannte Hits hatte – großartige Mädels. Ich erinnere mich speziell an ihren Gitarristen, einen sehr coolen schwarzen Typen und zugleich die erste Person, die mich auf die große Rolle aufmerksam machte, die Marihuana und Amphetamine im Leben vieler Musiker spielten.
Bis dahin waren wir jeglichen Drogen immer aus dem Weg gegangen. Wir wussten von „Uppers“, wie man sie nannte, und hatten auch schon von „Kiffern“ gehört. Doch wie bei den meisten Teenagern Mitte der Sechziger beschränkte sich das Wissen darauf, dass Drogen „schlecht“ sind und einen dazu bringen, von einem Dach zu springen. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis wir tatsächlich da drin steckten.
Der Wendepunkt kam während einer Tour mit den Small Faces. Sie rauchten Joints so oft wie Zigaretten, warfen täglich Speed und standen total auf psychedelische Drogen, obwohl mir persönlich die ganze Sache mit LSD nie gefiel und ich mich davon fernhielt. Stattdessen brachte Steve Marriott, der brillante Sänger und Gitarrist der Band, Rick und mich dazu, dass wir vor jedem Gig mit ihm eine halbe Flasche Brandy kippten. Und nach dem Gig drehte ein Joint die Runde. Bis zu dem Zeitpunkt war John Coghlan der Einzige, der sich einige Bier genehmigte, während der Rest immer noch Tizer trank, eine Limonade.
Ich hatte einen Wahnsinnsspaß, mit den Kerlen zu touren. Stevie, seine Jungs und ich teilten denselben Geschmack für Klamotten. Aufgrund des in den Siebzigern auftauchenden Quo-Images – Jeans und Jeanswesten, lange Haare – wissen die Leute nicht, was für ein Modefreak ich bin. Als wir die ersten Platten in den Sixties einspielten, war ich verrückt nach Kleidung. Die richtigen Schuhe, die passenden Hemden und die besten Jacketts. Man befand sich zum Beispiel in einer Modeboutique in der Carnaby Street und rannte Rod Stewart oder Steve Marriott über den Weg, woraufhin ein Wettstreit entbrannte, wer am schnellsten die besten Klamotten in der Hand hielt. Bis zum heutigen Tag kleide ich mich immer schick, sogar wenn ich nur zuhause bin und entspanne. Man kann mich keinesfalls als Trainingshosen-und-Turnschuh-Typen beschreiben. Ich mag anständige Hemden mit zugeknöpftem oberen Knopf und blitzblank geputzte Schuhe. Auch bei anderen Leuten missfällt mir Schlampigkeit. Sie dürfen mich ruhig als oberflächlich einordnen, aber ich glaube fest daran, dass „Kleider Leute machen“.
1967 ereignete sich noch ein weiterer Wandel in meinem Leben, denn ich heiratete meine „Butlin’s-Herzallerliebste“ Jean Smith. Auch sie war ein Mod – und ich vom ersten Augenblick an wie besessen von dem Mädchen. Zurückblickend erkenne ich aber auch, dass es eine Art On-Off-Beziehung war, was den Reiz erhöhte. Hat man das erreicht, was man sich am intensivsten auf der Welt wünschte, versucht man danach, noch mehr zu bekommen, besonders wenn es sich um Angelegenheiten des Herzens dreht.
Und so lief es ab: Nachdem die Vermieterin uns zusammen im Bett erwischt hatte und ich rausgeworfen worden war, verdrückte sich Jean einfach. Während ich mit Rick an der rauen See übernachtete, hatte sie ihren Job gekündigt und war mit einem Kumpel abgehauen, um sich einen Job in einem anderen am Meer gelegenen Freizeit-Resort zu suchen. Ich fühlte mich wie am Boden zerstört, als ich davon erfuhr. In jenen Tagen gab es natürlich noch keine Handys, also keine Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme, und somit hörte ich drei Wochen lang kein Sterbenswörtchen von ihr. Ich nahm an, sie hätte mich sitzengelassen und wäre fortgelaufen. Plötzlich aber war Jean wieder da! Ich fühlte mich überglücklich und dachte, all meine Sorgen hätten sich in Luft aufgelöst. Stattdessen war es nur der Anfang einer Beziehung, bei der Jean immer weglief, wenn es brenzlig wurde, dann wieder zurückkam und sich herzzerreißend dankbar gab. Teenager-Liebe. Gott sei Dank muss ich das alles nie mehr durchmachen.
Dann detonierte die sprichwörtliche Bombe: Jean erwartete ein Baby von mir. Ich war gerade erst 17, als sie das herausfand. Heutzutage wären das keine spektakulären Nachrichten mehr, doch 1967 stellte es ein großes Ereignis dar. Ein Baby nicht zu bekommen, stand außer Frage, denn in Großbritannien war Abtreibung illegal. Und als Katholik wäre ein Schwangerschaftsabbruch für mich nie eine Option gewesen. Hinzu kam noch – und das war der wohl wichtigste Grund –, dass ich sie abgöttisch liebte. Somit blieb nur eine Option: zu heiraten. Und das machten wir dann auch im Juni 1967 – dem sogenannten Summer of Love. Da Jean schon im siebten Monat war, stand eine katholische Hochzeit außer Frage, und so beschränkten wir uns auf die zügige „Ich will – Ich will auch“-Abfertigung beim örtlichen Standesamt.
Nur meine Eltern, Jeans Mum und ihre Schwestern kamen zur Vermählung. Meine Mum sträubte sich anfänglich, da sie vor Wut schäumte, weil wir keine katholische Hochzeit feierten. Sie wollte nichts damit zu tun haben. An dem Tag selbst gab sie dann aber nach. Ich war einige Wochen zuvor 18 geworden und versuchte, die ganze Angelegenheit wie ein angesagtes Swinging-London-Happening zu inszenieren. Kein Anzug! Stattdessen trug ich einen gelb/grün-gestreiften Blazer, ein pinkes Hemd und weiße Hosen. Jean, die bereits ein großes Bäuchlein hatte, trug ein mit Blümchen gemustertes Umstandskleid. Sie sah wunderbar aus.
Wir verzichteten jedoch auf Flitterwochen, und ich glaube, es wäre uns auch gar nicht in den Sinn gekommen. Alles drehte sich darum, dass das Baby nicht außerehelich zur Welt kam. Am Tag nach der Hochzeit zogen wir in ein freies Zimmer im Haus von Jeans Mutter in Dulwich. Ihr Mann war einige Jahre zuvor gestorben, wodurch genügend Raum zur Verfügung stand. Zwei Monate später wurde unser Sohn Simon geboren. Damals war es durchaus üblich, dass junge Paare schon sehr früh Kinder hatten. Für mich bedeutete das keine große Sache, da ich in einer riesigen Familie aufgewachsen war und alle Kids gleichermaßen von den verschiedenen Verwandten aufgezogen wurden. Dennoch: In unserer Situation war es noch nie leicht – Teenager-Eltern, die versuchen, ein Kind großzuziehen, während einer von ihnen auswärts arbeiten muss –, und anscheinend schienen sich auch noch alle gegen uns zu verschwören, um uns aus der Bahn zu werfen. Jeans Mutter stellte keine große Hilfe dar. Vor unserer Hochzeit hatte mich Jean immer von einem Treffen mit ihrer Mum abgehalten. Und nun fand ich heraus, warum! Die Frau konnte sehr kompliziert sein. Man hatte das Gefühl, sie sei direkt der Seite eines Les-Dawson-Witzes über Schwiegermütter entsprungen. Sie saß zusammengesackt in einem Ohrensessel und rauchte Kette, wobei das Kleid bis zur Hüfte hochgerutscht war, sodass man ihren großen Alte-Oma-Schlüpfer sehen konnte. Darüber hinaus ließ sie noch ihrem Gedärm einige der am teuflischsten stinkenden Fürze entweichen. Was ihre Tochter ärgerte und hochnotpeinlich berührte.
Sie verstand nicht – oder es war ihr egal –, was ich machte, dachte, ich würde in einer Popband herumblödeln, statt mir einen anständigen Job zu suchen. Vielleicht sah das ja auch meine Familie so, doch sie zeigte es nicht direkt. Vermutlich dachte sie, dass immer noch der Job im Eiswagen auf mich wartete, wenn das mit der Musik nicht klappte. Was Jeans Mutter hingegen wusste: Ich war den Großteil der Nacht nicht anwesend, aber zu häufig am Tag. Ständig lag sie ihrer Tochter in den Ohren.
Und so fing alles an: „Wir haben jetzt ein Kind. Es wird höchste Zeit, dass du aufhörst, in der Weltgeschichte herumzuziehen und deine Zeit mit einer Band verschwendest. Werde sesshaft, und fang endlich an, Geld für deine Familie zu verdienen.“ Das ging sogar so weit, dass Jean mir ein Ultimatum stellte: „Entweder ich oder die Gruppe!“ Das gehört auch zu den Problemen, mit denen sich fast alle aufstrebenden Musiker zu einem bestimmten Zeitpunkt herumschlagen müssen.
Gelegentlich geht das so weit, dass es zu einem Initiationsritus wird, an dessen Ende man sich für einen Weg entscheiden muss. In meinem Fall antwortete ich einfach: „Du wusstest von der Band schon vor der Hochzeit, wusstest, wie es war. Wenn du jetzt deine Meinung änderst, ist das okay, aber ich werde mein Ding durchziehen, wie ich gesagt habe.“
Dann beschuldigte sie mich, eiskalt zu sein, gefühllos und gleichgültig. Doch ich war in dieses Mädchen verschossen! Ich liebte meinen Sohn. Außerdem wusste ich, dass ich schon bald einen „richtigen Job“ hätte, würde die Band ein wenig Glück haben. Abgesehen vom Kummer darüber, eventuell die Gruppe aufgeben zu müssen, mochte ich die Rolle eines verheirateten Mannes und jungen Vaters. Ein Kind zu haben, war für mich eine ernsthafte Angelegenheit. Doch auch aus diesem Aspekt entstand ein Problem, das Jean und ich nicht mit einem vernünftigen Gespräch lösen konnten: Ich glaubte an eine strikte Erziehung mit klaren Regeln und Grenzen, daran, den Kindern den Unterschied zwischen „falsch“ und „richtig“ beizubringen. Jean sah das eher im Geiste der Sixties und erzählte anderen: „Meine Kinder dürfen alles machen, was sie wollen.“ Ich konterte: „Nein, das dürfen sie nicht!“ Und dann begann der nächste Streit.
Schließlich verzog ich mich aufs Klo. Es war der einzige Ort im ganzen Haus, an dem man mich mal fünf Minuten in Ruhe ließ. Schrecklich, dieser eiskalte Raum mit einer harten, hölzernen Klobrille. Das Klo glich zu allem Überfluss noch einem Miniaturschrank, doch ich verbrachte dort immer mehr Zeit und nahm sogar meine Gitarre mit. Es war so klein, dass ich zum Spielen den Hals in die Höhe halten musste. Doch ich hockte da Stunden, die Füße gegen die Wand gestemmt, spielte auf der Gitarre rum und sang.
Auf Drängen von John Schroeder hatte ich mit dem Songwriting begonnen. Wir alle probierten das aus. Die Tatsache, dass die Beatles, die Rolling Stones, die Who und die Kinks ihr eigenes Material schrieben, bedeutete, diese Kunstfertigkeit zu übernehmen, wenn man in derselben Liga gesehen werden wollte. Sonst musste man Bands nacheifern wie den Hollies und Manfred Mann, die auf der Suche nach Songs regelmäßig die Musikverlage in der Denmark Street abklapperten. Aus meinem ersten Versuch wurde die einzige Single von Traffic Jam. Sie hieß „Almost But Not Quite There“. Der Titel besagte alles, denn er deutete verdeckt auf das jahrhundertealte Problem hin, den Sexpartner „beinahe, aber noch nicht“ ganz befriedigt zu haben. Der Text stammte natürlich auch von mir. Aus irgendeinem Grund, an den ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, wurde das Stück aber Pat Barlow und mir zugeschrieben. Ich fand den Titel echt clever, bis die BBC das Urteil fällte, der Text sei „zu suggestiv“, und den Song augenblicklich von der Programmliste strich.
Als Frischvermählter begann ich, langsam darüber nachzudenken, ob Jean und ihre Mutter nicht doch recht hätten und ich mir ernsthafte Gedanken über eine andere Tätigkeit machen müsste. Ich sprach mit Dad, ob ich vielleicht für ihn einen der Eiswagen fahren solle. Uns hatte zu allem Überfluss die Nachricht ereilt, dass auch die Leute von der Plattenfirma ernsthafte Zweifel hegten. John Schroeder war der Einzige, der noch einen Versuch wagen wollte. Möglicherweise lag das aber eher an Johns Gedanken an seinen Ruf im Business, den er nicht beschädigen wollte, denn an seiner Besorgnis über unsere Karriere. John hatte so viele Erfolge erlebt und wollte uns nicht als Versager abschreiben.
Schließlich kam es zum Entschluss, dass wir ein letztes Mal mit John ins Studio gehen sollten, um etwas auf die Beine zu stellen. Das Motto lautete: Jetzt oder nie! Uns war das allen schmerzhaft bewusst, doch auf mir lastete der größte Druck, da ich es zu meiner Aufgabe gemacht hatte, einen Song mit Hit-Potenzial abzuliefern. Ich war verzweifelt, wollte nicht gezwungen sein, die Band aufzugeben und – eine schreckliche Umschreibung – mich häuslich niederzulassen.
Und so saß ich eines Tages wieder hinter verriegelter Tür auf dem Klo. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich absichtlich versucht, die Sounds anderer Gruppen aus den Charts nachzuahmen, mir kleine Phrasen hier und da „auszuleihen“ und Refrains zu imitieren.
Nun ging ich aber auf etwas Grundlegendes zurück, meine von der Musik geprägte Kindheit. Mir schwirrte „Poppa Piccolino“ im Kopf herum, der Song, den ich als Kind so sehr liebte – besonders diese fröhliche kleine Melodie, mit der der Song den Zuhörer packt. Ich improvisierte damit auf der Gitarre herum, verlangsamte sie und drückte ihr einen Freak-Stil Jahrgang 1967 auf. Auch hörte ich gedanklich die Jimi-Hendrix-Version von „Hey Joe“. Ich liebte die Fassung, besonders die ultra-groovige Rhythmusgitarre. Und so improvisierte ich auch in dem Stil. Als Nächstes – mehr aus reiner Neugier als aufgrund ernsthaften Bemühens – versuchte ich, sie zu verschmelzen. Aus dem hüpfenden, aufgekratzten Intro von „Poppa Piccolino“ und dem so lässigen wie irre coolen „Hey Joe“ wurde etwas Neues, das tatsächlich gut klang.
In dem Augenblick gingen Jean und ihre Mutter mit dem Kind spazieren. Ich verließ die Toilette, setzte mich auf die Couch und begann mit „spacigen“ Textfragmenten zu spielen, bis ich einen Song mit dem Titel „Pictures Of Matchstick Men“ fertig hatte. Die meisten nehmen aufgrund des Titels immer an, dass die Inspiration von den berühmten Bildern des industriellen Nordens von L. S. Lowry stammte. Tatsächlich hat das nichts damit zu tun. Es war eher ein Versuch, mir einen LSD-Trip auszumalen.
Ich saß auf der Couch und spielte das Stück wieder und wieder. In der einen Minute dachte ich, es sei das Beste, was ich jemals geschrieben hätte, in der nächsten empfand ich es als einen Witz, einen „gestrickten“ Song. Auf jeden Fall bekam ich ihn nicht mehr aus dem Kopf. Dann spielte ich die Nummer der Gruppe vor, und jeder der anderen mochte sie.
Die Feuertaufe kam, als wir ins Studio gingen, um die Platte aufzunehmen, von der wir glaubten, sie sei unsere letzte mit John Schroeder. John hörte sich die Nummer an und mochte sie. Seiner Ansicht nach war es eine gute B-Seite für die nächste Single. Er meinte das als Kompliment, doch für mich glich das einem Rückschlag. John hatte als A-Seite ein eher durchschnittliches Stück mit dem Titel „Gentleman Jim’s Sidewalk Café“ geplant. Es klang exakt wie dieser künstlich gestrickte Sixties-Mist, mit dem wir bereits versagt hatten.
Nachdem beide Tracks im Kasten waren, zeigte sich Johns angeborenes Talent, einen Hit zu erkennen. Er schlug vor, die Single-Seiten umgekehrt zu belegen, womit „Pictures Of Matchstick Men“ nun die A-Seite war. Einzig und allein die Vocals sollten verändert werden, die ich zuerst mit einer Falsett-Stimme gesungen hatte. John schlug vor, mit meiner natürlichen Stimme zu singen, was ich auch tat – es machte bang! –, und plötzlich hatten wir etwas Besonderes. Wir alle wussten es von der Minute an, in der wir uns in der Regie zurücklehnten und den Titel anhörten. Danach nahm John noch einige geringfügige Veränderungen vor, damit das Stück auf den kleinen 2-Inch-Lautsprechern der damaligen Transistorradios gut klang, denn die meisten Leute hörten sich Musik über dieses Medium an. Er hob die schöne Wah-Wah-Gitarre zwischen den Strophen hervor und fügte einen Phasing-Effekt dazu, den die Small Faces bei der „Itchycoo Park“-Single einsetzten, zu der Zeit ein Hit in den Charts.
Wir nahmen den Track im Oktober 1967 auf, die Veröffentlichung war für den Januar 1968 geplant. Doch davor mussten wir uns wieder um ein „winziges“ Problemchen kümmern: einen neuen Bandnamen. Das Palaver bei der BBC hinsichtlich „Almost But Not Quite There“ hatte einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Zudem durften sich Steve Winwoods Traffic seit der Zeit über drei große Hits freuen. Pat begann wieder scharf nachzudenken. Ihm fiel ein Bandnamen ein, den er phänomenal fand – die Crow Bars. Wir waren gerade mitten bei einer Probe im Keller, als er die Treppen herunterkam und ihn vorschlug. Er durfte sich direkt wieder umdrehen und musste verschwinden – mit einem Stiefel im Arsch.
Sein nächster Vorschlag war noch schlimmer: The Muhammad Alis. Das gefiel Pat besonders gut, da wir dann den Slogan „They’re the Greatest!“ nutzen könnten. Wir zogen es in Erwägung, was beweist, wie verzweifelt wir waren, die Band weiterzubringen. Doch wir hatten Glück: Pat wurde die nötige Erlaubnis für die Nutzung nicht gestattet, womit wir wieder am Anfang standen.
Sein nächster Einfall war gut. Wir hatten ihm genau erklärt, was modern und angesagt klang – wie zum Beispiel Pink Floyd oder Amen Corner. Pat wuchs diesmal über sich hinaus und schlug Quo Vadis vor, ein Name, der auf dem Etikett seiner Schuhe stand. Wir stimmten zu, denn es hatte einen speziellen Klang. Allerdings war diese ganze „Schuh-Sache“ nicht besonders anziehend. Dann machte jemand – mit ziemlicher Sicherheit Pat – den Vorschlag: Status Quo. Wir wussten augenblicklich, dass es der richtige Bandname war. Es war einer dieser vielsagenden Begriffe, die man damals oft hörte, denn junge Menschen sprachen ständig davon, den Status Quo, also das Establishment, herauszufordern. 1967 hatten die Beatles mit Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band die Welt von einem nüchternen Schwarz-Weiß-Film in einen kunterbunten Ort verwandelt. Im New Yorker Central Park verbrannten junge Männer ihre Einberufungsbescheide. In Großbritannien hatten wir nun Radio 1, das Underground-Magazin International Times, und Mick Jagger musste wegen Dope in den Knast. Pat wies darauf hin, dass die Leute ständig den Bandnamen aussprachen, ohne es überhaupt zu bemerken. Das war heavy! Allerdings war ich mir nicht ganz so sicher, doch ich wusste, dass ich den Namen wirklich mochte – Status Quo. Ähnlich wie: die Rolling Stones, Pink Floyd oder die Small Faces.
Dann erschien „Pictures Of Matchstick Men“ im neuen Jahr – und nichts passierte. Das war’s für mich. Ich hatte 1967 meinen Führerschein gemacht und mich danach mit meinem Vater über einen Fahrerjob unterhalten. Er hatte tatsächlich schon einen neuen Eiswagen bestellt. Ich saß zuhause bei meinen Eltern und wartete gerade auf den Anruf, das Vehikel abzuholen, als das Telefon klingelte. Es war Pat. Er meinte überschäumend: „Die verdammte Single hat es ‚nur‘ in die Top 30 geschafft!“ Wie bitte? Wie bitte?? Verdammt noch mal, wie bitte??? Damals nannte man das einen Spätzünder. Radio Caroline hatte die Scheibe ein paar Mal gespielt, woraufhin einige Londoner Sender dem Beispiel folgten. Dann bekam Radio 1 das Ding in die Hände und spielte es ebenfalls einige Male. Als Nächstes waren wir in den Top 30, wonach die Nummer ständig im Radio lief. In der nächsten Woche stieg sie auf Platz 11 und danach sogar auf Platz 7. Und dann lud man uns zu Top of the Pops ein! Hey, Mum, schau mal: Wir sind im Fernsehen!
Selbst Leute, die sich noch daran erinnern, was für eine Institution das wöchentliche Top of the Pops im Laufe seiner 40-jährigen Existenz war, können heute kaum mehr nachvollziehen, was ein Auftritt dort für eine Band im Jahr 1968 bedeutete! Mit nur zwei nationalen Sendern in Großbritannien (ja, es gab auch noch BBC2, doch man benötigte eine spezielle Antenne für den Empfang, die die wenigsten besaßen) war eine Einladung, die neuste Single bei Top of the Pops vorzustellen, die Garantie für einen massiven Verkauf. Und das bewies auch „Pictures Of Matchstick Men“. Obwohl das Stück in den britischen Charts nur Platz 7 erreichte, erhielten wir dafür eine Gold-Auszeichnung für den Verkauf von über einer Million Einheiten. Was den Rest der Welt anbelangte, wurde es vermutlich unser größter Hit, denn die Single schaffte es in Dutzenden von Länder in die Top 10. Auch in den USA wurde es mit einem Platz 12 der größte Quo-Hit. Erst Jahre später erfuhren wir, was für eine große Nummer es gewesen war. Da es damals kein Internet, geschweige denn soziale Medien gab, musste man sich auf die Aussagen der Plattenfirmen verlassen. Und die hatten es überhaupt nicht eilig, viel zu verraten, da sonst die Gefahr unangenehmer Fragen bestand. „Und wo sind dann bitte meine ganzen Tantiemen?“ Besonders die Tantiemen in den USA!
Vor dem Auftritt bei Top of the Pops waren wir so abgebrannt, dass wir als Begleitband für die wunderschöne schwarze amerikanische Sängerin Madeline Bell arbeiteten, die einige Jahre später mit Blue Mink berühmt werden sollte. Sie hatte gerade ihr erstes Soloalbum, Bell’s A Poppin’, veröffentlicht und war eine großartige Sängerin und Performerin. Wir beendeten die Show jeden Abend mit dem Duett „It Takes Two“, das einige Jahre zuvor ein Hit von Marvin Gaye und Kim Weston gewesen war. Am Ende des Titels küssten wir uns immer. Eines Abends in Manchester brüllte so ein Arschloch im Publikum: „Verflucht noch mal, Leute! Habt ihr das gesehen? So ein dreckiges Nigger-Weib hat ihn geküsst!“
Es war ein grauenvoller, entsetzlicher Augenblick, und ich fühlte mich zutiefst beschämt – dafür, ein Weißer zu sein, ein Mann und aus demselben Land zu stammen wie dieser Wichser. Doch Madeline, die schon ihr Leben lang mit diesem Scheiß zurechtkommen musste, schüttelte es einfach ab. Für mich stellte das aber eine Lektion dar. Ich musste mich schon als Kind mit rassistischen Sprüchen abplagen, dachte aber, das alles hinter mir gelassen zu haben. Mal wieder falsch gelegen. Im Grunde genommen musste man nur Fernsehsendungen wie Till Death Us Do Part anschauen und sich das Gequatsche des damals immens beliebten Alf Garnett über „Neger“ und „Nigger“ anhören, um klar zu erkennen, wie weit Großbritannien dem Zeitgeist hinterherhinkte. Die Leute liebten Alf, der alles „ansprach“, für seine Direktheit. Wir lebten in einer Welt, in der man immer noch von „Bimbos“ und „Negerpüppchen“ sprach.
Plötzlich war das Leben voller auf die harte Tour gelernter Lektionen. Nach Tourende fragten wir, wo denn das ganze Geld von den Verkäufen von „Pictures“ geblieben sei. Dann entdeckte ich, wie fast jeder zur damaligen Zeit – und ich bin mir sicher, dass das auch noch heute zutrifft –, dass unser Vertrag mit der Plattenfirma Pye für uns einen Betrag von exakt einem halben Prozent des Großhändlerabgabepreises vorsah. 1967 verkaufte man eine Single für ungefähr sieben Schilling, was nach heutigen Maßstäben ungefähr 35 Pence sind. Der Großhändlerpreis lag bei annähernd der Hälfte. Das bedeutet, dass wir ungefähr 0,087 Pence pro verkaufter Scheibe erhielten. Meine Rechenkünste mögen wohl nicht ganz genau sein, aber man kann das Ganze einen ausgemachten Schwachsinn nennen. Was die Kompositionstantiemen anbelangte, hatten wir mit Valley Music einen etwas besseren Vertrag abgeschlossen. Doch auch diese Zahlungen wurden extrem aufgeweicht, als sie den Song unzählige Male an verschiedene Label in der ganzen Welt lizenzierten, die wohl nur selten ihre Umsätze korrekt angaben oder Tantiemen überwiesen – zumindest erfuhren wir nichts davon! Und dann musste man sich noch mit den kleingeschriebenen und kniffligen Vertragspunkten auseinandersetzen. Dazu gehörten unter anderem die Studiokosten, die Honorare für die Beteiligten und der „Bruch“. Letztgenannte Klausel stammte noch aus seligen Schellackzeiten, in denen Tonträger leicht zerbrachen, doch das hatte natürlich wenig mit dem schwabbeligen Vinyl zu tun, auf dem wir unsere Musik nun veröffentlichten. All das wurde von den Tantiemen abgezogen.
Als ich meinen ersten Scheck für „Pictures“ erhielt – und das muss ich leider zugeben – juckte mich das nicht besonders, denn ich erblickte verblüfft eine Summe von 1.200 Pfund. Das entsprach nach heutigen Maßstäben grob umgerechnet 20.000 Pfund. Zudem muss man bedenken, dass die Kaufkraft 1968 wesentlich höher war. Man bekam in der Zeit mit diesen 1.200 Pfund Eigenkapital bereits eine Hypothek für ein anständiges Haus im Süden Londons eingeräumt, und ein nigelnagelneuer Ford Capri (hey-hey) kostete schlappe 800 Pfund. Und so wäre ich beinahe hintenübergefallen, als ich den Brief mit dem Scheck öffnete. Ich dachte zuerst, dass es sich um einen Fehler handelte, und wollte es keinem der Bosse verraten, aus Angst, sie würden das Geld zurückfordern.
Dann zeigte ich Rick den Scheck, und er begann zu hyperventilieren. Doch er freute sich für mich und gelobte, bald auch eigene Songs zu schreiben. Keiner von uns hätte erwartet, so eine immense Summe mit einer Band zu verdienen. Plötzlich wollte jeder einen eigenen Song für die nächste Single komponieren. Das konnte verdammt nerven. Nicht, weil ich unbedingt im Rampenlicht stehen wollte, sondern weil die anderen mit schlappen Ideen um die Ecke kamen. Alan schlug vor, Musik wie Pink Floyd zu machen, und schrieb einen Song mit dem Titel „Sunny Cellophane Skies“, den er auch sang. Er war gar nicht mal so schlecht, doch lange kein „Interstellar Overdrive“. Rick und ich unternahmen damals die ersten Anläufe als Songwriting-Duo und schrieben „When My Mind Is Not Live“, bei dem Rick den Hauptgesang übernahm. Um es mal höflich auszudrücken: Es war ein Song seiner Zeit. Was bedeutet: ungefähr so kitschig und verklemmt „Sixties“ wie unsere Bühnenklamotten.
Der größte Missetäter war jedoch ich, da ich viel zu bemüht versuchte, einen offensichtlichen Nachfolger von „Pictures“ zu schmieden, der auf der A-Seite der nächsten Single sein sollte. Es wurde „Black Veils Of Melancholy“, eine Nummer zum sich Winden und Krümmen. Abgesehen vom fürchterlichen Titel, kann man es grundsätzlich als zweites „Pictures“ beschreiben, nur nicht so gut! Das ging sogar bis zum – bitte halten Sie sich die Ohren zu – „Poppa Piccolino“-Gitarren-Lick als Intro. Natürlich war dann auch niemand mehr überrascht als ich selbst, als es ein phänomenaler Flop wurde. Ich dachte, ich hätte es kapiert, das Rad neu erfunden – den klassischen Nachfolger geschrieben, der dem Original glich, aber sich so weit unterschied, um noch interessant zu sein. So sollte das damals eigentlich laufen. Falsch. Ich hatte eine Niete gezogen. Oh Mann, oh Mann …
Glücklicherweise hatte ich das bei „Pictures“ verdiente Geld in einem Zuhause für mich, Jean und Simon angelegt. Mir war zuvor gelungen, Gott sei Dank, uns aus dem Haus von Jeans Mutter herauszubugsieren, doch es reichte zuerst nur für ein Zimmer bei meinen Eltern. Mit den regelmäßigen Tantiemen mietete ich uns eine Wohnung in der Lordship Lane, Dulwich. Auch Bob Young und seine Frau wohnten in dem Gebäude. Wahrscheinlich kam von ihm der Tipp zur leerstehenden Wohnung. Wir wohnten direkt über ihm, und darunter befand sich der örtliche Co-op-Supermarkt, an den wiederum eine Leichenhalle angrenzte. Ich glaube, man kann „beim Co-op“ immer noch relativ günstige Beerdigungen bestellen. Bob und ich machten einige Witze über Geister und Gespenster, doch weder Jean noch mich juckte das. Es war einfach toll, eine eigene Bude zu haben.
Das verbleibende Geld aus den Tantiemen steckte ich in die Gruppe, um sie über Wasser zu halten. Als sich „Back Veils“ als Flop erwies, ging mir das am Arsch vorbei. Es schien wohl in den Sternen zu stehen, dass wir nur einen Hit haben sollten. Glücklicherweise schlug das Schicksal aber einen anderen Weg ein. Im Laufe der Jahre tauchte „Pictures Of Matchstick Men“ dann übrigens an allen nur erdenklichen und auch unerwarteten Orten auf. Das reichte von Soundtracks wie Men in Black III und Computerspielen (Mafia 3) bis hin zu Coverversionen von Camper Van Beethoven und sogar Ozzy Osbourne. Die meisten Leute erinnern sich jedoch an die Single im Kontext eines Playback-Clips bei Top of the Pops, wo wir in unseren „Swinging“-Carnaby-Street-Klamotten auftraten. Anscheinend findet sich das Video in nahezu allen Dokus über die Sechziger.
Sicherlich hatten wir damals einen „Look“, doch wir konnten uns dessen leider nicht rühmen. Tim Boyle, ein junger Modekenner, verwandelte unser Image. Tim arbeitete als Promoter bei der Agentur von Arthur Howe und buchte all unsere Konzerte. Er war es, der die Band in Läden wie Take 6, Lord John und die Carnaby Cavern in der Carnaby Street schleppte. Dort lernten wir den Filialleiter Colin kennen, der auch zu den häufig bei Top of the Pops zu sehenden Tänzern zählte. Colin war ultra cool und gab uns immer Tipps, welche anderen Bands sich in der jeweiligen Woche blicken ließen und sich neue Outfits kauften. Man nahm ein Sakko aus dem Ständer, und Colin warnte: „Nicht, lass das mal. Steve Marriott war gestern hier und hat sich das Gleiche gekauft.“
Rick und ich ließen die Hosen bei Bona Clouts in Soho speziell für uns anfertigen – echte Eierkneiferhosen mit einem Schlag von ungefähr 50 Zentimeter Gesamtlänge. Die Haare ließen wir uns beim selben Friseur stylen wie alle Bands. Das war damals eine richtige Szene. Es war eine unserer größten Sorgen nach dem Flop von „Black Veils“, dass wir es uns nicht mehr leisten könnten, dort zu shoppen. Noch kurz zuvor hatte sich Pat eines Tages bei einer Probe mit uns zusammengesetzt und erklärt: „Okay, Jungs. Ihr könnt jetzt alle eure Jobs aufgeben. Ich möchte, dass ihr euch von nun an auf das hier konzentriert.“ Damals hatten wir schon einen eigenen Tourmanager – es fühlte sich an, als sei die ganz große Zeit angebrochen – und spielten die sogenannten „Package-Tourneen“, an denen verschiedene Künstler teilnahmen. Wir traten zusammen mit Gene Pitney auf und Love Affair, und jeder spielte ungefähr 20 Minuten. Dann aber sah es plötzlich so aus, als müssten wir wieder bei den alten Arbeitgebern anklingeln. In der Hinsicht lagen die Nerven blank. Auch wenn es gut lief – wie zum Beispiel mit „Matchstick Men“ –, glaubte niemand, dass die Band fünf Jahre überdauern würde – im besten Fall vielleicht und wenn wir das Glück an unserer Seite hätten! Ja, so lassen sich die damaligen Perspektiven von Musikern durchaus beschreiben. Und falls wir kein Glück hätten – na ja, unzählige One-Hit-Wonder hatten die Charts bereits zugemüllt. Wenn eine neue Platte also nicht lief – was bei unserem „Status“ häufig vorkam –, stand man schon am Rande der Verzweiflung. Wenn es funktionierte, wie bei „Matchstick Men“, vollführte man wahre Luftsprünge, doch nur wenige Tage lang, denn dann setzten die Sorgen erneut ein, ob es gelänge, einen würdigen Nachfolger zu kreieren.
Glücklicherweise rettete uns diesmal das Songwriter-Team Marty Wilde und Ronnie Scott, das der Band ein höchst eingängiges kleines Liedchen, betitelt „Ice In The Sun“, „vermachte“. Marty hatte sich als Sänger schon in den späten Fünfzigern mit Coverversionen amerikanischer Hits wie „A Teenager In Love“ und „Sea Of Love“ einen Namen gemacht. Ronnie seinerseits war ein Pop-Impresario, Promoter, Manager und Hit-Songwriter, wie er im Buche stand. Beide lassen sich als Hitschmiede alter Schule charakterisieren, und wir schätzten uns glücklich, sie auf unserer Seite zu wissen. Ronnie arbeitete für Valley Music, und Marty hatte schon seine eigene Fassung des Songs mit einem Orchester aufgenommen, die meiner Meinung nach sehr gut klang. Unsere Version – die Marty im Studio anhörte – ging eher in Richtung „Psychedelic Pop“. Der Meisterstreich ging auf sein Konto, denn während eines „inspirierten Hochs“ strich er eine Münze über Klaviersaiten, die dieses kleine zischende Geräusch verursachte, das man beim Refrain hört. Das glich dem Dekorieren eines Weihnachtsgeschenks mit Lametta, ein Feinschliff, der dem ganzen Stück eine besondere Note verlieh.
Uns half dieser Gag, womit die Band sich über ihren zweiten Top-10-Hit in dem Jahr freuen konnte. Mein Gott, was war ich zufrieden! Oder eher erleichtert? Wir „überlebten“, um in die nächste Schlacht zu ziehen, und verprassten noch mehr Geld für Klamotten in der sündhaft teuren Carnaby Street. Auf einer praktischen Ebene bedeutete das endlich, Shows unter dem eigenen Namen zu spielen, zu denen sogar nach und nach kreischende Teenie-Mädchen kamen. Tja, meist waren es 50 am Abend. Doch wer zählte das schon? Okay, wir haben gezählt. Besonders Rick, der verdammt eifersüchtig werden konnte, wenn die Mädchen ihre Namen und Telefonnummern mit Lippenstift auf die Seite des Vans kritzelten und ihn nicht erwähnten. Mir waren die meisten gewidmet! „I love you Mike XXX“ – wie man mich damals noch nannte. Das lag aber nicht an meinem Aussehen, denn in dieser Kategorie war Rick immer der Sieger, sondern an der Tatsache, dass ich der Sänger war. Ich begriff das. Rick hingegen mochte das überhaupt nicht. Wenn er dachte, wir würden es nicht sehen, schrieb er sogar seinen eigenen Namen mit Lippenstift auf den Van. „I love you Ricky XXX.“ Er sah sich als Meisterfälscher, doch alle wussten, dass Rick einen eigenen Lippenstift benutzte.
Nutzten wir die Situation mit den Girls aus? Na klar. Wir waren blutjunge Teenager auf dem Höhepunkt der Sixties, in denen die freie Liebe zur Tagesordnung gehörte und wir eine scheinbar unbegrenzte Auswahl hatten. Es wäre verdammt komisch gewesen, hätten wir uns anders verhalten. Natürlich liebte ich Jean und meinen Sohn. Ich war aber auch ein ganz normaler heißblütiger und dummer Teenager. Aber nicht nur das, sondern auch ein Teenager, der im Fernsehen gewesen war und dem sich jetzt schreiende Mädchen an den Hals warfen. Die Tatsache, auf Tour und jede Nacht in einem anderen Hotel zu sein, erhöhte den Reiz zusätzlich. Am nächsten Morgen fühlte ich Reue, dachte: Was habe ich nur getan?
Fühlten wir alle so? Ich will nicht lügen, denn das traf eher nur auf mich zu. Keiner der anderen war verheiratet oder hatte Kinder. Sie hatten jedes Recht, das zu machen, was sie wollten. Für mich war das aber eine schwerwiegende Angelegenheit. Sogar später noch – als wir auf der ganzen Welt berühmt geworden waren und die Verlockungen und Möglichkeiten ins Grenzenlose stiegen – verwirrte mich das regelmäßig und brachte mich zum Grübeln. Ich fand mich nach der Show in einem Zimmer mit einem umwerfend schönen Mädchen wieder und rannte unter dem Vorwand, aufs Klo zu müssen, ins Badezimmer. Dort begann ich meine Meinung zu ändern und überlegte, wie ich sie am besten loswerden könnte. Als ich wieder herauskam, lag sie schon im Bett. Tja, was sollte ein armer, abtrünniger katholischer Junge da machen?
Ich möchte nicht behaupten, dass wir damals übermütig wurden, doch man gewöhnte sich daran, im Fernsehen aufzutreten und im Radio gespielt zu werden. Wenn wir in die Garderobe gingen, sangen wir regelmäßig: „Hi ho, hi ho / We are the Status Quo / With a number one we’ll have some fun / hi ho, hi ho …“ Das Liedchen war Alan eingefallen.
Der nächste Nervenkitzel war die Veröffentlichung unseres ersten Albums, das im September 1968 auf den Markt kam. Im Zuge eines „Wir wollen auf gar keinen Fall Kapital aus unserem Hit schlagen“-Schachzug nannten wir es Picturesque Matchstickable Messages From The Status Quo. Der Titel war mal wieder ein Vorschlag von Alan. Um fair zu bleiben, muss ich aber klarstellen, dass wir ihn alle ganz schön clever fanden. Man konnte daran unser Streben nach Erfolg ablesen. Dennoch stellte es sich als verdammt blöd und dämlich heraus, denn für die Käufer war der Titel viel zu lang und schwer auszusprechen, um ihn problemlos im Plattengeschäft nachzufragen. Trotzdem schlich sich das Album in Großbritannien für einige Wochen in die Top 10, landete auch in Westdeutschland in den Top 10 und belegte in Frankreich Platz 12. Bedenkt man, dass wir noch nie in diesen Ländern aufgetreten waren, empfanden wir die Nachricht als verrückt. Das – sagen wir mal – überraschte mich angenehm, denn um ehrlich zu sein, fand ich die Scheibe nicht sonderlich gut. Alben – man nannte sie damals noch LPs – waren für die meisten Plattenfirmen von zweitrangiger Bedeutung. Außer, man hieß The Beatles, eine Kategorie, in die wir definitiv nicht fielen. Daraus resultierte: Von den zwölf Tracks der LP waren acht Singles oder B-Seiten, aufgemotzt mit Covers wie „Spicks And Specks“ (ein alter Hit der Bee Gees von 1966), „Sheila“, ein weiterer Hit, diesmal von Tommy Roe, und „Green Tambourine“, was vor nicht langer Zeit ein Erfolg für die Lemon Pipers gewesen war.
Das Album enthielt zudem die nächste geplante Single „Technicolour Dreams“, zugegebenermaßen recht schrecklicher Pop-Kram, geschrieben von Anthony King, einem Kumpel von John Schroeder. Es war mal wieder ein „Pictures“-Abklatsch, doch ohne die ausgleichenden Qualitätsmerkmale wie einen erinnerungswürdigen Refrain, eine klasse Strophe oder einem tollen Intro und … ach, vergessen wir das mal lieber. Solange es sich als Hit erwies, juckte uns das nicht, doch als die LP aus den Charts fiel, wurde sie von Pye gestrichen. Somit endete das Jahr 1968 – in das unser großer Durchbruch gefallen war – auf einer Art Tiefpunkt.
Entschlossen, uns jetzt festzubeißen und auf einen sicheren Hit abzuzielen, hockten sich Rick und ich hin und schrieben den Song „Make Me Stay A Bit Longer“. Aus heutiger Sicht betrachtet, mag es die erste Gruppenleistung gewesen sein, bei der man Anklänge an die Siebziger-Quo erkennen kann. Sie hatte zwar noch nicht den unwiderstehlichen und nachdrücklichen Shuffle-Rhythmus, den wir auf den großen Hits der Dekade verewigten, doch sicherlich ein direkteres Rock-Feeling, verglichen mit den bisherigen Quo-Singles. Der Titel erschien im Januar 1969, kurz bevor wir in der BRD mit den Small Faces auftreten sollten. Sowohl „Pictures“ als auch „Ice In The Sun“ waren dort in die Charts eingeschlagen, weshalb wir uns auf die Tour freuten. Moralisch unterstützte uns die Tatsache, dass „Make Me Stay A Bit Longer“ in Musikzeitschriften wie Disc und dem Melody Maker überschwängliche Besprechungen erhielt. Von Deutschland aus telefonierten wir nach Hause, um uns zu erkundigen, wo die Single in den Charts stehe, worauf man uns mitteilte, dass sie es noch nicht mal in die Top 100 geschafft habe.
Als wir zurückkehrten, fühlten wir uns extrem desillusioniert. Rick und ich unterhielten uns sogar darüber, auszusteigen und eine eigene Band zu gründen. Zu einem anderen Zeitpunkt hatten wir Pat bereits davon überzeugt, Alan rauszuwerfen, doch da noch einige Gigs anstanden, entschieden wir uns, während einer dreimonatigen „Bewährungsfrist“ (aus der dann 20 Jahre wurden) weiterhin mit ihm zu spielen. Zu dem Zeitpunkt wurde offensichtlich, dass Rick der einzige Freund war, den ich in der Gruppe hatte. Alan sah sich immer noch als Boss und wurde im Umgang mit Rick zunehmend schwieriger, während John und Roy ja älter und demzufolge schwieriger ansprechbar waren. Außerdem glaubten Rick und ich einen guten Song geschrieben zu haben, und dem schienen auch die Musikkritiker zuzustimmen. Doch aus irgendeinem Grund floppte die Quo-Single. Ich kann nicht sagen, ob wir die Schuld bei den anderen statt bei uns selbst suchten. Vielleicht hatten wir es auch einfach satt, mit Alan in einer Band zu sein – der uns immer noch so behandelte, als hätten wir Glück gehabt, mit ihm spielen zu dürfen – oder mit John, der manchmal austickte und sich voll danebenbenahm. Möglicherweise trugen all die Probleme zu unserer Unzufriedenheit bei. Vielleicht suchten wir aber auch nur nach Entschuldigungen? Außerdem hatten wir einige wunderbare Wochen mit den Small Faces auf Tour verbracht, denen sich Rick und ich damals zugehöriger fühlten. Sie waren freche Bürschchen – wir waren freche Bürschchen. Die Small Faces kehrten mit dem Wissen nach London zurück, dass Steve Marriott die Band verlassen würde, was das Ende für sie bedeutete. An einem bestimmten Punkt kamen Rick, ich und der Small-Faces-Drummer Kenney Jones auf die großartige Idee, eine gemeinsame Band zu gründen.
Uns schwebte „intelligenterweise“ ein Power-Trio vor. Man muss sich daran erinnern, dass Power-Trios damals das ganz heiße Ding waren. Es gab Jimi Hendrix und seine Experience, Taste mit Rory Gallagher und Blue Cheer, eine total angesagte amerikanische Gruppe. Cream waren jedoch die größten und besten, mit Eric Clapton, Ginger Baker und Jack Bruce. Sie hatten sich allerdings aufgelöst, und Jimi Hendrix war über das Konzept eines Power-Trios hinausgewachsen – er spielte mit allen möglichen Begleitmusikern –, weshalb nach unserem Gefühl eine Marktlücke entstanden war.
So schien sich die Musik 1969 zu entwickeln. Die Flower-Power-Ära war vorüber, und Bands wurden „heavy“, um den damaligen Begriff zu verwenden. Steve Marriott hatte die Small Faces mit der Absicht verlassen, eine härter klingende Band zu gründen, was er mit Humble Pie verwirklichte. Sogar die Beatles distanzierten sich von ihrem Sgt. Pepper’s-Konzept und veröffentlichten mit „Get Back“ eine hart rockende Single.
Und nun waren wir da: Ich an der Lead-Gitarre (es ist mir ein Rätsel, wie ich jemals hoffen konnte, auf demselben Niveau wie Hendrix oder Clapton zu spielen), Rick, der von der Rhythmusgitarre zum Bass wechselte, und Kenney an den Drums. Wir jammten insgeheim in einem Proberaum in Westlondon … aber es funktionierte nicht. Es lag nicht unbedingt daran, von Rick erwartet zu haben, die Gitarre mit dem Bass einzutauschen. Möglicherweise hätten wir einen engagierten Bassisten gefunden und Rick Rhythmus spielen lassen, was er gut konnte – wäre es so weit gekommen. Es lag nämlich an dem guten Kenney. Man hatte den Eindruck, er sei von der Leine gelassen worden und ausgerastet – all diese verrückten Rhythmen und auf Percussion ausgelegten Beats. Das klang großartig, doch ließ keinen Raum mehr für Rick oder mich, um einzusteigen oder lange genug einen Rhythmus zu schrubben. Nach dem ersten Tag schauten wir uns beide an: „Hm, das läuft nicht, oder?“
Tags darauf probten wir wieder mit Quo. Wir haben ihnen nie etwas davon erzählt. Sie fanden das dann natürlich heraus, doch erst viel später, und da hatte sich schon viel geändert.