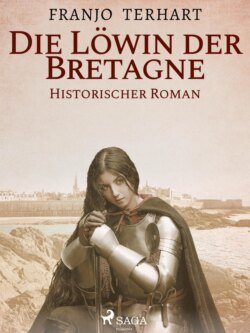Читать книгу Löwin der Bretagne - Historischer Roman - Franjo Terhart - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEinige dramatische Jahre waren seither ins Land gegangen; darunter Jahre mit ungewöhnlich harten Wintern, wie man sie bisher noch nicht an den Küsten und im Binnenland der Bretagne erlebt hatte. Menschen erfroren nachts in ihren Betten, und Männer – tagelang auf Fischfang draußen auf dem Meer in ihren Nußschalen kauernd – wurden von gewaltigen Stürmen und heftigen Unwettern überrascht. Hunderte dieser wagemutigen Fischer fanden den Tod und ließen daheim jammernde Witwen und Waisen zurück. Ohnehin fristeten die meisten Bretonen in ihren einfachen Häusern, gedeckt mit dicken Strohdächern, ein eher bescheidenes Leben. Aber man war stolz auf das Erreichte. Die Frauen fegten am Abend die gestampften Böden und hängten Büschel von Kräutern in die Eingänge. Meist lebten die Menschen von Fisch, aßen eingesalzenen Queller und Blätter, die für Fremde wie Fußlappen aussahen, aber nicht übel schmeckten. Dabei wurde nahe beim Kaminfeuer lebhaft geschwatzt, auch über die adeligen Herrschaften, die es weitaus bequemer und besser in ihren Burgen und Schlössern hatten.
Auch den Belvilles machten die harten Winter zu schaffen. Schneestürme tobten ums herrschaftliche Haus, dessen hohe Türme wie graue Schatten im Wirbel der Schneeflocken standen. Seit Beginn des Winters hatte man wohlweislich alle Luken und Fensteröffnungen mit Holzlatten, Werg und gezupfter Wolle abgedichtet. So hoffte man den eisigen Luftzug abzuwehren. In allen Kaminen loderten Feuer, und auf den Gängen schwelten Kienspäne in geschmiedeten Fackelhaltern, dennoch schien die Kälte im Winter 1330 zum erstenmal seit Menschengedenken Siegerin zu bleiben.
Auch der Adel fror bitterlich, und Jeanne, mittlerweile zwölf Jahre jung, erinnerte sich – wie alle anderen Familienmitglieder in dicke Decken gehüllt – wehmütig an die lebhaften Erzählungen eines fahrenden Ritters, der im Frühjahr, aus Italien kommend, für einige Wochen bei ihnen gewesen war. Dort im fernen Italien brannte die Sonne auch im Winter immer noch so heiß vom Himmel wie bei ihnen im besten Sommer. Das Mädchen seufzte laut auf, als sie sich an seine herrlichen Schilderungen der grünen Hügel der Toskana und Umbriens erinnerte. In einer Landschaft, in der verstreut unter einem ewig blauen und wolkenlosen Himmel wunderschöne alte Städte lagen, in denen die Menschen gemächlich lebten und es dennoch zu erheblichem Wohlstand gebracht hatten.
Genéviève de Belville blickte überrascht auf, als sie ihre Tochter so ungeniert seufzen hörte. Vermutlich langweilte sie sich einmal wieder. Sie selbst war dabei, mit geschickten Fingern den Faden vom Rocken zu ziehen. Ein wenig abseits von ihr schoben der Graf und sein ältester Sohn Maurice die elfenbeingeschnitzten Figuren des Schachspiels übers Brett, das ihnen im letzten Sommer ein spanischer Händler über Umwege aus Syrien mitgebracht hatte. Schach, so fand der Schloßherr, war bei solchen tagelangen Unwettern der beste Zeitvertreib. Sein Sohn Maurice hatte die Regeln des strategischen Spiels schnell begriffen, so daß dem Vater ein nicht gerade ebenbürtiger Gegner, aber immerhin jemand gegenübersaß, mit dem es sich zu spielen lohnte. Auch Jeanne hatte anfangs mehrmals darum ersucht, daß ihr jemand die unterschiedlichen Züge der Figuren erklärte, aber ihr strenger Vater hatte dies jedesmal mit den Worten abgelehnt, daß Gott für Mädchen und Frauen nun mal das Spinnen und Weben geschaffen habe und für Männer eben anderes. Jeanne hatte daraufhin ihre Mundwinkel verzogen und immer wieder gequengelt, sie doch ins Schachspiel einzuweihen. Aber ihr Vater war unerbittlich geblieben. Den Faden vom Rocken zu ziehen, wie es ihr ihre Mutter an jedem Abend vormachte, danach stand ihr nicht der Sinn. Sie hoffte, daß bald der Frühling ins Land einzog, damit sie wieder ins Freie konnte, auch deshalb, um auf Bäume zu klettern, wo sie in einer Astgabel ungestört träumen und nachdenken konnte, während Amélie sie ganz woanders suchte.
Jeannes Mutter schaute nachdenklich zu ihren beiden Männern hin und dachte an ihren Zweitältesten. Ihr Stiefsohn Thomas war mit einem häßlichen Klumpfuß geboren worden, der ihn äußerlich zu einem Krüppel machte. Im letzten Jahr hatte der Bischof von Nantes dafür Sorge getragen, daß Thomas, der ohnehin dem geistlichen Stand von jeher nicht abgeneigt gewesen war, im Kloster von St. Gildas-de-Rhuys als Novize aufgenommen wurde. Thomas war zwar gerade mal fünfzehn Jahre alt, aber die Klosterbrüder hatten sich der Empfehlung des Bischofs nicht widersetzen können. Genéviève de Belville war froh darüber, daß ihrem Sohn auf diese Weise eine Heirat erspart blieb. Man hätte andernfalls der Familie der Braut eine nicht unerhebliche Mitgift andienen müssen, wobei auch damit immer noch nicht sichergestellt war, ob für Thomas überhaupt eine standesgemäße Heirat in Frage gekommen wäre. Denn Maurice, Liebling ihres Mannes, würde einmal, wenn es soweit war, Namen und Besitz derer von Belville erben. Für Thomas selbst würde dann nur ein relativ kleiner Teil des elterlichen Vermögens bereitstehen.
Ihre Tochter Jeanne starrte noch immer ins prasselnde Feuer, lauschte dem Knacken des trockenen Holzes und träumte vor sich hin. Auch die Zukunft ihres einzigen leiblichen Kindes war gesichert. Jean III. hatte erreicht, daß die beiden bis dahin verfeindeten Familien endlich Frieden schlossen. Ein des langen und breiten ausgehandelter Vertrag sah vor, daß Olivier de Clisson und Jeanne de Belville an Jeannes sechzehntem Geburtstag heirateten. Die beiden hatten sich bislang noch nicht gesehen, was nicht unüblich war. Um die Heirat perfekt zu machen, hatte Maurice dem Grafen Guillaume de Clisson seinen Wald beim Weiler Paimpont – Brocéliande – schweren Herzens angeboten. Erst bei diesem verlockenden Angebot hatte der alte Fuchs aus Nantes angebissen. Denn auch ihm ging nichts über eine gute Jagd, und je besser das Revier dafür war, um so größer die Freuden einer solchen Jagd. Maurice de Belville hatte sich zuletzt doch noch dazu durchgerungen, das alte Erbe seiner Familie an die Clissons abzutreten. Die letzten fünf Jahre hatten deutlich gezeigt, daß es um die Selbständigkeit der Bretagne immer schlechter bestellt war. Seit neuestem machten auch die Engländer Ansprüche auf sie geltend, wodurch die Bretagne zum ›Zankapfel‹ zwischen England und Frankreich geworden war. Herzog Jean hatte in einer Versammlung, bei der alle bedeutenden Häuser des Landes vertreten waren, warnend die Hand gehoben und erklärt, daß nun Gefahr bestand, daß ihre Heimat zwischen den beiden Mächten zerrieben würde. Fest stand aber auch, daß man sich nicht gleichzeitig mit den Engländern und den Franzosen anlegen konnte. Somit wurde es um so wichtiger, daß alle Adelshäuser der Bretagne zusammenhielten wie ein Mann. Nur so konnte man der drohenden Gefahr einigermaßen trotzen. Aber schon hatten sich einige Familien berechnend auf die eine oder andere Seite geschlagen. Jean III. sah durch die unvorteilhafte Lage äußerst schwierige Zeiten auf sie alle zukommen. Besser hätte es dem Herzog gefallen, wenn sich alle einstimmig für England gegen die Franzosen ausgesprochen hätten. Aber ein solcher Konsens schien unmöglich, weil uralte Eifersüchteleien, eitle Kämpfe um die Vorherrschaft und böse Intrigen untereinander nach wie vor zu groß und an der Tagesordnung waren.
Die Gräfin spann noch immer gedankenverloren ihre Wolle und beobachtete dabei aus den Augenwinkeln heraus ihre Familie. Ganz besonders aber Jeanne, die jetzt, ihrem angestrengten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, über irgend etwas zu brüten schien. Ihre Tochter konnte mitunter recht anstrengend sein. Auch schien sie leider Gottes das mitunter unbeherrschte Wesen ihres Vaters geerbt zu haben, das sich zuweilen bis zur Rachsucht steigern konnte. Wenn jemand Maurice übel aufgestoßen war, dann mußte sich dieser jemand in acht nehmen. Noch viele Jahre später konnte ihr Gemahl Menschen, die ihm einmal quer gekommen waren, für ihr Verhalten bestrafen. Und Jeanne schien diesen schlechten Charakterzug von ihm geerbt zu haben.
Genéviève erinnerte sich an ein Ereignis aus dem letzten Sommer. Jeanne hatte von einem Pilger, der unterwegs nach Santiago de Compostela gewesen war, einen kleinen Hund geschenkt bekommen, der ihm unterwegs zugelaufen war. Der Pilger, ein Mann aus Bremen, der eine Tunika aus einfachem Grobgarn trug mit zerschnittenem Saum und am Tor um Speise und Trank gebeten hatte, war spätnachmittags ins Schloß gebeten worden, weil er so vorzüglich auf der Flöte spielen konnte. Maurice hatte ihm im Innenhof dabei zugehört und daraufhin beschlossen, den Ausländer für den Abend einzuladen, um bei ihnen am Tisch aufzuspielen. Der Mann – er nannte sich von Renckenberg – hatte eingewilligt und ihnen allen einen unvergeßlichen Abend mit Melodien geschenkt, wie sie in seiner Heimatstadt Bremen zur Zeit Mode waren. Auch die Kinder hatten seinem Spiel begeistert zugehört. Draußen im Hof, bellte fast die ganze Zeit über ein kleiner struppiger Hund. Es stellte sich jedoch heraus, daß er dem Deutschen gehörte.
»Wenn du magst, dann schenke ich ihn dir, Jeanne?«
Die Augen ihrer Tochter hatten geleuchtet wie die Sterne im Mai, wenn der Nachthimmel meist von Wolken leergefegt ist.
»Ist das wahr?« hatte Jeanne begeistert ausgerufen und ihren Vater bittend angeschaut.
Maurice hatte gnädig genickt, denn eigentlich mochte er keine Hunde bei sich im Schloß, die so klein waren, daß sie unter einem Hocker Platz fanden. Aber er wollte den Gast nicht vor den Kopf stoßen. Dieser hatte ihm zwar später mitgeteilt, daß es nicht sein Hund wäre, den er da verschenkt habe, sondern daß dieser ihm auf seinem Weg einfach nachgefolgt sei. Daraufhin mußte, so jedenfalls reimte es sich die Gräfin zusammen, Maurice im stillen beschlossen haben, den Hund, sobald der Mann wieder abgereist war, vom Schloßhof entfernen zu lassen. Dies geschah ein paar Tage später.
Bis dahin hatte sich Jeanne fast schon rührend um das kleine springlebendige Wollknäuel gekümmert. Sie hatte sich in das Tier so richtig verliebt. Jeder hatte es sehen können. Und dann eines Morgens kam der furchtbare Moment, wo das Mädchen den kleinen Hund nirgendwo mehr auffinden konnte. Gaston, der Stallknecht, den Maurice immer für bestimmte schmutzige Fälle einsetzte, hatte das Tier auf seinen Befehl hin beseitigt. Dies war von einer Magd, die nicht wußte, daß die Anweisung vom Schloßherrn persönlich gekommen war, beobachtet worden. Sie führte Jeanne an die Stelle, wo Gaston das Tier mit einem Knüppel erschlagen hatte. Jeanne schrie unter Tränen auf und rannte zurück ins Schloß. Dabei begegnete sie unterwegs dem schiefäugigen Gaston.
»Eines Tages werde ich dafür sorgen, daß jemand dich erschlägt, du böser Mensch«, rief sie wutentbrannt aus und spuckte ihm ins Gesicht.
Der Mann zuckte nicht einmal zusammen. Er hatte keine Ahnung, warum die Tochter seines Herrn auf ihn derart wütend war.
»Ich werde meinen Vater bitten, dich gräßlich zu bestrafen. Wirst schon sehen, du Mistkerl!«
Von dem Augenblick an lag sie Maurice immer wieder in den Ohren, Gaston auspeitschen zu lassen. Über mehrere Wochen lang ging das so. Maurice wollte seiner Tochter gegenüber nicht eingestehen, daß er seinem Knecht selbst den Auftrag zur Tötung des Hundes erteilt hatte. Um sein Gesicht zu wahren, ließ er Gaston zuletzt vor aller Augen im Hof auspeitschen. Der Stallknecht verzog dabei keine Miene, obwohl die Schmerzen unerträglich sein mußten. Nur Jeannes Augen funkelten wild. Sie schien großen Gefallen daran zu finden, wie der Mann bestraft wurde und daß seine Haut unter den mächtigen Peitschenhieben aufplatzte und blutete.
Am nächsten Tag war der Knecht verschwunden. Er hatte sich in der Nacht aus dem Staub gemacht. Maurice hatte einen seiner treuesten Leute verloren, auch wenn es ein Leibeigener gewesen war.
Jeanne, durchfuhr es ihre Mutter kalt, barg bei all ihrem Liebreiz einen bösen Kern in sich. Wehe, wenn er geweckt wurde. Dann konnte sie zur Furie werden.
Nach Nantes waren sie auch gefahren, und zwar die ganze Familie. Das war Ostern vor zwei Jahren gewesen. Damals war der Ehevertrag von den zwei Familienhäuptern, Maurice und Guillaume, besiegelt worden. Ursprünglich hatte Maurice noch geplant, allein, jedenfalls ohne Frau und Kinder, nach Nantes zu reisen. Aber dann hatte ihn wieder einmal Jeanne in ihrer unverwechselbaren Art heftig bestürmt, sie doch alle dorthin mitzunehmen. Im übrigen hätte er ihr immer versprochen, ihr eines Tages das Meer zu zeigen. Bis dahin hatte Jeanne in ihrem Leben noch niemals das Meer gesehen, obwohl ihre bretonische Heimat seit jeher vom Wohl und Wehe des Meeres abhing. Schließlich hatte Maurice dem Wunsch seiner Tochter nachgegeben, und so waren sie eines Tages kurz nach Sonnenaufgang in einem kleinen Troß, gesichert durch Ritter und Schildknappen, nach Nantes aufgebrochen. Das Treffen sollte dort im Hause des Bischofs stattfinden, der dem Vertrag seinen Segen geben wollte.
Die nicht unbeschwerliche Reise führte sie zunächst nach Rochefort-en-Terre, einem hübschen Städtchen, wo sie im Schloß für zwei Tage Quartier bekamen. Von dort ging es weiter über Redon und Blain direkt nach Nantes an der Loire. Länger als eine Woche lang hatte die Anreise gedauert, aber wenigstens war das Wetter ihnen gnädig gewesen. Weder regnete es, noch froren sie auf ihrem Weg.
Unterwegs vertrieb man sich die Zeit mit Geschichtenerzählen. Nicht müde wurde Jeanne, die märchenhaften Mythen vom Riesen Gargantua erzählt zu bekommen, jenem fleischgewordenen bretonischen Schrecken der Nordküste, wo der Riese, wenn ihn jemand in Wut versetzte, ganze Felsen aufhob und damit um sich warf.
»Warum sagt ihm denn keiner, er soll die Franzosen zermalmen?« fragte das Mädchen. Für sie durfte es einfach nicht der Fall sein, daß ein so mächtiger Beschützer ihrer Heimat nichts weiter als ein Fabelwesen war.
Am vierten Tage jedoch brachte Genéviève de Belville das Gespräch auf den Anlaß ihrer Reise und damit unweigerlich auf die Familie Clisson. Jeanne zog unbewußt die Nase hoch. Sie wollte lieber wieder etwas von Gargantua hören. Mutter wie Tochter saßen auf einem offenen Wagen, der von zwei Maultieren gezogen wurde. Beide trugen auf der Reise die für bretonische Frauen und Mädchen typische steife Haube als Kopfbedeckung.
»Die Clissons aus dem kleinen Ort Clisson südlich von Nantes sind eine alteingesessene Familie und mit den Herzögen der Bretagne eng verwandt. Sie selbst zählen damit schon lange zum Hochadel. Die Clissons haben es immer verstanden, sich durch Einheirat in die Familien der Herzöge allerhöchstes Ansehen und die mächtigsten Positionen zu verschaffen. Hätte Jean III. eine Tochter oder einen Sohn gehabt, dann würden die Clissons sicherlich von uns nichts wissen wollen. Oliviers Mutter ist Marguerite de Craon, eine krankhaft ehrgeizige Frau. Sie schenkte ihrem Mann Guillaume zwei Söhne: Olivier und Amaury. Amaury ist der ältere von beiden. Man sagt, er würde bald Isabeau de Ramefort heiraten, eine Nichte Jean de Montforts, der einmal den Herzog beerben wird, wenn dieser von uns geht. Olivier de Clisson ist fünf Jahre älter als du, mein Kind. Alle sind sehr angetan von ihm. Olivier hat große Ambitionen, ist klug, politisch geschickt und äußerst redegewandt. Nachteilig sei an ihm nur zweierlei: seine Arroganz und seine Furchtlosigkeit. Letzteres verleitet ihn häufig dazu, sich durch unüberlegtes Handeln in Gefahr zu bringen. Olivier de Clisson scheint zu glauben, daß nichts und niemand auf der Welt ihm etwas anhaben kann. Wie viele junge Männer! Du, Jeanne, wirst ihn erst am Tag deiner Hochzeit kennenlernen. An deinem 17. Geburtstag. Freu dich darauf, mein Liebes, denn du machst eine gute Partie. Die Clissons sind reich, viel, viel reicher als wir und äußerst mächtig.«
Jeanne schwieg wie immer, wenn sie nicht genau wußte, ob ein Ereignis für sie etwas Gutes oder Schlechtes bedeutete. Eher gelangweilt betrachtete sie die vorbeiziehende Landschaft: Felder, auf denen gelbe Ginsterbüsche blühten, wechselten mit dunklen Laubwäldern ab. Der Weg führte meistenteils zwischen sanften Hügeln hindurch. Das Mädchen dachte an Überfälle, aber es war nicht damit zu rechnen, daß sie von Räubern oder Wegelagerern überfallen wurden, denn der Herzog regierte das Land mit eiserner Faust. Wer bei Raub erwischt wurde, verlor sein Leben. Und bei Raubzügen im Land wurde man sehr leicht von den Soldaten des Herzogs erwischt, weil seine Bewaffneten fast überall zugegen waren. Dies auch, um mögliche Feinde abzuschrecken: Seht her, wir sind wachsam!
Dann endlich erreichten sie Nantes, die Hauptstadt der Bretagne. Dieser Titel wurde ihr in früheren Zeiten durch die Grafen von Rennes immer wieder streitig gemacht, weswegen es heftige Kämpfe gegeben hatte. Durch das wuchtige Stadttor Saint-Pierre betraten sie Nantes. Es war so, als wären sie tagelang durch eine fast menschenleere Wildnis gezogen und plötzlich an eine Stelle gelangt, wo sie einen Vorhang beiseite zogen, um dahinter in eine völlig entgegengesetzte Welt zu gelangen. Die Stadt, die durch ihren Hafen direkt mit dem Meer verbunden war, wimmelte von Menschen aller Art: Händler, Männer unter Waffen, Gecken, Gaukler, Huren und fette Waschweiber, falsche Propheten, schmierige alte Seebären, seltsame Heilige, einäugige Wahrsager, Kräuterfrauen und viel Gesindel trieben sich in den schmalen Gassen herum. Man mußte sehr auf der Hut vor Dieben sein, mitunter wurden Kinder von ihren Eltern angehalten zu stehlen, weil deren Händchen in fremden Taschen kaum zu spüren waren. Der Graf von Belville schickte sogleich in den Straßen einige seiner Leute voraus, die ihnen den Weg bis zum Palais des Bischofs freihalten sollten. Nicht immer bequemte sich das niedrige Volk, unverzüglich zur Seite zu treten, so daß einige Male auch von seiten der Männer des Grafen Gewalt angewendet werden mußte. Nantes, die Hauptstadt des Landes, erblühte allmählich zu einem wichtigen Handelszentrum in der ganzen Region, dessen Bedeutung sich in den nächsten Jahrzehnten noch um einiges mehren sollte.
Das Schloß des Herzogs der Bretagne, aus klobigen Steinen errichtet und von einer hohen Ringmauer umgeben, dominierte den lebhaften Stadtkern. Neben dieser herzoglichen ›Unterkunft‹ wirkte der Palast des Bischofs von Nantes eher bescheiden und klein. Das ehrgeizige Bestreben Seiner Eminenz, des Bischofs Gautier de Rosanbo, lag in jenen Jahren einzig darin, den Bau der Kathedrale Sankt Peter weiter voranzutreiben. Zur Zeit waren die Steinmetze unter Anleitung ihres genialen Dombaumeisters Rodier mit der Errichtung der Fassade der beiden Türme und der drei Portalbögen auf Jahre hinaus beschäftigt.
Bischof Gautier de Rosanbo empfing sie äußerst zuvorkommend und ohne jegliche Verzögerung, wie sie sein hohes Amt häufig mit sich brachte. Der Grund war, daß Herzog Jean III. ihn längst auf den wichtigen Besuch der Familie vorbereitet und alles in die Wege geleitet hatte, um den Belvilles die Dauer ihres Aufenthaltes in Nantes so angenehm wie möglich zu gestalten. Selbstverständlich wurden sie in den Gemächern des herzoglichen Schlosses untergebracht, aber zunächst einmal stand die Besiegelung der geplanten Geschäfte im Vordergrund. Denn die vereinbarte Hochzeit war so ein Geschäft, von dem beide Seiten profitierten, selbst wenn sich Maurice de Belville momentan benachteiligt fühlte. Auch bei Genéviève und ihm war es seinerzeit nicht anders abgelaufen. Beide hatten sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennengelernt, weil ihre Eltern ihre gemeinsame Zukunft vorab so arrangiert hatten.
Zur Unterzeichnung des Vertrages in Nantes waren außer dem Bischof die beiden Grafen, aber vor allem Herzog Jean III. anwesend. Mit versteinerten Mienen saßen die zwei Grafen auf ihren Stühlen, während Bischof Gautier de Rosanbo noch einmal in schönen Worten die Vorzüge und die Heiligkeit dieser Verbindung betonte. Der Herzog ging noch einmal auf das wichtige politische Moment für die Bretagne ein, das eine Blutsverbindung beider Häuser mit sich bringe und schloß seine Rede mit den Sätzen:
»Dies ist auch äußerlich ein Zeichen des Friedens und der Zukunft. Jeanne und Olivier werden durch ihre Kinder das Band, das uns alle zusammenhält, noch enger schnüren. Dies ist heute unerläßlicher denn je!«
Danach wurde das Pergament zuerst vom Bischof und dem Herzog, danach von den beiden Grafen unterzeichnet, anschließend besiegelt und beglaubigt. Bis dahin hatten Maurice de Belville und Guillaume de Clisson kein Wort miteinander geredet, und es sollte sich daran im Anschluß an die Unterzeichnung auch nichts ändern. Guillaume de Clissons Miene zeigte keinerlei Regung; einzig als die Sprache auf den Wald bei Paimpont kam, der von nun an sein rechtmäßiges Eigentum sein würde, zuckte sein rechtes Auge ein wenig.
Die beiden Grafen verabschiedeten sich wortlos voneinander, wobei sie sogar vermieden, sich anzusehen. Der Bischof weilte in Gedanken auch schon wieder bei seiner Kathedrale. Nur Jean III. zeigte sich von der Vereinbarung höchst befriedigt und lobte Maurice erneut für seine Einsicht ins Unvermeidliche. Für den Abend lud er dessen Familie zu einem großen Festessen auf sein Schloß ein. Maurice nahm die Einladung an und nickte schwach.
»Bon, mein lieber Belville! Dann kommt nun zu mir nach Hause und laßt Euch von meinen Dienern Eure Zimmer zeigen. Ruht Euch von den Strapazen der Reise aus. Wir werden uns am Abend bei fröhlicher Musik, erlesenen Speisen und bestem spanischen Wein wiedersehen.«
»Wird Clisson auch dabeisein?«
»Ich kann Euch voll und ganz beruhigen, Maurice. Ihr werdet den Grafen so schnell nicht wiedersehen. Ich selbst habe dafür Vorsorge getragen.«
Er knipste ihm ein Äugehen zu.
»Guillaume hat plötzlich geschäftlich in Vannes zu tun, wenn Ihr versteht?«
So ging man wieder auseinander. Maurice de Belville trat allein ans Fenster und blickte von dort auf das bunte Treiben in den Gassen hinab. Nantes, so hieß es, war der Nabel der Bretagne. Nur hier wurden Geschäfte größerer Ordnung gemacht. Nur hier wurde Politik betrieben, die das Gesicht des Landes bestimmte. Hier also würde seine Tochter Jeanne einmal wohnen, sobald ihr Mann Olivier de Clisson als Ritter von Nantes politisch installiert sein würde. Dahin gingen jedenfalls die weiteren Pläne des Herzogs. Ich selbst würde hier um keinen Preis leben wollen, entschied Maurice de Belville für sich. Er hätte sein Leben, das ganz auf seine kleine Welt, seinen engen Kreis daheim, für den er verantwortlich war, um nichts in der Welt aufgeben können, um im Zentrum der Macht aktiv zu werden. Schon hier im Palast des Bischofs störten ihn der Prunk und alles Herausgeputzte. Luxus hatte er immer abgelehnt, und Luxus war für ihn alles, was Pferd und Reiter nicht mehr tragen konnten. Arme Jeanne, dachte der Vater, du glaubst, ins Paradies zu kommen, und dabei wirst du in einer als Himmel verkleideten Hölle leben. Und dies alles für die Zukunft deines Landes!
Jahre vergingen. Jeanne wuchs heran und alle, die sie zu Gesicht bekamen, lobten ihre Schönheit, von der sogar einige Fahrensleute in ihren Liedern sangen. Im großen Saal des Schloßes Belville nahm das Leben wie eh und je seinen Lauf. Es wurden Audienzen abgehalten, mehrmals im Jahr tagte die Gerichtsbarkeit unter Vorsitz des Grafen, und weil Maurice seine Frau liebte, was nicht die unmittelbare Folge einer Hochzeit sein mußte, zeigte er sich ihr gegenüber mit den Jahren auch großzügiger. So konnte Genéviève daran gehen, längst gehegte Pläne zu verwirklichen. Sie bestellte Handwerker ins Schloß und ließ einige alte Mauerscharten durch Fenster aus Glas ersetzen. Wände wurde mit Heiligenbildern geschmückt, und die Fußböden bedeckten jetzt mehr Teppiche als noch in früheren Jahren. Sogar eine Kapelle wurde eingerichtet. Eigentlich war es nicht mehr als eine Andachtsstelle, aber um darin an jedem Morgen die heilige Messe zu feiern, hatte Maurice einen Schloßgeistlichen eingestellt, der für seine klerikalen Dienste Unterkunft und Verpflegung erhielt.
Für Jeanne bestellte ihre Mutter eine strenge Hofdame aus Nantes, die der Grafentochter den ›letzten Schliff‹ in Fragen Hofzeremoniell geben sollte. Dies behagte verständlicherweise Jeanne überhaupt nicht, die zwar längst nicht mehr auf Bäume kletterte – allein schon wegen ihrer dafür höchst ungeeigneten Kleidung –, die aber immer noch weit entfernt davon war, sich voll und ganz disziplinieren zu lassen. Ohne Wissen ihrer Eltern hatte sie sich vom Nachfolger des verschwundenen Stallknechtes Gaston Unterricht im Umgang mit dem Messer und von einem Soldaten im Umgang mit Pfeil und Bogen und dem Schwert erteilen lassen. Die beiden Männer riskierten damit Kopf und Kragen, aber sie hatten sich der schönen Grafentochter auch nicht widersetzen können. So lernte Jeanne mit Waffen zu kämpfen, eine Kunst, mit der sie wohl im ganzen Land einzig dastand.
Dieser Welt entgegengesetzt war die höfische, in der es gerade für zukünftige Fürstenfrauen um die Anordnung der Tafeln, die rechte Speisenfolge, die auf Hochwebstühlen gefertigten edlen Bespannungen aus Gold und Seide an den Wänden und in dafür ausgesuchten Gemächern ging. Jeanne lernte auch kennen, was auf einer langen Tafel aufgetragen werden mußte, wenn hoher Besuch ins Haus kam: nämlich goldenes und silbernes Geschirr, große und schwere Krüge, Schalen, Tiegel und anderes kostbares Geschirr mit Goldrändern und Edelsteinen, in denen die schönsten Speisen und Zwischengerichte, Weine, köstliche Fleischspeisen in reichlicher Menge dargereicht wurden. Der jungen Frau wurde ebenfalls des langen und breiten erklärt, woran man den guten Spielmann vom schlechten unterschied, und daß Frauen bei Tisch im Gegensatz zu den Männern kaum etwas zu sagen hatten. Auf keinen Fall durften sie den Anschein erwecken, als könnten sie in Fragen von Kriegsführung oder Politik irgend etwas Entscheidendes mitteilen. Sie hatten sich in erster Linie vornehm zurückzuhalten und dafür zu sorgen, daß alle sich im Hause wohl fühlten und daß bei großen Gelagen genügend Bänke, Stühle und Hocker vorhanden waren – abgesehen von Speis und Trank natürlich.
Jeanne hätte dagegen gern protestiert, sah aber auch ein, daß sie mit ihrer Meinung allein auf weiter Flur stand. Ihr Protest kam nicht so sehr von einer diesbezüglich verlaufenden Erziehung; nein, sie begehrte gegen diese Rolle allein deshalb auf, weil sie aus alten Geschichten, die bis in die Zeit der Kelten zurückreichten, erfahren hatte, daß Frauen sich auch ganz anders verhalten konnten, nämlich kriegerischer und an Entscheidungen aktiv mitbeteiligt.
So war es einstmals in ihrer Heimat zugegangen, bevor das Christentum von irischen Mönchen ins Land getragen worden war. Damals hatten Frauen noch Macht besessen, wirkliche politische Macht, aber die Missionare hatten aus ihnen Hexen gemacht, die vom Teufel beherrscht wurden. So war es auch Morgana ergangen, der keltischen Muttergöttin, die die Priester jetzt zur Dämonin abstempelten. Davon, daß es einmal ganz anders gewesen war, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft anbelangte, ging Jeanne aus, und warum sollte diese Zeit nicht wiederkommen können, überlegte sie. Aber sie sprach es nicht laut aus, denn für derlei Überlegungen hatte niemand in ihrer Familie Verständnis.
Und wenn Jeanne dann noch in Gedanken bei ihrem zukünftigen Ehemann verweilte, wurde sie darüber fast unglücklich, denn sie fühlte genau, daß Olivier nicht viel anders sein würde als alle Männer, die sie kannte. Zugegeben, man hörte viel Gutes über diesen jungen Mann, der sich vorgenommen hatte, die Franzosen in ihre Schranken zu weisen. Der Herzog förderte deshalb Olivier de Clisson über alle Maßen, hielt schützend seine Hand über ihn, und hatte Olivier schon in jungen Jahren zum Capitaine einer Truppe ernannt. Tolldreist und todesmutig waren Attribute, die dem Adeligen aus Clisson zugesprochen wurden. Solch ein Ritter würde sich unter keinen Umständen von einer Frau etwas sagen lassen, dachte Jeanne traurig. Folglich würde ihr weiteres Leben zwar prunkvoll sein, aber auch so todlangweilig wie das ihrer Mutter – Herrscherin über die Spinnerinnen und Weberinnen von Belville und immer dienstbar zugegen, wenn es um festliche Anlässe im Hause ging.
Jeanne hätte sich gern ein anderes Leben für sich gewünscht. Aber daß sie Olivier de Clisson würde heiraten müssen, das stand fest. Daran hätte nicht einmal sie zu rütteln gewagt. Und tief in ihrem Herzen bewegte sie ein hoffnungsfroher Gedanke, daß sie ihre Zukunft aufgrund der vollkommenen veränderten Umstände doch noch ein wenig in ihrem Sinne würde ändern können. Denn sie lebte ja in der Nähe der Hauptstadt oder sogar in Nantes selbst. Zweierlei hatte ihr damals an ihrer Reise dorthin besonders gefallen: der Trubel in der großen Stadt mit ihrem aufregenden Völkergemisch und das Meer.
Zum Meer hatte es sie zuletzt doch noch gezogen. Früher, als sie noch klein war, hatte ihre Mutter ihr an den Nachmittagen bretonische Märchen und Legenden vom Meer erzählt. So auch vom Untergang der Stadt Ys, die ganz im Westen unterhalb der Stadt Brest gelegen haben soll. Geschützt durch Schleusen, für die nur König Gradlon einen Schlüssel besaß, war sie so lange vor den Fluten sicher gewesen, bis Gradlons Tochter Dahud ihm den Schlüssel stahl. Damit öffnete sie heimlich die Schleusentore, um einen ihrer zahllosen Liebhaber in die Stadt hereinzulassen. So konnten die Gewalten des Meeres losbrechen und alle Bewohner, einschließlich der Königstochter verschlingen. Nur König Gradlon war das Schicksal gnädig. Er durfte sich aufs rettende Land flüchten. Soweit der dramatische Inhalt dieser Legende. Jeanne aber liebte es, immer wieder vom Untergang der Stadt Ys zu hören, weil ihr die Vorstellung eines tobenden und unaufhaltsamen Meeres gefiel. So stark und mächtig zu sein wie das ewige Meer, demgegenüber Menschen nichts waren als Blätter im Herbst, mit denen der Wind spielte, so wäre sie selbst gern gewesen.
Solcherlei Geschichten, die immer wieder vom todbringenden und zugleich lebenspendenden Meer erzählten, gab es zahlreiche in ihrer Heimat. Jeanne kannte sie mit der Zeit alle und wurde nicht müde, sie immer und immer wieder von Genéviève erzählt zu bekommen. Das Meer jedoch hatte sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr noch niemals gesehen. So fieberte sie der Erwartung entgegen, dies in Nantes endlich nachholen zu können.
»Wann fahren wir zum Meer? Heute noch? Aber spätestens doch morgen, oder?«
So drängte sie ihren Vater immer wieder, der andere Sorgen hatte, als mit seiner Tochter einen Ausflug an die Küste zu unternehmen. Aber Jeanne ließ nicht locker.
»Du hast es mir, als ich noch ein kleines Kind gewesen war, hoch und heilig versprochen.«
Und der Graf, dem die große Stadt an der Loire ohnehin wenig behagte und der zudem immer fürchtete, diesem Widerling Guillaume de Clisson doch noch zufällig über den Weg zu laufen, entschied plötzlich – auch zum Erstaunen seiner Gemahlin – daß sie alle ans Meer weiterführen, um von dort dann nach Hause zurückzukehren.
So war es gekommen, daß der kleine Troß der Belvilles, bestehend aus der Familie, einem Dutzend Rittern, einigen Dienern und Dienerinnen, von Nantes aufbrach, um bei dem kleinen Fischerort St. Brévin-les-Pins den Atlantik zu erreichen. Es war ein trüber Tag, an dem es unentwegt nieselte. Das Meer glich einer alten grauen Mutter und erschien dem Mädchen unendlich weit und leer.
»Manchmal ist es ein gewaltiger Höllenschlund, manchmal ein geheimnisvoller Smaragd, der ruhig daliegt und in der Sonne funkelt«, sagte ein Ritter mit schwarzem Bart, der zur Leibwache des Grafen gehörte und zufällig neben ihr stand.
Jeanne merkte sich seine Worte gut. Nicht viel anders dachte auch sie über das Meer, aber im Unterschied zu dem Mann, der sicherlich zu Land weder Tod noch Teufel fürchtete, gefiel ihr das Janusgesicht des Meeres. Sie hätte es nicht anders haben wollen, während in der tiefen Stimme des Ritters das Grauen vor der Allgewalt der See mitgeschwungen hatte. Jeanne nahm sich vor, später, sobald sie in Nantes oder Clisson lebte, immer wieder mal die Küste, die nur eine halbe Tagesreise entfernt lag, aufzusuchen.
Eine Überraschung wartete am Hafen auf sie. Herzog Jean III. hatte ihnen ein Schiff geschickt, das sie nach Le Croisic übersetzen sollte. Auf diese Weise würden sie sich einen großen Umweg ersparen. Maurice war von der Möglichkeit, sich mit einem Schiff aufs Meer hinauszuwagen, wenig begeistert. Im Gegensatz zu Jeanne, die sich völlig unbekümmert gab. Allerdings wollte der Graf vor seiner Familie und seinen Leuten nicht eingestehen, daß er Angst hatte. Und nachdem der Kapitän des kleinen Seglers ihm vertraulich mitgeteilt hatte, daß sie sich die gesamte Reise über immer in Küstennähe aufhalten würden, war er sogar als erster an Bord gegangen.
Die Schiffahrt dauerte nicht lange. Ein guter Wind trieb sie auf den Wellen dahin, und nur manchmal schäumte etwas Gischt über Bord. Jeanne juchzte dann jedesmal vor Begeisterung und versuchte mit der Zungenspitze das salzige Naß im Gesicht abzulecken. Ihr Vater dachte daran, daß sie am Abend ja endlich in Guérande ankämen, jener reichen Stadt, in der von allen Geschäften der Salzhandel am meisten florierte. Südlich von Guérande wurde das kostbare Gut in Salinen aus dem Meerwasser gewonnen. Jeanne hielt sich an der Reling fest und schaute aufs Meer hinaus.
»Gibt es auch Frauen, die ein Schiff lenken?« fragte sie ihre Mutter, die stumm und in sich gekehrt auf einer Kiste hinter ihr hockte. Nicht weit von ihnen schnaubten die Pferde. Es war sehr eng an Deck; Menschen, Tiere und Gepäck dichtgedrängt beieinander.
»Was? Was hast du mich eben gefragt«, schreckte Genéviève auf.
»Ob es Kapitäninnen gibt?«
Ihre Mutter starrte Jeanne an, als ob sie ein Gespenst erblicke. Doch ein Matrose hatte Jeannes Frage zufällig mitbekommen und lachte lauthals los.
»Bei Cernunnos, dem Gehörnten des Waldes, eine Kapitänin wäre wohl für jeden echten Seemann das Schrecklichste, was ihm zustoßen könnte. Dem Himmel sei Dank, daß es so etwas auf Erden nicht gibt!«
Und ihre Mutter merkte an: »Das war mal wieder einer deiner üblichen Scherze, Kind, nicht wahr?«
Jeanne schwieg. In einer Geschichte hatte sie von der Königin Botizäa gelesen, die vor Hunderten von Jahren eine ganze Flotte siegreich in den Krieg geführt hatte. Botizäa war eine Keltin gewesen und schon lange tot. Warum hatten sich zu ihrer Zeit die Männer nicht davor gefürchtet, von einer Frau geführt zu werden, die am Ruder stand? Heutzutage wurde sie allein eines Gedankens wegen fast als Verrückte abgetan und wohl nur deshalb nicht in Ketten gelegt, weil sie noch ein Kind war. Aber Jeanne war fest davon überzeugt, daß es Kapitäninnen, Frauen, die an Bord eines überwiegend von Männern geführten Schiffes das Sagen gehabt hatten, gegeben hatte. Aber auch das durfte sie nicht laut aussprechen.
Die nächsten fünf Jahre vergingen wie im Flug. Auf Schloß Belville kehrten meist über die Wintermonate fahrende Sänger ein und erzählten in schönen Versen von Liebe und Leid oder vom so anderen Leben der Menschen in fernen Ländern. Dies war in der kalten Jahreszeit schon fast die einzige Abwechslung im täglichen Einerlei. In den Sommermonaten hatte Maurice de Belville mitunter Turniere ausgerichtet, aber die kosteten von Jahr zur Jahr mehr Geld, weil den sich mit der Lanze um Ruhm und Ehre wetteifernden Rittern jedesmal hohe Turnierpreise winkten und man schon die besten von ihnen aufs Schloß holen mußte, um den Wettstreit so spannend wie möglich zu machen. Aber dies hatte seinen Preis, denn solche Ritter waren überall gefragt. Außerdem brachte jeder Ritter jedesmal seinen gesamten Troß mit, für den ebenfalls Quartier und Verpflegung bereitgestellt werden mußten.
Jeanne erblühte gänzlich zur jungen schönen Frau, deren Liebreiz in den Liedern der Sänger noch mehr zur Geltung gebracht wurde als in früheren Jahren. Die Tochter des Grafen hatte sich im Laufe der Zeit in ihr Schicksal gefügt, jedenfalls äußerlich. Alles, was eine junge Adelige, die in höchste Kreise einheiraten wollte, von ihren zukünftigen Aufgaben und Pflichten und ihrer neuen Stellung wissen mußte, war Jeanne durch ihre Gouvernante vermittelt worden. Sogar Spinnen und Weben hatte sie gelernt. Die junge Frau hatte diese typisch weiblichen Arbeiten ohne Murren über sich ergehen lassen. Als Ausgleich dafür hatte sie auch weiterhin heimlich mit dem Schwert, aber auch mit Pfeil und Bogen geübt, dessen Handhabung sie mittlerweile so gut wie ein Mann beherrschte. Zum Glück waren diese Übungen ihren Eltern verborgen geblieben, denn sonst hätten sie ihre Tochter vermutlich eingesperrt, argwöhnte sie.
Dann rückte unweigerlich der Tag ihres siebzehnten Geburtstages heran. Jeanne wußte, daß es jetzt bald ernst wurde, und eine bis dahin nicht gekannte Unruhe erfaßte sie zusehends. Wie würde nur alles werden? Der Herzog hatte es sich nicht nehmen lassen, ihre Hochzeit vorzubereiten. Diese sollte auf seinen persönlichen Wunsch hin in seinem Schloß in Nantes ausgerichtet werden. Guillaume de Clisson und Maurice de Belville hatten nur zögerlich zugestimmt, aber sie begriffen, daß Jean III. daran gelegen war, aus der Verbindung zwei der bedeutendsten bretonischen Adelshäuser ein großes politisches Ereignis zu machen. Jeder – vor allem die Franzosen – sollte erfahren, was damit auf sie zukam. Seinen Günstling Olivier de Clisson hatte er bereits auf der politischen Leiter nach oben steigen lassen.
Man schrieb das Jahr 1330. Drei Tage vor der Hochzeit reisten die Belvilles mit großem Troß an. Maurice wollte sich nicht lumpen lassen und den Clissons zeigen, daß außer ihnen auch noch andere im Land Geld und Ansehen besaßen. Nach wie vor hatte sich sein Groll auf Guillaume de Clisson nicht gelegt. Daß dieser alte Fuchs jetzt in seinem Wald bei Paimpont jagte, ließ ihn jedesmal die Galle hochsteigen, wenn er daran dachte. Aber der Graf nahm sich vor, während der Tage in Nantes dem alten Clisson nicht zu zeigen, wie sehr er unter diesem Verlust nach wie vor litt.
Aber zunächst liefen sich die beiden Familien in der Hauptstadt des Landes überhaupt nicht über den Weg. Jede traf ihre eigenen Vorbereitungen. Am Vorabend der Hochzeit wollte sich Jeanne frühzeitig in ihre Kemenate zurückziehen. Sie meinte müde zu sein, aber dann, als sie allein in ihrem kleinen Zimmer war, wurde sie erneut von innerer Unruhe und Anspannung ergriffen. Sie würde unter diesen Umständen nicht – oder nur sehr schlecht einschlafen können, entschied sie. So lief sie in dem engen Zimmer eine Weile nervös hin und her. Dabei fiel ihr Blick aus dem Fenster hinab auf die dunklen Gassen von Nantes. Wie wäre es, durchfuhr es Jeanne, wenn ich mich einfach unters Volk mischte und mir die Stadt am Abend anschaute? Vielleicht wird mich der Ausflug ein wenig von meiner Hochzeit ablenken?
Aber für Jeannes Vorhaben gab es zwei große Hindernisse. Zum einen war es für eine Person ihres Standes unmöglich, sich allein unter das Volk auf den dunklen Straßen zu mischen. Es hätte ihr dabei alles mögliche zustoßen können, wobei ein Raubüberfall noch das kleinere Übel gewesen wäre. Zum anderen war sie eine Frau. Also würde sie sich verkleiden müssen. Jeanne überlegte, ob sie ihre Dienerin Sophie, die etwa im gleichen Alter war wie sie selbst, in ihren Plan einweihen sollte. Wenn Sophie ihr ihre Kleidung auslieh, würde sie niemand erkennen. Aber war es wirklich ratsam, sich als Frau allein im nächtlichen Nantes herumzutreiben? Nein! Doch was wäre, wenn ich mich als Mann ausgeben würde? durchfuhr es sie plötzlich. Ja, das ist es! Jeanne eilte zu Sophie und bat sie, ihr rasch passende Männerkleidung zu besorgen. Die wiederum bekam große Augen und schaute ihre Herrin sowohl ein wenig ratlos als auch ängstlich an.
»Nun mach schon, Sophie! Ich will noch einmal hinaus, und niemand soll mich dort unten erkennen.«
Das Mädchen nickte brav und verschwand. Wenig später kam sie zurück und steckte Jeanne ein dickes Bündel Kleidung zu. Jeanne fragte, ob sie auch niemand dabei bemerkt hätte, was die treue Dienerin verneinte.
»Gut so! Ich ziehe mich jetzt um, und du schweigst über alles, verstanden?«
Wieder nickte Sophie brav, aber ihrem Blick war anzumerken, daß sie Jeannes Vorhaben mißbilligte. Wenn der Tochter des Grafen bei ihrem nächtlichen Streifzug etwas zustieß und man würde herausbekommen, daß sie ihr geholfen hatte, dann wartete die höchste Strafe auf sie. Soviel stand fest! Andererseits stand es ihr auch nicht zu, ihrer Herrin zu widersprechen.
So konnte Jeanne am Vorabend ihrer Hochzeit das Schloß des Herzogs doch noch unbemerkt und allein verlassen. Sie selbst sah aus wie ein junger Mann, zwar wie ein Diener nur, aber das war ihr ganz gleich. Am Tor hatte sie mehrere Wachen passieren müssen, aber die hatten sie nicht als Frau erkannt. Wie auch? Ihr langes Haar steckte verborgen unter einer engen Mütze und der Rest ihres schlanken, durchtrainierten Körpers in Männerklamotten. So verschwand sie vom letzten Tor des Schlosses aus, nachdem sie die Zugbrücke passiert hatte, in den lebhaften Gassen von Nantes.
Jeanne war wieder aufgeregt, aber diesesmal gefiel ihr das Gefühl. Es verhieß nämlich Abwechslung und Spannung, weil sie sich verkleidet dahin wagen konnte, wohin sie tagsüber nur in bewaffneter Begleitung hätte gehen können. Jetzt nahm kaum jemand von ihr Notiz. Mitunter mußte sie Betrunkenen ausweichen, die ihr zu nahe kamen, weil sie sabbernd und aggressiv um Geld bettelten, aber sie konnte solchen Belästigungen im letzten Moment immer wieder geschickt ausweichen. Zur eigenen Sicherheit hatte sie dennoch einen Dolch mitgenommen, den sie unter ihrem Wams verborgen hielt.
Während Jeanne durch die Straßen und Gassen ging, stellte sie fest, daß das einfache Volk doch erheblich freier im Umgang miteinander lebte als der Adel des Landes. Männer und Frauen in den Schenken behandelten sich gegenseitig sorgloser – und ohne jegliche Scham. Sie beobachtete Dirnen bei ihrer Arbeit, Männer, meist Seeleute, abzufangen, um sie gegen saftige Bezahlung zu Liebesspielen zu verführen. Manche gingen ihnen auf den Leim und verschwanden mit ihren Liebchen in stickigen Hinterstuben oder sie trieben es irgendwo am Ufer der Loire im Schutz der Dunkelheit. Solches Verhalten war Jeanne fremd, aber sie war darüber nicht entsetzt, wie es ganz sicherlich ihre Mutter gewesen wäre. Etwas geschockt zunächst ja, aber je länger sie sich in der Stadt umhertrieb, desto mehr war sie geneigt, das, was sie sah, als für Nantes typisch zu empfinden. So waren sie halt, diese Männer und Frauen, die nicht in großen Häusern lebten wie sie selbst. Sie waren zügelloser und fanden vielleicht darin den Ausgleich zum fehlenden Reichtum.
»Hallo, Jüngelchen«, wurde sie überraschend angesprochen. Jeanne war ziellos einer engen Gasse gefolgt und dabei an einem Eingang vorbeigekommen, der offenstand. In einer muffigen, mit allerlei Krimskrams zugepackten Stube hockte auf einem wurmstichigen Faß eine häßliche, krummnasige Frau. Ihre dicken Wulstfinger reckten sich Jeanne erwartungsvoll entgegen, ja schienen geradezu nach ihr greifen zu wollen. Erschrocken wich das Mädchen ein paar Meter zurück, blieb aber dennoch wie gelähmt stehen.
»Lauf nicht weg, Jüngelchen! Was für ein hübsches Gesicht du hast! Da werden aber die Mädchen ihre Freude an dir haben, nicht wahr?«
»Ich muß weiter«, stammelte Jeanne, der die Alte unheimlich war.
»Aber nicht so eilig, mein Freundchen! Ich tu’ dir doch nichts. Vor mir mußt du dich nicht fürchten! Ich bin Gillemette, die Seherin. Ich kann dir die Zukunft voraussagen, wenn du willst.«
»Meine Zukunft?«
»Aber sicher, mein hübsches Jüngelchen. Tritt nur herein und laß mich einen Blick in deine Handflächen werfen. Es kostet nicht viel. Nur einen Turnosgroschen, mehr nicht.«
»Nein, nein!« rief Jeanne erschrocken aus. »Die Zukunft soll man ruhen lassen. Was sollte ich von ihr wollen?«
»Aber, aber, Jüngelchen, vielleicht willst du erfahren, mit wem du einst glücklich sein wirst und wieviel Kinderchen sie dir schenken wird. Na, ist das etwa nichts?«
»Und das kannst du alles aus meinen Händen herauslesen?«
Jeanne wurde auf einmal neugierig. Zwar hatte sie von solchen Frauen gehört, aber bis dato noch keine von ihnen getroffen.
»Aber sicherlich, mein Jüngelchen! Wie gesagt, ich bin Gillemette, geh, und frag die Menschen draußen nach mir.
Sie werden dir bestätigen, daß ich mich niemals in meinen Voraussagen irre.«
Jeannes Interesse wuchs, trotz einer innerlichen Stimme, die sie warnte, sich nicht mit der häßlichen Vettel einzulassen.
»Zuerst das Geld!«
Gillemettes Wulstfinger griffen gierig nach der Münze, und dann steckte die Alte sie sich zwischen ihre gelben Zähne.
»Schmeckt fest und gut«, entschied sie und steckte danach das Geldstück in ihren schmierigen Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte.
»Gut so! Und jetzt zeig mir deine Hände!«
Jeanne tat wie befohlen.
»Hoho! Feine, feine Händchen hast du da. Mußt wohl nicht hart zupacken wie andere Burschen in deinem Alter, wie? Aber das soll mich nicht interessieren. Also, laß mal sehen ...«
Die Alte warf einen Blick in Jeannes rosige Handflächen. Dieser Blick war nur kurz, aber danach war die Alte wie verändert.
»Geh fort von mir!« rief sie aus und ließ augenblicklich Jeannes Hände los, als hätte sie Feuer berührt. Jeanne sah, wie entsetzt die Frau war. Die Augen traten ihr beinah aus den Höhlen, so als hätte sie was Entsetzliches gesehen.
»Was ist denn? Was siehst du darin? Sag es mir!«
»Blut! Nichts als Blut! Nur Blut! Du bist ein Mörder! An deinen Händen klebt das Blut von Hunderten! Geh fort!«
Und dann kreischte sie mit sich fast überschlagender Stimme: »Fort mit dir! Du bist der Teufel selbst. Dein feines Gesicht hätte mich warnen müssen. Geh fort und tu mir nichts ... bitte, ich bitte dich. Geh nur fort!«
Innerhalb von Minuten hatte sich alles umgekehrt. Jetzt war es Gillemette, die Angst vor Jeanne hatte. Die Alte ist ja verrückt, dachte Jeanne. Was faselt sie da von Blut? Ich habe doch noch nie jemandem etwas zuleide getan. Aufgewühlt verließ sie die Stube der Alten und rannte in die kühle Nacht hinaus. Dieser Ausflug war doch mehr, als sie im Moment verkraften konnte.
Kopflos lief das Mädchen eine Weile durch die Straßen der Stadt. Keuchend blieb es schließlich an der großen steinernen Brücke über die Loire stehen. Schwer atmend lehnte sich Jeanne gegen die Brüstung. Unter ihr floß der dunkle Strom, der wenige Kilometer entfernt in den Atlantik mündete.
Was für eine törichte Idee, mich hier nachts herumzutreiben, dachte sie traurig. Anstatt, daß es mich von den bevorstehenden Ereignissen abgelenkt hätte, bin ich nun vollends durcheinander.
Jeanne rieb sich erregt durchs Gesicht. Es wurde wahrlich Zeit, ins Schloß zurückzukehren. Die Frage war nur, wie sie den schnellsten Weg dorthin finden konnte. Sie entschied sie sich aufs Geratewohl und wurde schon wenig später in einen Straßenüberfall verwickelt.
Jeanne war gerade um eine Hausecke gebogen, als sie Zeugin eines heftigen Kampfes wurde. Er wurde zwischen acht Männern mit dem Schwert ausgetragen. Einige Minuten vergingen, bis Jeanne erkannte, daß sich hier drei gegen fünf zur Wehr setzten. Noch hatte man sie nicht bemerkt. Die drei waren zwar in der Minderheit und aus dem Hinterhalt überfallen worden, aber offensichtlich die besseren Kämpfer. Einer von ihnen, offensichtlich ihr Anführer, brüllte ab und zu taktische Anweisungen. Dieser großgewachsene Mann mit breiten Schultern und langem mittelbraunen Haar war ein äußerst geschickter Schwertkämpfer. Jeanne schaute ihm gebannt zu und bemerkte dabei nicht, daß sie plötzlich im Wege stand.
»He! Aus dem Weg, Junge!« rief ihr der Große zu.
Jeanne drückte sich behende weg. Da bemerkte sie, daß sich einer der Angreifer unbemerkt an den Großen herangeschlichen hatte. In seiner Rechten blitzte im fahlen Mondlicht ein Dolch auf. Offensichtlich wollte er den Mann von hinten erstechen. Ohne recht zu wissen, wie sie dazu kam, zog Jeanne ihren eigenen Dolch unter ihrem Wams hervor und schleuderte ihn mit einem gezielten Wurf auf den heimtückischen Angreifer. Sie traf ihn unterhalb des Schlüsselbeins. Der Mann stieß vor Schmerz einen langgezogenen Schrei aus, heulte danach wie ein getretener Hund und taumelte entsetzt zurück. Dabei griff er vergeblich nach dem Dolch, der in seinem Oberkörper steckte. Er schaffte es nicht, ihn herauszuziehen. Seine Kumpane hielten in ihrem Kampf inne. Jetzt merkte auch der Große, was vorgefallen war.
»Nichts wie weg hier!« hörte Jeanne die maskierten Angreifer rufen. Danach war hastiges Fußgetrappel auf den Steinen vernehmbar. Die fünf Männer entkamen in der Dunkelheit.
Die anderen drei atmeten tief aus, räusperten sich und schoben gelassen ihre Waffen in die Scheiden zurück.
»Da muß ich wohl jemandem ganz herzlich danken, was?« hörte Jeanne eine Stimme. Sie drehte sich um und sah den Anführer der kleinen Gruppe vor sich. Er roch nach Alkohol, was sie widerlich fand.
»Hast mir das Leben gerettet, Bursche. Wie du mit dem Dolch umgehst, alle Achtung. So einen wie dich könnte ich gut brauchen. Als Aufpasser für meine Zukünftige, mußt du wissen.«
Er lachte lauthals dabei, und seine zwei Freunde stimmten grölend ein. Jeanne bedauerte es schon, ihnen geholfen zu haben. Die drei benahmen sich wenig ritterlich.
»Ja, Bursche, da wird dir meine Braut aber mächtig dankbar sein. Andernfalls wäre sie nämlich überraschend Witwe geworden, ohne mich geheiratet zu haben. Eh! Geht das eigentlich, Freunde?«
Wieder lachten die drei, es klang dreckig, und Jeanne verzog angewidert das Gesicht. Wurde Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Zum Glück bedeckte in diesem Moment eine Wolke die Scheibe des Mondes, so daß Jeanne im Schutz der Dunkelheit entschwinden konnte.
»Ja, wo steckst du denn, mein Retter?« hörte sie den Großen noch rufen. »Laß mich dir dir wenigstens danken oder auch nicht, denn morgen heirate ich irgend so eine arme Schnepfe, und ob es da für mich nicht besser gewesen wäre, hinterrücks gemeuchelt zu werden, also, hicks, ich weiß ja nicht ...«
Jeanne hielt sich erbost die Ohren zu und rannte so schnell sie konnte zurück zum Schloß. Ein paar Umwege mußte sie dabei noch in Kauf nehmen, denn Nantes Gassen und Straßen waren labyrinthisch. Schließlich erreichte sie außer Atem, aber dankbar das Schloß des Herzogs. Dort war zum Glück ihr fast dreistündiger, höchst eigenmächtiger Ausflug unentdeckt geblieben.