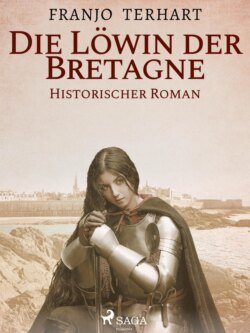Читать книгу Löwin der Bretagne - Historischer Roman - Franjo Terhart - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеUnd daran änderte sich auch in den nächsten Monaten und Jahren nichts. Im Gegenteil! Es kam alles noch viel schlimmer, als Jeanne es sich in ihren bösesten Alpträumen vorgestellt hatte.
Einige Tage nach der Hochzeit war sie zusammen mit Olivier, seinen Eltern und dem ritterlichen Troß nach Clisson geritten, wo sich die mächtigen Burgmauern des alten Clisson-Clans um sie schlossen wie das Maul einer Natter, die eine Maus verschlingt. Die Burg von Clisson war ein Meisterwerk der Verteidigung. Hoch oben auf einem Felsen errichtet, hatte sie Oliviers Vater in jüngster Zeit mit einer starken, fast dreißig Meter hohen Mauer umgeben lassen. Das dunkle Bauwerk besaß eine unregelmäßige Form, bewehrt mit vielen Rundtürmen, und war durch einen tiefen, aber nicht sonderlich breiten Graben vom Felsplateau abgeschnitten. Auch der Wohnturm – der Donjon – war erst vor wenigen Jahren erbaut worden. Mehreckig und mit einer Krone aus Pechnasen versehen, ragte er am Westrand der Burganlage wie ein uneinnehmbarer Klotz in die Höhe. In seinem Innern befanden sich zahlreiche Kammern und kleinere Säle, die selbst wiederum so angelegt worden waren, daß man sie auch dann noch mit einer Handvoll tapferer Männer gut verteidigen konnte, wenn der Feind bereits ins Innere der Burg vorgedrungen war. Aber das stellte von vornherein eine schier unlösbare Aufgabe für jeden potentiellen Angreifer dar. Die Burg der Clissons war einfach uneinnehmbar. So sicher man sich in ihren Mauern fühlen konnte, so begraben war man hier auch, wenn man sich in Clisson nicht freiwillig aufhielt. Jeanne litt unter der Kälte Oliviers und seiner arroganten Familie. Für letztere stellte die kleine Belville nichts anderes als eine gute Partie dar, weil durch ihre Heirat die Ländereien und der militärische Schutz zweier großer bretonischer Familien zu einem Ganzen vereinigt wurden. Aber von ihren Eltern sah und hörte Jeanne zunächst nichts mehr. Als hätte man ihnen verboten, ihre Tochter zu besuchen.
Allerdings hatte es im Ehevertrag einen ganz bestimmten Punkt gegeben, den man ihr lange Zeit vorenthalten hatte: So war es Jeanne nicht erlaubt, ihre treuen Dienerinnen mitzunehmen. Das war ein herber Schlag für sie, und er stürzte sie noch tiefer in Verzweiflung und Mutlosigkeit. In Clisson kannte sie niemanden, und es fand sich auch niemand, dem sie sich hätte anvertrauen können. Verlassen durfte sie die Burg anfangs auch nicht. Olivier hatte sich darüber besorgt gezeigt, daß ihr etwas zustoßen könnte. Das war natürlich eine Farce, denn als Jeanne daraufhin gefordert hatte, ihr doch bei einem Ausflug Männer zum Schutz mitzugeben, hatte seine Antwort gelautet:
»Das geht nicht, mein Herzblatt aus Belville. Ich kann dir keine Männer mitgeben, die auf dich aufpassen. Die werden alle zur Verteidigung der Burg benötigt.«
»Aber es herrscht doch gar kein Krieg«, empörte sich Jeanne.
»Es herrscht immer Krieg, meine Teuerste. Aber das wirst du als Frau wohl kaum beurteilen können.«
Er war ein Widerling, stellte sie verbittert fest. Ein abscheuliches Ekel! Was sie allerdings am meisten verwirrte, war die Tatsache, daß er bislang noch nicht mit ihr geschlafen hatte. Jeanne war auch in ihrer Hochzeitsnacht Jungfrau geblieben. Olivier hatte sie nicht einmal angerührt. Zwar hatte sie am anderen Morgen überraschend einen Blutfleck in ihren Laken entdeckt, aber wie er dort hingekommen war, blieb ihr schleierhaft. Vermutlich Schweineblut. So konnte sie nur vermuten, daß Olivier damit vortäuschen wollte, daß er sie ihrer Unschuld beraubt hatte, wie es einem Ehemann in der Hochzeitsnacht gebührte. Aber falls es wirklich anders gewesen sein sollte, so hatte sie nichts davon bemerkt. Was sie wiederum sehr verwirrte, weil ihre Mutter ihr noch wenige Tage vor der Hochzeit erklärt hatte, wie roh die Männer beim Akt vorgingen und daß sie selbst heute noch Schmerzen litte, wenn ihr Gatte von seinem Recht zum Beischlaf Gebrauch machte. Aber Olivier näherte sich ihr nicht in eindeutiger Absicht, und seit der Hochzeit in Nantes waren bereits Wochen ins Land gezogen. Was mochte das alles zu bedeuten haben? rätselte sie. Vielleicht bin ich in Wahrheit zu häßlich für die Liebe, durchfuhr es sie besorgt, und Olivier hat völlig recht mit seiner Abweisung.
Das alles bedrückte Jeanne sehr, und es gab niemanden, mit dem sie sich über ihr Leben hätte besprechen, geschweige denn austauschen können, wie es früher mit Mathilde, ihrer ersten Dienerin, häufig der Fall gewesen war. So verbrachte Jeanne ihre Tage damit, im Innern der großen Burg wie ein Tier im Käfig herumzugehen. Dabei machte sie die bestürzende Feststellung, daß alle Knechte, Dienerinnen, Soldaten, überhaupt jeder die Anweisung erhalten haben mußte, mit ihr nur das Nötigste zu sprechen. Und auch das nur, wenn sie allzu sehr darauf drängte. Keiner schien Zeit für sie zu haben, jeder ging ihr aus dem Weg, so als ob sie irgendeine schmutzige Aussätzige wäre. Das ertrage ich nicht lange, dachte Jeanne niedergeschlagen. Ob Olivier vorhatte, sie in den Wahnsinn zu treiben?
Jeanne hatte einmal von einem fahrenden Ritter gehört, daß im fernen Italien, wo die Sonne ewig schien, ein Graf seine untreue Frau dadurch bestrafte, daß er sie an jedem späten Nachmittag in einen Garten unweit des Schlosses schickte, den er eigens für sie hatte anlegen lassen. Dort mußte sie allein bis zum Morgengrauen bleiben. In diesem Garten, der von einer hohen Mauer umgeben war, hatten talentierte Steinmetze Felsen zu wahren Monstern und Schreckgestalten umgewandelt. Große Fischmäuler, Riesen, Hexenwesen und teuflisches Ungetier waren den Steinen durch den Einsatz von Hammer und Meißel entsprungen und wirkten täuschend echt. Ein schiefes Haus, in das man sich nicht flüchten konnte, weil man darin weder liegen noch stehen konnte, und der Eingang zum Höllenschlund krönten diesen Garten des steingewordenen Wahnsinns. Je tiefer jedoch die Sonne stand, desto mehr schienen ihre letzten Strahlen die steinernen Monster mit Leben zu erfüllen. Nachts, so fühlte die Frau, schüttelten sie ihre Starrheit ab und verfolgten sie unerbittlich, während sie blindlings und krank vor Angst durch diesen Garten des Grauens stolperte und entsetzliche Schreie vernahm. Dabei, so hatte der fahrende Sänger seine unheimliche Geschichte beendet, waren die furchterregenden Schreie der gepeinigten Frau, die sie da hörte, ihre eigenen, aber das wußte sie nicht.
Werde auch ich zuletzt meine eigenen Angstschreie hören und es nicht wissen? fragte sich Jeanne immer wieder, wenn sie am Fenster ihres Gemaches hoch oben im Donjon der Burg hockte und hinunter auf die Sèvre schaute. Wäre es da nicht weitaus besser für sie, sich in die Fluten des Flusses zu stürzen und ihr unwürdiges Leben ein für allemal zu beenden? Aber Jeannes innere Stärke hielt sie von diesem verzweifelten Schritt ab. Die Frage war nur, wie lange sie sich noch würde aufrecht halten können.
Hilfe erhielt sie überraschenderweise von Amaury, dem jüngeren Bruder ihres Ehemanns. Auch wenn es zunächst gar nicht danach aussah. Jeanne hatte den hochgewachsenen jungen Mann schon beim Tjost bewundern können, der am Tage nach dem hochzeitlichen Festbankett in Nantes abgehalten worden war. Amaury de Clisson war ein Ritter par excellence. Nicht nur hoch zu Roß machte er eine gute Figur. In Nantes fand sich niemand, der ihn beim Lanzenstechen aus dem Sattel hätte heben können. Mit dem Schwert ging er so gewandt um wie kein zweiter, aber seine eigentliche Stärke lag im Bogenschießen.
Seit Jahren schon waren die englischen Bogenschützen die besten weit und breit. Niemand auf dem Kontinent übertraf sie an Tapferkeit und Können. Die Franzosen fürchteten sie fast mehr als Aussatz. England unterstützte die Bretagne in ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit von Frankreich. Amaury war, was die Kunst des Bogenschießens anging, in England ausgebildet worden. Und auf dem Tjost stellte er sein Genie unter Beweis. Innerhalb von nur einer Minute schoß er sieben Pfeile in ein Ziel, das immerhin zweihundert Meter entfernt aufgestellt war. Das gelang keinem anderen. Und Amaury zeigte dem erstaunten Turnierpublikum, bei dem auch die einfachen Leute von Nantes auf Anordnung des Herzogs hatten zusehen dürfen, noch etwas weiteres Erstaunliches: Seine gestählten Pfeile durchschlugen auf kurze Entfernung ein mehrere Zoll dickes Eichenbrett, als wäre es aus Butter. Diese einzigartige Kampfkunst, gepaart mit Amaurys natürlicher Bescheidenheit, die sein Bruder Olivier so gänzlich fehlen ließ, hatten Jeanne tief beeindruckt.
Amaury de Clisson war noch immer ledig, aber man munkelte, daß er schon bald mit der schönen Julie de la Blandinaye verlobt werden würde: überraschenderweise eine Französin.
Diese letzte Tatsache trübte das Bild ein wenig, das sich Jeanne schon bald von dem großen, dunkelhaarigen Ritter – ihrem Schwager – gemacht hatte. Amaury, so befand Jeanne, war tapfer und stark, sittsam und trotz aller Talente bescheiden. Er hielt sich in Gegenwart anderer eher zurück und sagte nur dann etwas, wenn er sich sicher war, etwas Entscheidendes hinzufügen zu können. Er war galant und benahm sich Jeanne gegenüber anständig und gut. Amaury war der einzige aus der Familie der Clissons, der mit ihr im normalen Tonfall redete und sie zu respektieren schien. Alle anderen, vor allem ihr Ehemann, nahmen sie überhaupt nicht ernst. Jeanne fragte sich, warum Amaury sich ihr gegenüber so anders verhielt. Lag es daran, daß er sich von seiner Familie nicht beeinflussen ließ? War auch dies der Grund dafür, warum er eine Französin liebte, sie sogar heiraten wollte, auch wenn Frankreich der natürliche Feind aller Bretonen war? Was trieb ihn dazu?
Jeanne war nicht dumm. Auch wenn Amaury sie gut behandelte, ließ sie sich nicht dazu hinreißen, ihm mehr als dem Rest seiner Familie entgegenzukommen. Sie wollte erst abwarten, was weiter geschehen würde. Es konnte ja durchaus sein, daß der äußerlich so galant wirkende Ritter in Wirklichkeit noch viel durchtriebener und gemeiner war als ihr Gemahl. Alles nur Maske! Vielleicht war seine ausgesuchte Höflichkeit ja gerade die Falle, in die viele tappten, um danach bitter enttäuscht festzustellen, daß sie geleimt worden waren. Ich muß bei dieser Familie äußerst vorsichtig sein, redete sich Jeanne immer wieder ein. Sie war keineswegs unhöflich zu Amaury, aber sie ließ ihn auch spüren, daß sie ihm als Sproß seiner Familie nicht über den Weg traute.
An einem Nachmittag im August traf sie Amaury de Clisson überraschend auf dem Burghof. Niemand hatte sie über seine Ankunft unterrichtet, wie sie überhaupt über nur sehr wenige Dinge, die Clisson betrafen, im Bilde war. So wußte Jeanne auch nicht, was ihr Gemahl den ganzen Tag über so trieb. Meistens war Olivier unterwegs, und Jeanne hatte nur einmal bei einem Gespräch zwischen ihrem Schwiegervater Guillaume und einem Ritter, das sie ungewollt belauscht hatte, erfahren, daß sich ihr Mann überwiegend in Nantes aufhielt, wo ihn der Herzog mit allerlei wichtigen Aufgaben betraut hatte. Seit ihrer Hochzeit hatte sie Olivier nur noch zweimal gesehen; das letzte Mal sogar eher flüchtig.
Im Burghof gab es eine Stelle, die Jeannes Lieblingsplatz war: der Brunnen. Er war zwar auch Mittelpunkt für die Mägde und Wäscherinnen, die sich kichernd und schwatzend um ihn scharten, wenn sie Wasser holen gingen, aber es gab auch Stunden am Tag, wo der Brunnen, der die ganze Burg mit Frischwasser versorgte, verwaist dalag. Das in Marmor gefaßte Achteck war alt, und sein Schacht mußte von den ersten Erbauern der Festung unter großen Anstrengungen in den harten Stein gegraben worden sein. Und er war tief, so tief, daß einem schwindelte, wenn man sich über den Rand beugte, um hinab in die dunkle Tiefe zu schauen. Das Seil, an dem der Eimer hing, brauchte jedesmal lange, bis es das kostbare Naß am Grunde des Felsens erreicht hatte. Es war klares, kaltes Wasser, das sich offensichtlich aus einer Quelle speiste, die tief im Berg verborgen lag. Dort unten lebten die Feen des Wassers, erzählten sich die Bretonen, Wesen von großer Macht, die man niemals verärgern durfte. Als Jeanne ein kleines Mädchen gewesen war, hatte ihr ihre Großmutter von der mächtigen Fee Broella erzählt, die auf der Insel Ouessant ihr Unwesen trieb. Der Klang ihrer Stimme genügte, Männern den Verstand zu rauben, so daß sie sich kopfüber ins Wasser stürzten und ertranken. An diese Legende dachte Jeanne, als sie sich an diesem Nachmittag im Hochsommer wieder einmal sehnsüchtig über den Rand des Brunnens beugte.
»Bleiben Frauen denn von dir verschont, Broella? Oder solltest du gar einen Bruder haben, der mich rufen könnte?« vertraute Jeanne den Anderswesen in der Tiefe an. Sie hatte ihr morbides Verlangen eher geflüstert, war aber dennoch von einem Lebenden verstanden worden.
»Was meint Ihr damit, Jeanne? Und vor allem, mit wem redet Ihr überhaupt?« hörte sie plötzlich eine wohlklingende Männerstimme hinter sich.
Überrascht drehte sie sich um, und da stand Amaury vor ihr. Sein Lächeln war bezaubernd, und auch seine dunklen Augen, so abgrundtief wie die Seen in den Schwarzen Bergen Finistères, schienen nicht zu lügen. Amaury schien sichtlich erfreut, Jeanne zu sehen und lachte sie an. Verwirrt wollte sie davoneilen, aber der Ritter hielt sie am Ärmel fest.
»Bleibt doch, Jeanne! Ich bin erst vor kurzem überraschend eingetroffen. Alle haben mich nicht vor nächster Woche zurückerwartet. Und was finde ich also vor – ein fast menschenleeres Haus. Olivier weilt in Nantes, mein Vater ist irgendwo unterwegs und selbst meine Mutter habe ich im Wohnturm nicht angetroffen. Alle sind offensichtlich auf und davon. Aber Gott sei Dank seid Ihr ja noch hier in Clisson, und damit ist der Tag für mich gerettet. Wie geht es Euch? Erzählt mir, wie Ihr Euch bei uns zurechtfindet?«
Entweder ist er verrückt, ahnungslos oder der größte Heuchler aller Zeiten, dachte Jeanne. Sie nickte Amaury freundlich zu und wollte danach stumm weitergehen. Überrascht über ihr Verhalten, lockerte sich sein Griff. Enttäuscht blickte er sie an.
»Ihr lehnt mich ab, habe ich recht? Was habe ich Euch denn getan? Seid Ihr wütend auf mich, weil ich Euch am Brunnen belauscht habe, Jeanne? Dann entschuldigt! Es war nicht meine Absicht, aber ich sah Euch hier allein stehen, Selbstgespräche führen, und Gott soll mich strafen, aber Ihr seid das schönste Weib von allen, die mein Bruder jemals hätte zur Frau nehmen können. Ich weiß, Olivier ist anders als ich, nicht so aufgeschlossen. Aber er ist kein schlechter Mann, glaubt das nicht, Jeanne. Der Herzog hält sehr viel von ihm, und dies wohl auch, weil er sich so einen wie Olivier als Sohn wünscht. Ihr wißt ja, der alte Fuchs grämt sich ein Leben lang, weil er keinen Erben gezeugt hat. Aber sagt mir nur eines, Jeanne, dann will ich Euch auch demnächst aus dem Weg gehen, denn Euch scheint meine Gegenwart tatsächlich nicht zu behagen. So schweigsam, wie Ihr Euch gebt! Sagt mir, was Ihr durch mich Böses erlitten habt, daß Ihr mich derart zurückweist. Ich bitte Euch um dieses eine Wort nur.«
Jeannes Körper entspannte sich, aber sie schwieg auch weiterhin. Sie blickte Amaury jetzt offen in die Augen und sah darin etwas, was sie erneut verwirrte. Der Ritter schien sie wirklich zu mögen, und alles, was er sagte, entsprach der Wahrheit. Aber konnte sie ihren Empfindungen auch trauen? So entschloß sie sich zur Flucht nach vorn.
»Was ist das für ein übles Spiel, das Ihr mit mir treibt, Amaury de Clisson? Alle in der Burg gehen mir aus dem Weg. Keiner redet auch nur mehr als zwei Sätze mit mir. Meinen Gemahl sehe ich kaum, meine Schwiegermutter verachtet mich. Euer Vater hat mich noch nie danach gefragt, wie ich mich bei Euch fühle. Und jetzt tretet Ihr vor mich hin, Amaury, und tut so, als ob ich im Hause Eurer eitlen und hochnäsigen Familie wie in Abrahams Schoß ruhte und von allen wohlgelitten wäre. Warum verhaltet Ihr Euch nicht wie die anderen, spuckt vor mir aus und straft mich mit Hohn und Verachtung? Nichts anderes bin ich von den Clissons gewöhnt!«
Ihre letzten Worte hatte sie ihm ins Gesicht geschrien.
Ihr Schwager starrte sie entgeistert an. Dann umwölkte sich sein fein geschnittenes dunkles Gesicht. Er konnte und wollte nicht glauben, was Jeanne an ihm und seiner Familie auszusetzen hatte.
»Was redet Ihr da bloß, Weib? Hat Euch der Kellermeister etwa zuviel vom besten Wein meines Bruders eingeschenkt?«
Mißbilligend schüttelte Amaury den Kopf. Dann fuhr er fort: »Ich sehe nur, daß wir Euch wahrlich mit offenen Armen empfangen haben. Kein Zweifel: Mit Olivier habt Ihr einen guten Mann geheiratet, der noch Großes für sein Land vollbringen wird. Und um Euer seltsames Mißtrauen Olivier gegenüber vollends zu untergraben, so sollte Euch stets bewußt sein, Jeanne, daß nur Ihr die Mutter seiner Kinder sein werdet. Versucht Ihr mir also wirklich einzureden, daß er Euch mit Verachtung straft? Er wäre doch recht töricht von ihm, sein Weib wie einen Feind zu behandeln, wo er es braucht, um einen Erben zu erhalten!«
Jeanne verzog ungläubig die Mundwinkel über so viel dummes Geschwätz und wandte sich ein wenig von Amaury ab. Ihre Augen fixierten einen Punkt auf dem oberen Wehrgang der Ostmauer. Verzweifelt fragte sie sich, wie dieser aufrechte Ritter das, was sie fühlte und was wirklich vor sich ging, überhaupt würde begreifen können. Für Amaury war seine Familie heilig. Er hatte mit ihr keinen Zwist. Und auf einmal sah man in ihr diejenige, die allgemein Unruhe stiftete. Was für eine Verkehrung der Tatsachen!
»Ach, geht doch weit fort, Amaury, und laßt mich hier allein. Ihr versteht mich nicht, weil Ihr nicht mitbekommt, was ich täglich zu spüren bekomme, seit ich in Clisson bin.«
Die junge Frau seufzte und warf dabei einen flehentlichen Blick auf die hohen Burgmauern, die sie wie ein unnachgiebiger Wall umschlangen.
»Nicht einmal verlassen darf ich Euer Haus. Olivier hat es mir untersagt.«
»Es schickt sich nicht als Dame, die Burg ohne Begleitung zu verlassen«, entgegnete Amaury.
»Aber dort, wo ich herkomme ...«
»Dort, wo Ihr herkommt, Jeanne«, unterbrach er sie,»sind große Städte weit entfernt, und es streift nur wenig Gesindel umher. Hier bei uns ist das anders. Nantes ist nahe, und Nantes ist verlockend. Wer vom Süden her in die Hauptstadt will, durchquert nun einmal Clisson. Olivier ist nur besorgt um Eure Sicherheit. So und nicht anders solltet Ihr es sehen!«
Aber Jeanne schüttelte abwehrend den Kopf. Nein, so wollte sie die Dinge auf keinen Fall sehen. Nicht so beschönigend, wie Amaury sie darstellte. Sie war sich dessen ganz sicher, weil sie fühlte, was mit ihr geschah. Aber das war anderen nur schwer zu vermitteln.
»Bon, liebe Jeanne, ich verstehe nur zu gut, daß Ihr Zeit braucht, um Euch an das neue Zuhause zu gewöhnen«, lenkte Amaury ein. »Deshalb laßt uns jetzt von angenehmeren Dingen reden. Als Euer Schwager ist es mir nicht gleichgültig, wie es um die Zukunft der Clissons bestellt ist. Olivier hat den Anfang gemacht und Euch geheiratet. Ich will nicht aufdringlich sein. Aber eine Frau spürt doch, wenn sich ... etwas Neues in ihr regt.«
Jeanne starrte ihn entgeistert an. Sie ahnte, worauf Amaury anspielte. Zwar versuchte er sie auch aufzuheitern, aber mit seiner unverhohlenen Neugier brachte er nur das Faß zum Überlaufen. Jeanne schossen plötzlich Tränen in die Augen.
»Jetzt ist aber endgültig Schluß. Ich habe genug von Euch. Hört endlich auf mit dieser verdammten Freundlichkeit und stellt Euch nicht so ahnungslos! Euer Bruder ... Euer liebloser Bruder«, stammelte sie. »Ach, laßt mich, ich will nichts mehr davon hören«, rief sie schluchzend aus und rannte mit angehobenen Rocksäumen eilig davon.
Am Brunnen zurück blieb ein höchst beunruhigter Mann, der sich ernsthaft fragte, ob sein Bruder eine Frau geheiratet hatte, die im Kopf nicht ganz richtig war.
»Du tust mir leid, Olivier«, murmelte er und rieb sich die Nase. Dann holte er vorsichtig aus dem Holzeimer, der auf dem Brunnenrand stand, den mit frischen Quellwasser randvoll gefüllten Schöpflöffel, setzte ihn sich an den Mund und trank. Den letzten Rest verteilte er auf dem trockenen Boden. »Arme Jeanne«, murmelte er »Soviel Schönheit und so wenig Einsicht in die Dinge, von denen Menschen nun mal abhängig sind.«