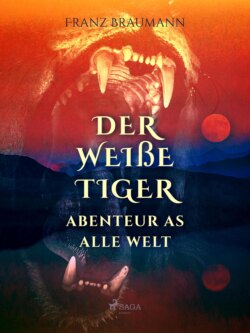Читать книгу Der weiße Tiger - Abenteuer aus aller Welt - Franz Braumann - Страница 6
Im Sertao verschollen
ОглавлениеBernd Hoyer konnte seine Erregung nicht unterdrücken, wenn er an die bevorstehende Reise dachte. Was er sich seit seinen Jugendjahren gewünscht hatte, wurde nun Wirklichkeit: Ein leichtes Ruderboot, eine Montaria, trug ihn den obersten Rio Cujaba aufwärts, dem Quellgebiet des Rio Xingu entgegen! Bernd Hoyer, der deutschstämmige Südbrasilianer, wollte zusammen mit dem jungen Völkerkundler Enrico Branco aus Rio zu der Serra do Roncador vorstoßen, jenem sagenhaften Bergland zwischen Rio Xingu und Rio das Mortes.
Zwei Tage lang waren sie mit ihrem Motorboot von Cujaba im Mato Grosso aus rasch nach Norden durchgedrungen. Dann hatte sich weit hinter der letzten armseligen Ufersiedlung die im Schlamm wühlende Antriebswelle verklemmt. Nach stundenlangen Reparaturversuchen gab man es auf, den Motor wieder in Gang zu bringen. Seither hatten die vier Männer der Expedition – zwei Caboclos, Torro und Camario, begleiteten die Forscher – nichts anderes mehr gesehen als Fluß, hohen Urwald und blaß verschleierten Himmel. Die Ruderer blickten schweigend die fast zugewachsene Wasserrinne entlang. Die Sonne mußte bereits tief stehen; Bernd Hoyer schaute nach der nächsten trockenen Sandbank für das Nachtlager aus.
Eine schmale Praia tauchte auf. Der Kiel knirschte über schlammigen Sand; Camario sprang ins seichte Wasser und zog die Montaria aufs Trockene. Am ersten Tag der Reise hatten die halbindianischen Caboclos kopfschüttelnd dem Aufbau eines Zeltes für die Nacht zugesehen. „Wozu tragt ihr ein Haus mit euch, Senhors? Es wird viele Wochen nicht regnen!“ hatte Camario gefragt.
„Wie schlaft ihr denn in der Nacht?“ fragte Bernd dagegen.
Torro kniete hin und wühlte mit den Händen einen grabenähnlichen Streifen in den trockenen Sand. Er warf den Poncho darüber, ließ sich in die Vertiefung fallen und deckte sich bis zum Gesicht hinauf zu. In der Tat, dies war die einfachste Art, sein Bett zu machen! Auch Bernd mußte zugeben, daß man darin weich und warm lag. Vielleicht gewöhnte man sich selber später einmal daran!
An diesem Abend sank rasch die Dämmerung herab. Während Camario im Kesselchen über einem kleinen Feuer die übliche Farinha kochte, schrieb Enrico Branco seine Eintragungen in das Tagebuch. Leichter Nebel stieg wie Rauch aus dem Fluß empor; ein Schwarm schwarzer, fasangroßer Jacus fiel krächzend in das Gestrüpp ein. Bernd hatte einen Augenblick nichts zu tun und starrte in das reglose Dikkicht des Dschungels. Seine Gedanken beschäftigten sich mit dem Menschen, den sie zu suchen ausgezogen waren. Er wußte zwar längst, was Mac Parkins in den Sertao der Serra do Roncador gelockt hatte, in dem er seit einem Jahr verschollen war. Mit Enrico hatte er jenes alte, geheimnisvolle Dokument gelesen, das als „Manuskript 512“ in der Bibliothek National in Rio de Janeiro aufbewahrt wird. Es handelte sich um das Logbuch einer portugiesischen Expedition, die im Jahre 1743 auf der Suche nach Gold in den Mato Grosso eindrang. Jenseits des Rio das Mortes entdeckte sie eine geheimnisvolle Bergkette. Auf ihrer Höhe ging sie in ein flachwelliges Tafelland über. Nach vielen Tagen tauchte vor der Expedition der Umriß einer Ruinenstadt aus massiven Steinblöcken auf. Die Ruinen waren unbewohnt. Man entdeckte Inschriften, die kopiert und zurückgebracht wurden; niemand vermochte die Schrift zu entziffern. Aus dem Sand eines Flusses wusch man soviel Gold, wie man mit sich tragen konnte. Die Regenzeit überfiel die Reisenden. Unter unsäglichen Schwierigkeiten wandte man sich zur Rückkehr. Erst Jahre später tauchten die letzten Überlebenden an der Küste um Bahia auf. Die „Goldstadt“ in der Serra do Roncador blieb unauffindbar bis heute. Kartographische Flugaufnahmen der letzten Jahre bestätigten nicht mehr als die Existenz eines niedrigen Bergzuges zwischen Rio Culuene und Rio das Mortes… – Bernd Hoyer hob den Kopf. „Parkins ist längst tot!“ sagte er laut. „Wer braucht auch ein Jahr für eine Strecke von vier- oder fünfhundert Kilometern! Wir finden höchstens ein Stück seiner Ausrüstung in einer Hütte der Cajapos-Indianer!“
Enrico Branco blickte auf. „Wir haben unsere Suchfahrt nach ihm lange genug überlegt. Einem Menschen in Not aber kann nie durch Reden geholfen werden. Dazu gibt es einzig nur die Tat!“
Sie stakten noch zwei Tage durch den Dschungel. Das Blätterdach war längst über dem schmalen Wasserlauf zugewachsen. Dann war die enge Fahrrinne endgültig zu Ende. Die mühevolle Arbeit mit der Machete begann. Keiner hätte gehofft, daß man bereits am Ende des ersten Tages im Dschungel freieres Gelände erreichte. Auch das dornige Buschgestrüpp lichtete sich und gab schmale Streifen roten Bodens frei, auf dem mannshohes, scharfrandiges Pampagras wuchs. Bernd entdeckte einen höher gewachsenen Baum und konnte den untersten Ast fassen. Eintönig dehnte sich eine leicht wellige Landschaft gegen Osten hin. Das gelbe, dürre Gras zwischen dem Gestrüpp wehte in dem heißen Lufthauch wie ein reifes Roggenfeld. Hinter ihm im Westen verdichtete sich das Buschwerk zur dunklen Dschungelmauer, aus der sie gekommen waren.
„Wir werden überraschend leicht vorankommen!“ sagte er unten zu den Wartenden. „Heute können wir noch eine Stunde marschieren.“
Camario und Torro folgten mürrisch. Seit man das Boot zurückgelassen hatte, mußte die Ausrüstung getragen werden. Auf dem Marsch gab es genug Hindernisse. Das hohe Gras nahm alle Aussicht. Dornige Büsche krochen wie Fußangeln über den struppigen Boden. Wer stürzte, riß sich Hände oder Gesicht blutig. Dazu wehte jetzt der ständige Banzeiro unerträglich heiß aus Norden.
„Diabolo! Ich habe es satt für heute! Wieviel Stunden soll noch marschiert werden?“ stöhnte Camario und warf die Packen ab.
Ehe Bernd ein Wort sagen konnte, faßte Enrico den Caboclo am Kragen und riß ihn hart empor. „Du bist aufsässig, scheint es mir! Wir zahlen euch besser, als ihr je einmal verdient habt. Dafür erwarte ich Gehorsam! Oder kehrt ihr lieber um?“
Diese Art der Behandlung schien auf die Caboclos Eindruck zu machen; schweigend gehorchten sie. Bernd wäre für sanfteren Umgang gewesen. Enrico aber reiste nicht zum erstenmal im Mato Grosso. Dieser Abend verlief sehr schweigsam.
Das mitgeführte Wasser war für drei, im äußersten Fall fünf Tage berechnet. Dann mußte man nach der photogrammetrisch aufgenommenen Landkarte auf eine Lagune oder einen neuen Wasserlauf treffen. Die Karte erschien allerdings nicht sehr zuverlässig.
Am dritten Tag der Wanderung tauchte in der Ferne ein geschlossener Buschstreifen auf. Er lief von Norden nach Süden quer zu der Marschroute der kleinen Expedition.
„Wo Wald wächst, gibt es Wasser!“ sagte Bernd zufrieden. „Die Wanderung läuft überraschend programmäßig ab!“
Die Entfernungsschätzung trog jedoch sehr. Bis sich der Sertao zum Galeriewald verdichtet hatte, fiel auf einen Schlag die Dämmerung herab. Bernd schlug sich noch, zornig und begierig auf Wasser, fünfzig Schritte tief einen Pfad durch den Dornbusch, dann gab er es auf. Er kehrte mißmutig zu dem Platz zurück, auf dem die Caboclos ihre Packen hingeworfen hatten. Enrico schrieb schon wieder. „Wo stecken Toro und Camario?“ fragte Bernd.
„Sie sammeln Holz fürs Kochfeuer.“
„So weit fort?“ Bernd konnte sie nirgends sehen. Er horchte.
Da kamen sie erregt zurück. „Dort drüben sind Spuren zu sehen, Senhors. Indios sind in der Nähe; vielleicht haben sie uns bereits entdeckt! Die Cavantes sind gefährlich – töten jeden Weißen!“
Enrico war aufgesprungen. „Was? So bald hätte ich sie nicht erwartet!“ Er fuhr mit der Hand durch die Luft. „Ich kenne ihren Dialekt und muß sie finden. Wir sind keine landgierigen Estancieros, die die Indios mit gemeinsten Mitteln vernichten. Sobald ich mit ihnen spreche, sind wir Freunde!“
Torro zischte haßvoll: „Diese Wilden sind keine Menschen! Sie stehlen Vieh und sind heute noch Menschenfresser!“
Enrico schüttelte verächtlich den Kopf. „Das ist die Propaganda eurer reichen Herren – und ihr Armen plappert sie nach!“
Er befahl Camario, ihn zu führen. Es war nur ein Zufall, daß sie nicht sofort auf die Spuren in der sandigen Mulde gestoßen waren. Von hier schien ein Pfad zu einem noch unsichtbaren Wasser zu führen. Es war jetzt fast dunkel – Enrico konnte die Spuren von fünf oder sechs Erwachsenen feststellen. Wie alt die Spuren waren, ließ sich nicht schätzen. „Vielleicht kommen sie wieder!“ sagte der Forscher später. „Sie müßten auch Parkins gesehen haben!“
Aus den Augen der Caboclos sprach die nackte Angst, während sie vor dem kleinen Feuer saßen. Sie wickelten sich bald abseits in ihre Ponchos und flüsterten erregt miteinander.
„Sollen wir wachen?“ fragte Bernd. Auch ihm war unbehaglich.
„Indios schlafen in der Nacht!“ lachte Enrico. „Sind sie Christen, meiden sie uns aus Furcht; sonst fürchten sie den großen Vater der Nacht. Außerdem sind diese Cavantes längst weit weg!“
Sie krochen in das schmale Zweimannzelt und schliefen unbehelligt die ganze Nacht hindurch.
Bernd erwachte als erster. Durch den Spalt im Zeltverschluß fiel ein Streifen Sonne. Ihrem Winkel nach stand sie schon ziemlich lange am Himmel. Er horchte; auch die Caboclos regten sich noch nicht. Faule Bande! dachte er zuerst. Aber vielleicht waren sie bereits fort – auf der Suche nach Wasser? Leise, um Enrico nicht zu wecken, schob er sich ins Freie.
Größter Frieden ringsum! Die Asche des abendlichen Feuers lag kalt; kein gesammeltes Brennholz – nicht einmal die Dose mit Farinhamehl stand daneben. Und drüben das niedergedrückte Graslager der Caboclos war verlassen – leer.
Leer? Ein unheimlicher Verdacht überfiel ihn. Er lief hinüber, rief: „Hallo, Camario, Torro – wo steckt ihr?“
Enrico schob gähnend den Kopf aus dem Zelt. „Wo werden sie sein? Sie sind zum Wasser gegangen! Alle haben wir Durst!“
„Die Wassertasche liegt noch dort!“ stellte Bernd fest.
Enrico stand mit einem Satz auf den Beinen.
„Dann sind sie…“
„Fort – getürmt vor den Cavantes!“
Enrico und Bernd blickten sich fragend an. Sollte dies das Ende der Suchfahrt nach Mac Parkins sein? Was blieb ihnen noch für eine Wahl, nachdem sie keine Träger, kein Koch, keine Bootbauer, keine Meister des Pfadschlagens im Dschungel mehr begleiteten? Denn einholen oder gar zur Umkehr zwingen ließen sich die Geflüchteten sicher nicht mehr!
Enricos Gesicht verhärtete sich. „Wir geben nicht auf!“
„Ich gehe mit!“ Bernd fand nicht mehr Worte in dieser Situation, die, an der dunklen Zukunft gemessen, ernst genug erschien.
„Hallo, Enrico, auf! Wach schnell auf!“
Als der Forscher herumfuhr, kniete Bernd gebückt neben ihm und starrte verstört in die Richtung der Lagune, die sie nach acht Tagen völlig erschöpft entdeckt hatten. Hätten sie den flachen Wassertümpel verfehlt, wäre wohl bald die Sonne zum letztenmal über die zwei Lebenden im trockenen Sertao heraufgestiegen. So aber hatten sie getrunken und wieder getrunken und wegen der Moskitoplage am Wasser ihr Zelt etwas abseits im dichten Dorngebüsch aufgestellt.
„Hörst du sie – jetzt wieder!“ flüsterte Bernd.
Von irgendwoher außerhalb der Lagune kam ein Gekreisch wie von den großen Aras im Dschungel des Rio Culuene. Der Lärm näherte sich – einzelne Rufe – menschliche Stimmen!
Bernd hatte nach dem Gewehr gegriffen. Enrico fiel ihm in den Arm. „Was fällt dir ein – wir müssen ihnen unsere friedliche Absicht beweisen!“
Das dichte Blätterwerk jenseits der Wasserstelle schob sich auseinander. Ein Kopf erschien, ein zweiter – bald wimmelte die Lagune von Indianern.
Eine ganze Sippe schien sich auf dem Jagdzug zu befinden; die Männer trugen Speere und Bogen als Waffen mit sich. Die Frauen schleppten in geflochtenen Bastmatten ihre Säuglinge auf dem Rücken. Es war nicht zu erkennen, ob das Volk nur Wasser schöpfte oder sich häuslich niederlassen wollte.
Die Cavantes fühlten sich völlig unter sich und ungefährdet, sonst wären sie nicht ohne Erkundung an die Lagune gekommen. Sie hatten keinen Blick für die Umgebung. Selbst das Zelt war ihnen entgangen. Sie schnatterten mit unverständlichen Lauten.
Die zwei Lauschenden kauerten noch immer im offenen Zelt hinter dem Gitter der dornigen Büsche. Enrico horchte angestrengt, um einige Worte zu verstehen. Er hatte jahrelang Indianer-Idiome studiert und seine Doktorarbeit über sie geschrieben.
In diesem Augenblick wurde es drüben still. Einige Indios beugten sich nieder – sie hatten die Abdrücke von Schuhen entdeckt!
„Raggat, raggat!“ verstand Enrico aus dem Geschnatter.
„Jetzt aber auf und hinaus!“ drängte Enrico Branco.
Es war bereits die höchste Zeit. Die Cavantes formierten sich hinter einer Phalanx von Speeren und starrten auf das Zelt, aus dem eben Enrico geschnellt war. Er stand ohne Waffen und winkte mit beiden Händen. „Amigos – amigos! Freunde, Freunde sind wir!“
Die Cavantes starrten verblüfft auf den Weißen. Ein einzelner „Großer“ im Sertao? Da schlüpfte auch Bernd aus dem Zelt – das weckte ihr Mißtrauen von neuem.
Enrico wußte, daß es rasch handeln hieß, um den Überraschungsmoment auszunutzen. Wie gut, daß er stets in der Tasche eine Schachtel mit Nadeln und Klammern mit sich trug, wie es ihm der amerikanische Missionar am Rio Cujaba geraten hatte. Er trat aus dem Dickicht und hielt sie den Indios entgegen. „Ich vertausche das alles – was gebt ihr mir?“
Die Kinder und Frauen waren wie ein Blitz verschwunden. Die Männer zögerten noch – kletterten noch mehr „Große“ aus dem Zelt? Bekleidete Weiße schienen ihnen nicht mehr fremd, nur gefährlich zu sein.
Enrico hatte sich inzwischen den vorderen Cavantes genähert. „Amigos, amigos – bem, bem!“ versuchte er beruhigend einige portugiesische Wörter anzubringen. „Ich suchte euch schon lange, fragen will ich euch etwas – perguntar!“
Ein alter Cavante, der ein paar Fetzen Kattun am Leib trug, wies auf ein Kreuz an einem Lederstreifen um den Hals. „Missao?“ fragte er. „Missao, bem – gut!“
Er hielt Enrico für einen Mann der Mission – nicht des oft gefürchteten Indianer-Schutzdienstes –, das erleichterte die Sache. Branco ließ sich auf dem Sand nieder und bedeutete auch Bernd, es zu tun. Es konnte ihr Tod sein – ein Stoß aus zehn Speeren – vorbei! Aber Enrico wagte es – und überzeugte! Die erhobenen Speere sanken nieder, der alte Indio folgte seinem Beispiel.
Bernd verstand kein Wort von der Unterhaltung, die jetzt begann. Ab und zu ließ Enrico eine Erklärung fallen: „Sie haben Mac Parkins gesehen – als Doktor bot er sich an –, er muß es gewesen sein! Nein – er ging nicht dorthin, sondern dahin!“
Viele redeten jetzt durcheinander, fragten, forderten – der Fremde, der vor einem Jahr vorbeigekommen war, interessierte sie nicht lange. Sie wollten Geschenke – kaufen – tauschen!
Enrico Branco wußte aus seinem Indianerstudium, daß es gefährlich war, unzivilisierten Indianern Geschenke zu verteilen. Sie wollten mehr, immer mehr, ihr Besitzhunger erwachte – und wenn es keine Geschenke mehr gab, rissen sie dem wehrlos ausgelieferten Weißen oder Caboclo die Kleider vom Leib; und wenn sie ihn nicht gar töteten, ließen sie ihn ausgeplündert liegen.
„Ich verkaufe – was gebt ihr mir zum Tausch?“ Endlich konnte er sich mit einigen Worten verständlich machen.
Sie brachten Lanzenspitzen zum Vorschein, Ketten aus Sykomorenkernen, sogar eine getötete Eidechse, die noch nicht gebraten war. Enrico feilschte lange zum Schein, ehe die Waren ihren Besitzer wechselten. „Sie müssen uns den Weg führen, den Parkins fortwanderte!“ raunte er Bernd zu. „Pack unauffällig das Zelt zusammen!“
Das gelang nicht „unauffällig“ – er wurde bedrängt, auch dieses zum Tausch zu geben. Ein Cavante bot dafür Speer und Bogen. Bernd antwortete nur immer: „Nao bem – nicht gut!“ Sie verstanden ihn sicher nicht, höchstens seine deutliche Handbewegung.
Enrico hatte es erreicht, daß ihm drei Cavantes den Weg zeigen würden, den Parkins gegangen war – gegen drei Taschenmesser mit Kunstharzgriffen.
Lange begleitete sie der ganze Schwarm. Allmählich blieben die Cavantes zurück, als es nichts mehr einzutauschen gab. Die drei indianischen Führer gingen so rasch, daß die Forscher kaum mit ihnen Schritt halten konnten. Sie fanden Durchschlüpfe durch dornige Knüppelhecken, an denen sich die Weißen endlos mit dem Messer abgemüht hätten. So brachten sie eine Strecke hinter sich, die mindestens zwei früheren Tagesstrecken entsprach.
Die Sonne lag auf einer fernen Bodenwelle, als die Cavantes anhielten und ihren Lohn begehrten. Enrico zahlte und fragte sogleich: „Bleibt noch einen Tag bei uns! Ich zahle doppelt!“
Sie schüttelten die Köpfe. Wozu? Sie hatten, was sie erstrebten; mehr konnten sie sich nicht vorstellen. Enrico umarmte die „Freunde“ der Reihe nach; Bernd galt ihnen wahrscheinlich nur als Diener, und sie beachteten ihn nicht. Einige gezischte Laute, ein Rascheln im hohen Gras – der Sertao hatte sie verschluckt.
Wieder lag der gelbe Sertao viele Tage ausgestorben da. Die Landkarte konnte längst nicht mehr stimmen. Es war unmöglich, auf ihr richtige Standorteintragungen durchzuführen. Wo es eine Lagune geben sollte, war nur dürres Land; wo eine Erhebung angedeutet war, lag der Boden platt wie eine Tenne.
Und dennoch hatten sie bis jetzt Glück gehabt und nach mehreren Tagesmärschen jedesmal wieder Wasser gefunden. War es auch faulig und warm, sie hatten die Angst vor Infektionen verloren. Sie tranken nach einer ganz gewöhnlichen Filterung jedes Wasser. Der Proviant war längst zu Ende. Man hatte von vornherein geplant, daß man auch von dem leben wollte, was der Sertao hergab. Die Caboclos sollten täglich auf Jagd ausstreifen, während die Forscher ihre Eintragungen schrieben, Kartenmaße verglichen, die Spurenzeichen Mac Parkins ordneten.
Die Caboclos – Bernd Hoyer lachte bitter – hatten umsonst die Hälfte ihres Lohnes im voraus erhalten! Der Sertao gab so wenig her, daß die Reisenden fast ständig hungerten – ein Hokko-Vogel, eine Juba, krächzende, uralte Aras und einmal nur ein Veado, ein mageres, zartes Reh. Der Sertao entließ seine Bewohner nie aus der Drohung des Hungers!
Eines Tages erschien in der Ferne ein blasser Höhenzug. Er lief von Südwest nach Nordost und schnitt die Linie ihres Vormarsches, die sie seit der Führung durch die Cavantes eingehalten hatten. „Die Serra do Roncador?“ fragte Bernd überrascht.
„Es müssen die ‚Schnarchberge‘ sein“, Enrico zog sein Fernglas – er konnte nur eine eintönig hinlaufende Höhenwelle erkennen, kleine Felswände, Zacken, die nie eine Stadt hätten vortäuschen können. „Die Portugiesen haben 1743 phantasiert, als sie diese Berge zum erstenmal sahen!“ lachte Bernd bitter.
„Sie kamen von Osten, wir aus Westen. Vielleicht fallen die Berge felsartig zum Rio das Mortes ab!“ warf Enrico ein.
„Es gibt keine vorgeschichtliche Stadt dort drüben – alles abenteuerliche Märchen!“ Bernd redete sich diesmal in Zorn.
„Wir suchen nicht die sagenhafte Stadt, die Parkins finden wollte; wir forschen nur nach ihm selber!“
Bernd lag eine Entgegnung auf der Zunge. „Der Sertao hat ihn längst verschlungen“, wollte er widersprechen – da blieb er überrascht stehen. „Siehst du dort drüben vor den Bergen den Rauch!“
Auch Enrico erkannte schwärzlichen Qualm hinter dem milchig dunstigen Schleier, der den Sertao bedeckte, seit der Banzeiro eingeschlafen war. „Wo Rauch ist, gibt es auch Feuer! Und Feuer kann nur von Menschen stammen!“ sagte er erleichtert. „Wir sollten von der Marschrichtung abbiegen und nach Südosten in Richtung des Rauches wandern!“
„Du willst die Cavantes einfach aufsuchen?“ fragte Bernd betroffen. Er war nicht frei von Unbehagen vor den Wilden.
„Wer sonst kann mir über Parkins Auskunft geben? Wenn die Indios wollten, hätten sie uns schon längst stillgemacht!“
Bernd blickte um sich – das mannshohe Pampagras, das Dorngestrüpp hätte zu jeder Zeit ein Anschleichen der Indianer ermöglicht – falls nicht überhaupt das Land vor der Serra völlig menschenleer war!
Sie markierten den Punkt ihrer Abzweigung von der Route auf der Karte. Jetzt hatten sie wieder ein Ziel, ein nahes, sichtbares Ziel! Ihr Interesse, ihre Lebensgeister erwachten neu.
„Der Rauch breitet sich aus!“ stellte Bernd fest.
Er nahm tatsächlich gegen Süden und Norden hin zu. Ein leichter Südwind wehte herüber – jetzt bekamen sie den ersten Brandgeruch in die Nase. Enrico wurde blaß.
„Sie brennen den Sertao nieder!“
Bernd lief bis zu einem niedrigen Dornbaum, von dessen Ästen er sich einen Ausblick über das hohe Grasmeer hinaus erhoffte. Er riß sich die Hände wund, bis er endlich oben stand. Als er das Fernglas an die Augen hob, lief ihm ein Schauder über den Rücken hinab.
Soweit er den Sertao im Süden überblicken konnte, wogte eine schwarze, niedrige Rauchwolke auf und wälzte sich langsam aber unaufhaltsam gegen Norden. Der Brand fraß sich mit unheimlicher Breite in drohend düsterer Farbigkeit durch das gelbe Pampagras heran.
Sie waren unwillkürlich wieder in die alte Marschrichtung eingeschwenkt. Der heimlich drohende, unangenehme Brandgeruch nahm zu. Er erfüllte beißend die Luft. Wo das Gras niedriger wurde und einen Ausblick freigab, konnten die Dahinhastenden jetzt schon deutlich im Süden aufzüngelnde Flammen sehen. Die Brandwolken hatten bereits den halben Himmel überwallt und verfinsterten die Sonne. Wie ein glutroter Ball flammte sie durch die grauen Schwaden, die in der Höhe über die Fliehenden hinhuschten. Aus dem hastenden Gang war ein keuchender Lauf geworden. Sie rannten an der Front der heranrollenden Feuerwalze entlang um ihr Leben.
Enrico warf seine Traglast ab. „Wir müssen ein Gegenfeuer anzünden!“ Bernd verstand ihn sofort. Bei Camp- und Pampasbränden im Süden Brasiliens halfen sich manchmal die Hirten der großen Rinderherden, indem sie eine runde Campfläche niederbrannten und auf den verkohlten Platz die Tiere vor dem Feuer retteten.
Das Feuer schoß im wachsenden Wind vor ihnen empor und breitete sich schnell gegen Norden aus. Die Glut des Bodens strahlte schwelende Hitze aus. Die Männer mußten zurückweichen und standen nun zwischen zwei Feuern.
Sie hätten dieses Rennen verloren, wäre nicht der Südwind plötzlich eingeschlafen. Die Flammenfront im Süden rückte langsamer vor. Der Funkenflug sank ab – plötzlich fielen einzelne schwere Regentropfen, die zu einem schauerlichen Wolkenbruch anwuchsen. Blitze fuhren über den verdüsterten Himmel, Donner krachte. Das warme Regenwasser lief den Schutzlosen über Genick und Rücken hinab.
Sie sammelten lachend die Wasserflut und tranken, tranken.
Der Brand im Sertao lag drei Tage weit hinter ihnen. Die Serra do Roncador hatte sich in der Nähe als ein Hügelzug erwiesen, der quer gegen Osten hin von dicht mit Busch verwachsenen Tälern durchschnitten war.
Die Reisenden wandten sich dem nächsten Einschnitt zu – sie suchten Wasser! Alles Interesse an sagenhaften Städten war erloschen vor dem Durst.
Jetzt hatten sie endlich den Rand einer Senke erreicht! Der Busch stand so dicht, daß man keine Hand dazwischenschieben konnte. Und irgendwo weit unter ihnen – das Wasser!
Enrico lächelte bitter. „Wer schlägt uns einen Pfad – ich kann es nicht mehr!“
Bernd ließ sich nieder. „Schlafen wir doch, wo wir stehen; ich kann die Arme kaum mehr heben!“
Doch da war der Durst – die Hoffnung, ihn zu stillen!
Sie tasteten sich in der rasch sinkenden Dämmerung an der Wand der Büsche entlang – wozu nur –, hofften sie denn auf einen Pfad der Indianer? Sie hatten längst alle Vorsicht abgelegt. Als sie in ein Dorngestrüpp gerieten, das kein Ende mehr zu haben schien, blieben sie schließlich liegen. Sie schliefen fast im selben Augenblick ein.
Vogelgeschrei weckte sie am Morgen. Vögel suchten stets die Nähe des Wassers! Die Schläfer fühlten sich gekräftigt und fingen an, sich einen Durchstieg in das harte Strauchgewirr zu schneiden. Sie erkannten, daß sie schnell tiefer kamen.
Als Bernd einen Ast vor sich fortstieß, klatschte unter ihm Wasser auf. Es gab keinen offenen Wasserlauf; er war unter niedergesunkenen Bäumen und wuchernden Sträuchern erstickt. Das Wasser mundete herrlich kühl.
„Ob es auch Fische gibt?“ fragte Bernd mit neu erwachtem Hunger. Sie warfen die Angel mit einem großen Käfer als Köder aus – ein blauschwarzer Fisch zappelte fast sofort daran.
„Hallo, der Sertao, das Durstland, liegt hinter uns!“
Schade nur, daß sie noch einmal das Wasser verlassen und durch das dornige Dickicht, das noch kein Dschungel war, einen Pfad schlagen mußten, damit sie überhaupt in einer Lichtung eine Stelle fanden, auf der sie sitzen und ein Feuer anmachen konnten!
Draußen briet bald der Fisch über der Flamme. Von dieser Höhe über dem Wasser sahen sie weit über die flach ausschwingende Niederung hin. Kein Flußlauf, keine Lichtung im Busch!
„Die große Mühe beginnt erst – wir werden uns noch den offenen geräumigen Sertao zurückwünschen!“ stöhnte Bernd.
„Dafür fehlt uns nie das Wasser!“ tröstete Enrico.
Und siehe, als sie gegen den Abend flußab wieder den Wasserlauf erreichten, landeten sie auf einer schmalen Praia mit schneeweißem, trockenem Sand! Ein Lagerplatz wie im Traum!
Sie fingen sich Fische, soviel sie essen konnten; der Rauch des grünen Feuers vertrieb die Moskitos. Sie waren diesmal zu faul, das Zelt zu bauen, wühlten sich in den warmen Sand wie einst die Caboclos, wickelten sich in das Zelttuch und schliefen wie Götter. Keine Riesenschlange erdrückte sie in der Nacht, kein Ameisenheer fraß ihnen im Schlaf die Kleider vom Leib, wie es in „echten“ Abenteuerberichten vorgekommen sein sollte!
Doch der Busch starrte ihnen am nächsten Morgen genauso abweisend entgegen wie am letzten Tag. Bernd blickte träumerisch auf den wenige Meter breiten, leise dahinströmenden Wasserlauf. „Er ist der einzige offene Durchlaß!“
Enrico verstand ihn sofort. „Wir sind große Narren! Lassen wir doch den verdammten Busch und waten in dem kleinen Rio weiter!“
Sie hatten im Nu die Kleider herunten und zu einem Bündel verschnürt. Anfangs war es ihnen etwas unbehaglich, mit den Füßen im trüben Wasser einen unsichtbaren Grund zu ertasten. Bald trat man auf einen versunkenen, rindenlosen Ast, bald wich verfaultes Laubwerk bei jedem Schritt auseinander. Als der Wasserlauf sich verengte, mußten sie eine kurze Strecke schwimmen. Weit vor ihnen lockte wieder eine weiße Sandbank.
„Was ist aus uns geworden?“ lachte Enrico. „Halb Landtier, halb Wassertier, könnte man sagen!“
Sie wanderten den namenlosen Fluß, den sie auf keiner Karte fanden, mit einem befreiten Gefühl hinab. Allerdings verlängerten die unzähligen Windungen des Flußlaufs den Reiseweg sehr. Tag für Tag fanden sie den prächtigsten Lager- und Schlafplatz, als wäre er seit jeher für sie angelegt.
Auch am vierten Abend geschah es wieder wie bestellt: Enrico warf die Angel aus, Bernd sammelte Dürrholz auf der Praia. Das Feuerzeug flammte auf – und mit der lautlos niedersinkenden Dämmerung schuf die knisternde Flamme über den Zweigen Licht und Raum. Der große Fisch, der am Spieß über dem Feuer hing, wog sicherlich vier Pfund. Wenn sie in den ersten Tagen eine leise Scheu vor Piranhas gefühlt hatten, war diese längst vorbei. Ein paradiesisches Tal am namenlosen Fluß!
Sie schliefen bereits beide, da fuhr Bernd erschrocken empor. Er rüttelte Enrico. „Hast du den Schrei gehört?“
Branco, der Forscher, drehte sich unwillig auf die andere Seite. „Schlaf weiter – du hast wieder von Indianern geträumt!“
„Wer redet von Indianern! Es war ein riesiger Vogel über uns!“
Enrico setzte sich schläfrig auf. „Was gibt es? Du siehst Gespenster!“
Er schaute um sich. Die Nacht erschien ihm sonderbar hell. Auf dem ruhigen Wasser lag ein rötlicher Schimmer. Der Dschungelrand – inzwischen hatte der Laubwald über den Dornbusch die Oberhand gewonnen – stand scharf gezeichnet im rot erhellten Nachthimmel. Und jetzt hörten die Lauschenden sogar ein fernes Krachen und Knistern, wo Flammen gegen den Dschungelrand stießen.
„Der Sertao brennt!“
Hier unten fühlten sie sich sicher. Aber sie blieben wach.
„Wer hat das Feuer gelegt?“
„Indianer – wer sonst?“
Diese Antwort lag auf der Hand. „Wir haben uns nie nach Spuren umgesehen!“ Bernd spürte ein neues Unbehagen.
„Morgen suchen wir sie!“ Enrico schlief schon wieder.
Am nächsten Tag fanden sie die nächste Praia von „Spuren“ übersät. Sie wunderten sich heimlich, daß sie noch keinen Indianer zu Gesicht bekommen hatten – das lag wohl an ihrer amphibischen Fortbewegung und an der undurchdringlichen Dschungelmauer.
Sie wateten – schweigsamer noch als bisher – den ganzen folgenden Tag flußab. Der Rio nahm langsam an Breite zu, doch seine Ufer lagen völlig unbewohnt. Die Sandbänke traten seltener auf. Früher als sonst bemerkte Bernd: „Auf der nächsten Praia bleiben wir für die Nacht!“
Es wurde fast düster, als sie endlich an einer Krümmung wieder Sand schimmern sahen. Sie hatten diesmal öfter schwimmen müssen; Enrico plante bereits, ein kleines Floß zu bauen. Allerdings besaßen sie dazu nur ihre stumpfen Messer – wie sollte man mit ihnen stärkere als armdicke Stämme fällen? Nun, morgen wollte man noch sehen, wie man weiterkam.
Sie stiegen am Ende der Praia aus dem Wasser, nackt, wie sie waren, und schlüpften zum Schutz gegen die jeden Abend zunehmende Moskitoplage in die Kleider. Geruch von Rauch lag in der Luft.
Als sie die Krümmung der Praia erreichten, standen sie plötzlich starr: eine noch rauchende Feuerstelle – darüber hing ein Kochtopf aus Aluminium. Kein Mensch ließ sich sehen; nur einige Hängematten schwankten verlassen auf dem Flußrand zwischen gerodeten Buschstangen!
„Indianer – wir haben sie verscheucht!“ flüsterte Bernd.
„Sie kommen wieder! Aber sieh doch dort – ein Aluminiumkessel, wie direkt aus Rio gekauft!“
Enrico schritt ungerührt darauf zu.
Ein Pfeil zischte neben ihm in den Sand.
Auf der Stelle hielt er an – er verstand die Warnung.
Er hob die Arme zum Zeichen der Waffenlosigkeit. „Hallo, amigos, bem!“ begann er sein altes Spiel von neuem.
Nichts, keine Antwort, kein Zeichen! Bernd war hinter die Krümmung verschwunden und riß das Gewehr aus der Gummihülle. Diesmal drohte unmittelbar Gefahr – er verkaufte sein Leben teuer! Vor allem brauchte Enrico Feuerschutz!
Branco versuchte es mit indianischen Brocken. „Arate, arate – wir sind friedlich!“ Das Aluminiumkesselchen faszinierte ihn. Wie kam es hierher? Doch nur durch Besucher vor ihnen! Das gab ihm die Ruhe, wieder voranzugehen. Neben dem rauchenden Kesselchen wollte er sich niederlassen und warten.
Diesmal zischte ein Pfeilhagel um ihn nieder – jeder einzelne hätte, ihn treffen können! Das war die letzte Warnung! Er trat nach rückwärts, aber er wandte den versteckten Schützen nicht den Rücken zu. Er fühlte, daß diesmal auch sein Herz klopfte, aber er winkte lachend mit den Händen. „Vender, bem – verkaufen, gut!“ rief er noch einmal den abweisenden Indianern zu.
Als er hinter der Krümmung Bernd mit dem Gewehr geduckt im Anschlag stehen sah, zischte er ihn an: „Bist du verrückt? Du hättest mein Tod sein können! Wahrscheinlich haben sie auch dich bereits entdeckt!“
Bernd senkte betroffen die Waffe. „Was sollte ich sonst tun?“
„Nichts – warten, bis sie kommen!“
Enrico zuckte die Schultern. „Wir sind in ihrer Hand – ohne die Möglichkeit, in einem Boot oder sonstwie zu verschwinden!“
„Du bleibst auf dieser Praia?“ fragte Bernd entsetzt.
„Ich will den Besitzer des Kesselchens sehen!“
Sie brannten ein Feuer an, fingen das Abendessen und taten so, als lebten sie noch immer allein an dem Fluß, der nicht einmal auf der Landkarte zu finden war. Sie wußten, daß jeder ihrer Handgriffe beobachtet wurde. Aber ihre Waffen lagen nun verborgen; sie saßen am niedersinkenden Feuer und streckten sich dann in der warmen Grube im Sand aus.
Keiner schlief in dieser Nacht. Erst gegen Morgen fielen ihnen die Augen zu.
Als Bernd Hoyer erwachte, saß jemand fünf Schritte neben ihrem Lager – ein bekleideter Mensch –, ein Weißer!
Er setzte sich auf. „Woher kommen Sie, Senhor?“
Der Mann schien erschöpft, blaß – wie ein Malariakranker. Er lächelte jetzt. „Ich wundere mich ebenso über Sie, Senhor, Ihren ruhigen Mut! Ohne mich wären Sie wahrscheinlich tot!“
Enrico hörte Gemurmel. Am Morgen war er stets schwer wachzukriegen. Er blinzelte, rieb sich die Augen. Er starrte hinüber.
„Senhor Parkins!“
Der weiße Besucher erhob sich ebenfalls. „Sie kennen mich? Für die Welt draußen müßte ich längst tot sein!“
Branco stellte sich vor, vollendet, wie es nur ein Brasilianer aus Rio fertigbringt. Er nannte auch Bernds Namen. „Wir suchten Sie, Senhor Parkins!“
Als Parkins aufstand, sah man, wie die abgenutzten Kleider an seinem mageren Körper schlotterten. „Das ist ein Wunder – nach einem Jahr werde ich noch gefunden!“ flüsterte er.
„Man suchte Sie damals sogar mit Flugzeugen und Motorbooten an den großen Strömen entlang. Man mobilisierte den Indianer-Schutzdienst, die Missionsstationen – wo steckten Sie diese ganze Zeit, Senhor Parkins?“
Der englische Forscher hob nachlässig den Arm. „Immer dort hinten bei den Cahambas. Sie meiden jeden Kontakt mit den Weißen. Dieser Fluß fehlt auf jeder Karte – wer sollte hier eindringen?“
„Wir wären vielleicht sofort weitergegangen, hätte mich nicht das Kochkesselchen festgehalten – es gehört Ihnen?“
Parkins nickte. Die Suchenden erfuhren, daß Parkins krank und von den Cavantes-Trägern verlassen an diesen Fluß gekommen war. Als ihn die Cahambas entdeckten, gab er sich als Doktor aus, der alle Wunden und Krankheiten heilen könne. Man nahm ihm darauf alles ab und behielt ihn bei sich. Er hatte mit Wundheilungen Glück. Eine schwere Infektion brachte ihn selbst vor zwei Monaten an den Rand des Todes. Er wurde gepflegt, seither ist er nicht mehr in Gefahr. Doch die Indianer wollen nicht, daß sie ihr guter Medizinmann verläßt. – Er zuckte die Schultern. „Ich war auch zu schwach, um zu fliehen!“
Enrico nickte verstehend. „Und was halten die Cahambas von uns?“
„Sie wollten euch vertreiben, aber nicht töten, wenn ihr sofort weitergezogen wäret. Ihre heimlichen Unterhaltungen machten mich aufmerksam – dann behauptete ich rasch, Ihr seid gekommen, mir Medizinen und Verbandzeug nachzuliefern. Da schickten sie mich zu euch – packt bitte einiges aus, damit meine Behauptung zutrifft!“
Es war eine sonderbare Situation – drei weiße Männer, die unter den vielen beobachtenden Augen der unsichtbaren Cahambas Kopfschmerz- und Abführtabletten aus einer Hand in die andere reichten, Verbandmittel und Penicillin-Ampullen auf den weißen Sand stapelten.
„Sie dürfen mich nicht bis zum Lager der Cahambas begleiten, Senhores – das mußte ich dem Ältesten versprechen. Sie wollen für immer verborgen bleiben und nichts mit den fremden Weißen zu tun haben.“
„Sie kommen nicht mit uns?“ fragte Enrico fassungslos.
Parkins zuckte die Schultern. „Ich würde es noch nicht schaffen, sieben oder zehn Tage, vielleicht noch länger zu Fuß unterwegs zu sein. Vielleicht ließen sie mich fort, wenn ich verspräche, wieder zurückzukommen. Die Cahambas vertrauen mir, und ich konnte ihr Leben studieren. Ich will bei ihnen bleiben – vorläufig.“
Enrico Branco atmete tief und erregt. „Ich sehe das ein; wir besitzen weder ein Boot noch ein Flugzeug. Wir haben uns nur an diesen Fluß verirrt, und Sie retteten uns das Leben. Aber wir kommen wieder – bald!“
Mac Parkins lächelte nachsichtig. „Erst müssen sie selbst aus der Wildnis des Sertao kommen. Es ist mir unbekannt, was Sie auf Ihrer Wanderung noch erwartet. Nach meiner Berechnung mündet unser Rio irgendwo in den Araguay. Viele Tagereisen weit liegen seine Ufer unbewohnt; sie sollten sich ein Floß bauen, später! Und übereilen Sie nicht meine Rettung – ich lebe im Schutz der Cahambas.“
Sie trennten sich. Enrico Branco und Bernd Hoyer wanderten weiter, ohne einen einzigen Cahamba-Indianer gesehen zu haben.
Zwei Monate später landete ein Hubschrauber der brasilianischen Luftwaffe mitten im Lager der Cahambas. Es gab einige Pfeilschüsse, und die entsetzten Cahambas tauchten im Dschungel unter. Mac Parkins tat es sehr leid, nicht von der ganzen Sippe freundlichen Abschied nehmen zu können. Er kehrte über Rio nach London zurück.