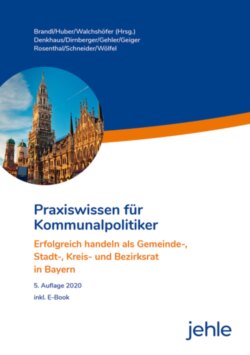Читать книгу Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Franz Dirnberger - Страница 360
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.1Selbstverwaltung – was ist das?
Beispiel:
„Wir wollen aber die Tempo-30-Regelung in unserer Ortsstraße! Das ist unsere Sache und geht das Landratsamt nichts an!“, ruft Gemeinderat Berger erzürnt, als der Bürgermeister ein Schreiben des Landratsamts verliest. Darin wird beanstandet, dass die Gemeinde für die Uferstraße keine Tempo-30-Regelung anordnen darf, weil nach der StVO die Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien. Die Ratsmitglieder sehen durch das Schreiben des Landratsamts „ihr“, d. h. das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde verletzt.
„Das ist unsere eigene Sache, hier entscheiden wir alleine, das betrifft unsere Hoheit oder Autonomie“, sind die Schlagworte.
Nicht alles was nach dem ersten Anschein rein örtlichen Bezug hat ist damit automatisch ureigene und damit selbstverantwortbare Angelegenheit einer Kommune. Eine Grundüberlegung bei der Abgrenzung ob wir uns tatsächlich im Bereich der Selbstverwaltung bewegen ist immer, ob es wirklich um eine rein örtliche Angelegenheit geht oder eher um eine Aufgabe die die Gemeinden für den Staat erledigen.
In unserem Fall geht es um die Umsetzung der bundesrechtlich geregelten Straßenverkehrsordnung. Die Umsetzung dieser Verordnung wird zwar kommunal gemanagt, ist aber auf die Gemeinden gesetzlich übertragen und damit nicht Teil der Selbstverwaltung! Das ist auch gut so. Stellen sie sich vor jede Gemeinde würde eigene Verkehrsregeln erlassen.
Was aber ist dann Selbstverwaltung?
Im Kontext der französischen Revolution finden wir den Begriff „Pouvoir Municipal“. Übersetzt: kommunale Gewalt. Das begründet eine Eigenständigkeit der Gemeinde gegenüber dem Staat. Im deutschsprachigen Raum prägte Freiherr vom Stein das Verständnis der Selbstverwaltung im Sinne einer bürgerschaftlich orientierten, staatsergänzenden Verwaltung. Aber erst die liberale Bewegung Mitte des 19. Jahrhunderts führt zum Selbstverwaltungsverständnis der Neuzeit, das bis heute gilt.
Das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ist demnach das verfassungsrechtlich eingeräumte Recht auf eigenständige, d. h. staatsunabhängige Organisation und Regelung der eigenen Angelegenheiten. Wesentlich und zum Kern der Selbstverwaltung gehören
die Gebietshoheit, verstanden als der räumliche Wirkungsbereich
die Organisationshoheit, verstanden als das Recht, die Organisation der Kommune im Inneren zu regeln, z. B. welche Abteilungen und Sachgebiete gebildet werden, wer in der Kommune wofür zuständig ist
die Satzungshoheit, verstanden als das Recht, durch das zuständige Gremium (in der Regel Gemeinderat etc.) Satzungen als Ortsrecht zu erlassen
die Personalhoheit, verstanden als das Recht, eigenes Personal einzustellen und entsprechend einzusetzen sowie die dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen
die Finanz- und Abgabenhoheit, verstanden als das Recht, im Rahmen der Gesetze die Finanzen der Kommune eigenverantwortlich zu regeln und einen Haushalt zu bilden und
Bereiche der Selbstverwaltung
die Planungshoheit: Dies ist das Recht, die wesentlichen Entwicklungsleitlinien der Gemeinde durch verbindliche Planungen festzulegen, insbesondere durch Flächennutzungsplan und Bauleitplan Baurecht zu schaffen oder zu versagen.