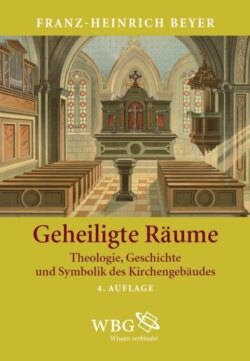Читать книгу Geheiligte Räume - Franz-Heinrich Beyer - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Steinwerdung des christlichen Credo – Jerusalem als Mnemotop
ОглавлениеJerusalem mit dem Tempel war im Jahr 70 im Ersten Jüdischen Krieg zerstört worden. Nach dem Zweiten Jüdischen Krieg wurde Jerusalem in die römische Kolonie Aelia Capitolina umgewandelt. Auf dem Tempelplatz entstand ein Jupitertempel.46 Ferner wurde ein Temenos mit Jupiter- und Venus-Tempel errichtet, und zwar an dem Ort, der der Überlieferung nach der Hügel Golgatha ist. In vorkonstantinischer Zeit gab es wohl im Stadtgebiet von Aelia keine Kirchen. Lediglich auf dem Anwesen Zion und auf dem Ölberg fanden sich Kirchengebäude.
Für die Zeit der Regierung Konstantins und insbesondere verbunden mit dem Konzil von Nicäa (325) lässt sich ein Kirchenbauprogramm für Jerusalem, die „Steinwerdung des Credo“, beschreiben. Nicht ohne Belang dafür dürfte die überlieferte Palästinareise der Kaisermutter Helena Ende der zwanziger Jahre des 4. Jahrhunderts gewesen sein und die Überlieferung von der Auffindung des Kreuzes durch sie.
Bereits 326 wurde in Bethlehem eine fünfschiffige Basilika (Martyrion) mit einem Oktogon über der Geburtsgrotte geweiht (Basilika zum Gedenken der Menschwerdung). Ob an dieser Stelle zuvor ein heidnischer Rundtempel gestanden hatte, ist nicht eindeutig zu klären, aber durchaus möglich. In Jerusalem ließ Konstantin die römische Tempelanlage über Golgatha abtragen. Die darunterliegende, ganz in den Fels hineingehauene Grabkammer wurde aus dem Felsen gelöst und architektonisch gefasst. Das Grab wurde von einem überkuppelten Rundbau, mit einer Apsis im Westen, umschlossen (Anastasisrotunde). Im Osten lag ein Atrium mit Säulengängen davor, die durch den hoch aufragenden Felsen „Golgatha“ unterbrochen wurden. Auf ihm war zunächst ein einfaches Kreuz aufgestellt, das im 5. Jahrhundert durch ein monumentales gemmengeschmücktes Prachtkreuz ersetzt wurde. Östlich an das Atrium schloss eine fünfschiffige Basilika (Martyrion) an.47 Auf dem Ölberg wurde eine Basilika zum Gedenken an die Himmelfahrt errichtet (Eleona), die noch im 4. Jahrhundert durch eine Rotunde (Imbomon) ergänzt wurde. Diese Kirche bestand aus einem kreisförmigen, zum Himmel offenen Säulengang, der – innerhalb eines bronzenen Geländers – den Felsen des Hügels und die Fußabdrücke des aufgefahrenen Christus umschloss.48 In diesem Zeitraum entstand auch in Gethsemane eine Basilika zum Gedenken des Gebets Jesu. Noch im 4. Jahrhundert entstand die Kirche zum Gedenken an die Aussendung des Heiligen Geistes (Hagia Sion). Ebenso wurde über den Reliquien Johannes’ des Täufers eine Kapelle errichtet.
Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurde Jerusalem im 4. Jahrhundert zum Mnemotop. Das herausragende, das Stadtbild dominierende Bauwerk dürfte zu jener Zeit die Rotunde der Grabeskirche gewesen sein. In der Folge wurden noch weitere Kirchenbauten errichtet. Sie orientieren sich in der Lage am Wirken Jesu: in Bethanien eine Kirche zum Gedenken an die Erweckung des Lazarus, in Jerusalem Kirchen u.a. an der Stelle der Verurteilung durch Kaiphas (S. Petrus, 438) sowie an der Stelle der Verurteilung durch Pontius Pilatus (Hagia Sophia, 435).
Abb. 3: Jerusalem, Grabeskirche, Grundriss der Anlage im 4. Jahrhundert.
Um 400 waren alle Kirchen „durch Stationsliturgien und Prozessionen in den Gottesdienst der Jerusalemer Stadtgemeinde einbezogen. Am Grab Christi in der Anastasis fanden tägliche Liturgiefeiern und der Abschluß von Prozessionen statt, auf Golgatha die Gottesdienste am Gründonnerstag und Karfreitag und im Martyrion die Hauptgottesdienste an Sonn- und Festtagen. … Das Imbomon auf dem Ölberg ist am Gründonnerstag und Pfingsten Prozessionsziel …“49 Die Feste wurden an ‚Originalschauplätzen‘ gefeiert und dabei mit Schriftlesungen erklärt. So kann die Jerusalemer Liturgie als Fundament des christlichen Kirchenjahres angesehen werden.
Mit der Geburtsgrotte (Oktogon), dem Grab (Rotunde), dem Golgathafelsen und der Himmelfahrtskirche (Imbomon) wurden nicht nur lokale Traditionen, sondern auch konkrete geologische Gegebenheiten eingefasst, hervorgehoben und als Orte bewahrt. Über die Hervorhebung einzelner Orte hinaus wurde durch solche „Steinwerdung des Credo“ die gesamte Landschaft als christlich geprägt herausgestellt, mit der Grabeskirche als dominierendem Bauwerk.