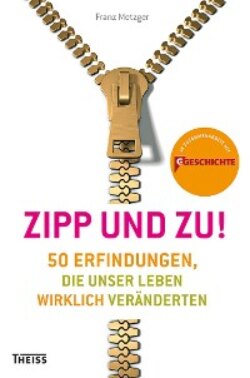Читать книгу Zipp und zu! - Franz Metzger - Страница 13
Оглавление[Menü]
Glühbirne
Quelle der Erleuchtung
Ohne uns darüber Gedanken zu machen, schalten wir morgens im Badezimmer die Lampe über dem Spiegel ein, per Knopfdruck verschaffen wir uns eine bessere Sicht beim Autofahren, lesen vor dem Einschlafen noch ein gutes Buch. Doch so selbstverständlich sollten wir das elektrische Licht nicht nehmen ...
»E14« oder »E 27« sind keine Lebensmittelzusätze, sondern Sockeltypen von Glühlampen. Das »E« steht für Edison, die Zahl gibt den Gewindedurchmesser an. Thomas Alva Edison gilt zwar als Erfinder der Glühbirne, aber schon lange vor ihm ging anderen Tüftlern ein Licht auf.
Bei der Erforschung der Elektrizität stieß man auf ein verblüffendes Phänomen: Aus Stromquellen sprangen »knisternde Funken von bläulicher Farbe und einigen Zoll Länge« durch die Luft auf einen Leiter über. Könnte man diese Funken dauerhaft machen, hätte man ein neuartiges »künstliches« Licht. Das gelang 1813 Humphrey Davy mit der Erfindung der »Bogenlampe«. Deren Mängel waren jedoch groß: Sie erzeugte ein sehr grelles Licht, war nicht abschaltbar, und ihre Kohleelektroden brannten rasch nieder.
»Jeder Fortschritt und jeder Erfolg entspringt dem Denken.«
Thomas Alva Edison
Spätere Experimente wiesen einen anderen Weg: »Schlechte« Leiter (wie Holzkohle oder Platin), die man direkt in den Stromkreis schaltete, erhitzten sich bis zur Weißglut, wobei die Lichtausbeute überproportional mit der Temperatur stieg. Doch auch dabei verbrannte die Holzkohle aufgrund ihres Sauerstoffgehalts, und Platin gab erst bei Erreichen seines relativ niedrigen Schmelzpunktes genügend Licht ab. Ein luftleerer Hohlkörper als Ort des Glühvorgangs würde dies verhindern; das Vakuum hatte schon 1644 Torricelli zur Erfindung des Barometers genutzt. Mit der Verbindung beider Prinzipien entwickelten schließlich De Moleyns und J. W. Starr (1841 bzw. 1845) unabhängig voneinander die ersten elektrischen »Glüh«-Lampen. Ihre wenig ausgereiften Patente fanden aber keine praktische Anwendung.
Mehr Erfolg hatte der 1818 in Springe geborene Mechaniker Heinrich Goebel. Er kam 1848 nach New York, eröffnete eine Werkstatt und tüftelte an einer werbewirksamen Beleuchtung für sein Geschäft. Mit verkohlten, 0,2 mm starken Bambusfasern aus einem Spazierstock, die er in eine Flasche eingoss und an eine Zink-Kohle-Batterie anschloss, war es 1854 so weit: Seine »Kohlefadenlampe« schaffte bis zu 200 Betriebsstunden – allerdings fehlte dazu noch eine langlebige Stromquelle. Goebel wurde belächelt und als Störenfried angefeindet, aber er kämpfte um die Anerkennung seiner Idee. Als er schließlich 1893 – kurz vor seinem Tod und finanziell ruiniert – den Prozess um das Kohlefadenpatent gegen Edison gewann, war es für eine Vermarktung zu spät. Auch anderen Glühlampenpionieren wie Warren de la Rue, Lodygin, Sawyer oder Swan blieb der große Erfolg versagt.
Die Wende in Sachen Glühbirne
Das Vakuumverfahren hatte man mit der 1865 von Hermann Sprengel erfundenen »Quecksilber-Luftpumpe« in den Griff bekommen. Die große Wende in Sachen Glühbirne kam jedoch 1866 durch Werner von Siemens’ Erfindung der Dynamomaschine. Mit ihr konnte ein dauerhaft konstanter »Starkstrom« erzeugt werden, der sich auch über größere Distanzen verteilen ließ. In diesem Entwicklungsstadium trat 1876 Thomas Alva Edison auf den Plan. In seinem Labor Menlo Park bei New York entwickelten Mitarbeiter verschiedener Disziplinen neue Produkte. Darunter auch Glühlampen, die mit Platinstreifen oder verkohltem Papier unter hoher Spannung betrieben werden sollten. Als diese Versuche scheiterten, ließ Edison mehrere Tausend Naturstoffe auf ihre Eignung als Lichtquelle prüfen, bis sich 1879 – ausgerechnet mit verkohlter Bambusfaser – der Erfolg einstellte. Die Birnen, für die Edison die Sockel nebst Fassung erfand, ließen sich problemlos auswechseln und brachten es auf 40 Stunden Brenndauer. 1881 baute Edison einen von einer Dampfmaschine angetriebenen Generator und installierte mit 115 Birnen auf dem Dampfer »Columbia« die erste Beleuchtungsanlage. Auf der »Internationalen Elektrizitätsausstellung« 1882 in Paris stellte er dem staunenden Publikum seine Anlage vor. Der spätere weltweite Erfolg seines Patents basierte darauf, dass er komplette Systeme anbot. Dazu gehörten – neben »Kraftwerk« und Lampe – Schalter, Verteiler und Leitungsnetze, die es möglich machten, Strom über weite Strecken an verschiedene Stellen zu leiten, um dort eine beliebige Zahl Lampen gleichzeitig oder auch einzeln zum »Brennen« zu bringen.
Licht an! Die Glühbirne hält Einzug in den Alltag
Bereits 1884 erstrahlte die Pariser Oper in elektrischem Licht; und 1886 waren in Berlin bereits die Hälfte der Theater, Banken, Hotels und Geschäfte – inklusive Schaufenstern – damit ausgestattet. Das »neue« Licht übte auf die Zeitgenossen eine magische Faszination aus, blieb aber noch lange ein kostspieliges Prestigeobjekt. Im Privatbereich setzte es sich nur zögernd gegen das preiswertere, wenn auch ungesunde Gaslicht durch. Erst als um 1900 die »Metallfadenlampe«, die mit Temperaturen von 2500 °C betrieben werden konnte, aufkam, nahm die elektrische Beleuchtung rasant zu. In den USA brannten damals bereits 25 Millionen Glühbirnen, und Europa zog nach: Bereits 1883 wurde die »Deutsche Edison-Gesellschaft«, die spätere AEG, gegründet; 1891 entstand in Holland der »Philips«-Konzern und 1919 die »Osram-Auergesellschaft«. Durch Perfektionierung und Massenfabrikation stiegen diese Hersteller bald zu Marktführern auf. Zur Herstellung metallener, in sogenannte »Wendel« geformter Glühfäden verwendete Carl Auer von Welsbach eine Paste aus Osmium, die durch winzige Düsen gepresst und dadurch getrocknet wurde. Resultat war 1902 die »Osmium-Glühlampe«. Ab 1903 wurden Glühfäden aus Tantal und seit 1906 aus dem noch heute verwendeten Wolfram (bis herab auf 0,013 mm Stärke) gezogen.
Weil elektrisches Licht um 1910 noch immer sehr teuer war – eine kWh kostete in Deutschland damals eine Mark –, machte sich Irving Langmuir Gedanken, wie man den Stromverbrauch senken könnte. Langmuir füllte die Glaskolben mit Licht verstärkendem Argongas und erfand 1913 die »Halbwattlampe«, den später von William David Coolidge verbesserten Vorläufer der heute handelsüblichen Energiesparlampe.
Kino, Fotografie, Optik usw. – was wären sie ohne die Glühlampe? Auch die Medizin setzte auf die »Birne«: Für Magenuntersuchungen wurden Glühlampen von 3,5 mm Länge und 2 mm Breite und kleiner entwickelt. Das kuriose Gegenstück dazu ist die 1954, zum 75. Jubiläum von Edisons Erfindung, am Rockefeller-Center in New York installierte »größte Glühbirne der Welt«: Sie ist 105 cm hoch, hat einen Durchmesser von 51 cm und eine Leistung von 75 000 Watt.
Von Minilampen für die Medizin
bis zur »größten Glühbirne der Welt«: Die Vielfalt an
Glühbirnentypen ist heute kaum noch zu überblicken.
Die Vielfalt an Glühbirnentypen ist heute kaum noch zu überblicken. Neuere Forschungen gehen dahin, anstelle von Strom das Licht direkt aus einem zentralen Plasmastrahler zu verteilen. Quo vadis, Glühlampe?
Herbert Hartkopf